Klimagipfel: Einigung in letzter Minute
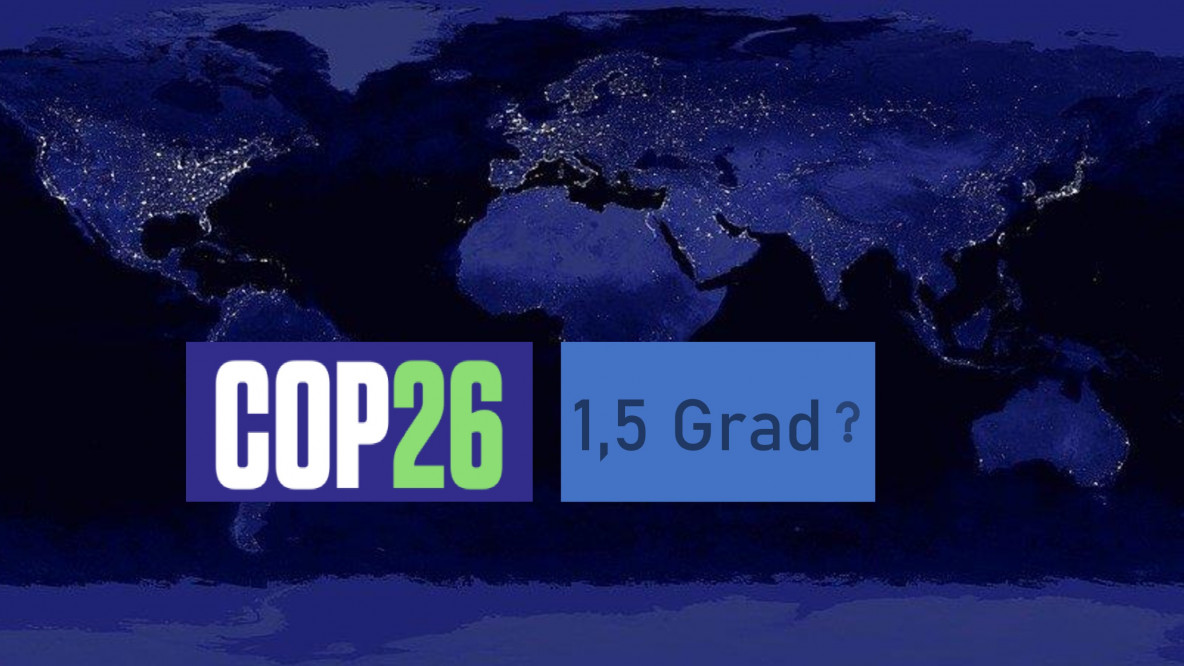
Die COP26 in Glasgow war trotz Covid-Pandemie mit weit über 30,000 Teilnehmer/innen die größte Klimakonferenz, die es je gegeben hat. Zwei Wochen lang haben Staats- und Regierungschefs und Delegierte aus 197 Ländern verhandelt und eine Reihe von Abkommen unterzeichnet, die zumindest auf dem Papier einen positiven Wendepunkt im Hinblick auf den Klimawandel bedeuten. Nach einem sehr schwierigen Endspurt wurde der Glasgow-Klimapakt am Samstagabend von allen 197 Staaten beschlossen. Indien und China, die größten Kohleverbraucher hatten in letzter Minute dem Abkommen zugestimmt, nachdem die Forderung nach einem Kohleausstieg und dem Stopp von „ineffizienten“ Subventionen für fossile Energien in der gemeinsamen Abschlusserklärung abgemildert wurde. Bezüglich Kohle ist nicht mehr von einem Ausstieg (phase-out) die Rede, sondern nur noch von einem Abbau (phase-down). Diese Änderung löste vor allem bei den europäischen Ländern, aber auch bei mehreren kleinen Inselstaaten, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, Enttäuschung und Verärgerung aus. Doch schließlich stimmten alle 197 Länder der Vereinten Nationen trotz starker Vorbehalte dem Deal zu.
.
Die Dringlichkeit der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele, die internationale Wissenschaftler in ihrem im August veröffentlichten Klimabericht "Code Red for Humanity" zum Ausdruck gebracht haben, fehlt allerdings in der Abschlusserklärung. Vielmehr wurden weitere Entscheidungen zur Reduzierung der Emissionen fossiler Brennstoffe auf die nächste Klimakonferenz verschoben, die 2023 in Scharm el-Scheich in Ägypten stattfinden wird.
.
Die wichtigsten Punkte des Glasgow-Abkommens
.
Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel
Das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel bleibt erhalten, die Länder sollen bis Ende 2022 ihre bisher unzureichenden Klimaschutzpläne nachschärfen und bereits Ende 2023 aktualisierte Pläne zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 bei der COP27-Konferenz in Ägypten vorlegen. Vor Glasgow waren die Länder verpflichtet, dies erst bis 2025 zu tun. Die zur Erreichung für der 1,5-Grad-Grenze notwendige Senkung der Emissionen um 45 % bis 2030 im Vergleich zu 2010 ist auch in der Abschlusserklärung von Glasgow festgehalten.
Fertigstellung des Regelbuchs des Pariser Klimavertrages
In Glasgow wurde auch mit fünfjähriger Verspätung das Regelbuch des Pariser Klimavertrags* zu Ende verhandelt.
Transparente Überprüfung der nationalen Klimapläne
Die Länder einigten sich auf eine transparentere Überprüfung der nationalen Klimapläne, die sie bei der UNO einreichen. Ab 2024 müssen die Länder alle zwei Jahre ihre Emissionsbilanz offenlegen, also angeben, wie viel CO₂ oder Methan emittiert wurden.
Fossile Brennstoffe erstmals in einer Abschlusserklärung erwähnt
Erstmals in der 25-jährigen Geschichte der UNO-Klimakonferenzen ist es gelungen, dass der längerfristige Kohleausstieg und das Ende der Subventionen für fossile Energieträger überhaupt in der Abschlusserklärung erwähnt und eingefordert wurden, wenn auch auf Druck von Indien und China in abgeschwächter Form. Seit vielen Jahren wurde erfolglos versucht in den Abschlusserklärungen der diversen Klimakonferenzen festzuhalten, dass fossile Brennstoffe mit Abstand die Hauptverursacher der globalen Erwärmung sind und Kohle am meisten Treibhausgase emittiert.
Kohleausstieg
Mehr als 40 Länder haben sich darauf geeinigt in den 2030er- oder spätestens 2040er-Jahren aus Kohle aussteigen, 23 dieser Staaten bekennen sich zum ersten Mal zu einem solchen Schritt. Doch die größten Kohleproduzenten und Kohleverbraucher wie China, Indien, Australien und die USA fehlen bei dieser Allianz. Australiens Ressourcenminister bekräftigte, dass Australien, der weltweit größte Kohleexporteur, noch jahrzehntelang Kohleminen und Kohlekraftwerke betreiben werde. Die bei der Verbrennung von Kohle entstehenden Treibhausgase tragen anteilsmäßig am meisten zum Klimawandel bei.
Stopp der Entwaldung
Mehr als 100 Staats- und Regierungschefs der Welt haben sich darauf geeinigt die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Auch Brasilien gehört zu den Unterzeichnern, das in den letzten Jahren große Teile des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt hat. In den beteiligten Staaten befinden sich mehr als 85 % der weltweiten Waldfläche. Neben den EU-Ländern beteiligen sich auch die Länder mit den größten Waldflächen der Welt, wie Kanada, Russland, Brasilien, Indonesien, Kolumbien, sowie China und Norwegen.
Senkung der Methan-Emissionen um 30% bis 2030
Über 90 Staaten, die zwei Drittel der Weltwirtschaft ausmachen, verpflichteten sich die Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 % gegenüber dem heutigen Stand zu senken. Große Methan-Emittenten wie China, Indien, Russland und Australien haben sich nicht dieser Verpflichtung angeschlossen. Methan ist nach CO2 der zweitwichtigste Verursacher des Klimawandels und fällt vor allem in der Öl- und Gasindustrie an **, aber auch in der Landwirtschaft und auf Mülldeponien wird Methan freigesetzt.
Finanzielle Hilfe für arme Länder zur Bewältigung der Klimakrise
Bei der Klima-Finanzierung der armen Länder durch die wohlhabenden Staaten gab es Fortschritte, so soll bis 2025 eine Verdoppelung der Finanzierung gegenüber dem Niveau von 2019 gewährleistet sein. Hilfsorganisationen bemängeln, dass das Hilfsvolumen viel zu gering sei. Beim Plan zur Gründung eines Verlust-und-Schadenersatz-Fonds kam es jedoch zu keiner Einigung.
Regeln für weltweite CO2-Märkte
Die Länder einigten sich auf Regeln für den CO2-Emissionshandel, dadurch könnten Milliarden von US-Dollar für den Schutz der Wälder, für die Errichtung von Anlagen für erneuerbare Energien und andere Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels freigesetzt werden. Auch der Kernforderung der ärmeren Länder, den bilateralen Handel zwischen Staaten nicht zu besteuern, um die Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen zu unterstützen, wurde stattgegeben.
Positiv bewertet wurde ein überraschend geschlossener Klimapakt zwischen China und den USA. Die beiden größten Verursacher der weltweiten CO2-Emissionen, die in vielen politischen und Wirtschaftsfragen große Differenzen haben, verständigten sich auf eine intensive Zusammenarbeit beim Klimaschutz mit dem Ziel den Umbau zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft zu beschleunigen und verstärkte Maßnahmen zu ergreifen, um die Welt vor einer Erwärmung um mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber dem Vorindustriealter zu bewahren.
.
Reaktionen auf den Glasgow Klima-Pakt
Laut UNO-Generalsekretär Antonio Guterres seien die Beschlüsse von Glasgow voller Widersprüche und reichten nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen und eine Klimakatastrophe zu verhindern.
Auch Umweltorganisationen sehen den Glasgow-Klimapakt kritisch. Es werde zwar das Ende der weltweiten Kohleverbrennung eingeleitet, doch auf Druck der fossilen Industrie ließen die Beschlüsse „Klarheit und Geschwindigkeit“ vermissen, so der deutsche Greenpeace-Chef Martin Kaiser.
Laut NGO Global 2000 sind die „Beschlüsse von Glasgow zahnlos, schöne Worte reichen nicht, um die Klimakrise zu lösen. Die Welt sei noch immer auf direktem Weg in die Klimakatastrophe.“
Laut Klima-Wissenschaftler gab es zwar Fortschritte im COP26-Deal, die auf dem zweiwöchigen Cop26-Gipfel in Glasgow gemachten Zusagen zu Emissionssenkungen blieben aber weit hinter denen zurück, die erforderlich wären, um die Temperaturen auf 1,5 ° C zu begrenzen.
Für die vielen jungen Klimaaktivisten, wie Greta Thunberg war der Glasgow-Klimagipfel ein Misserfolg und eine große Enttäuschung, da es nicht gelungen sei die systemischen Veränderungen einzuführen, die zur Erreichung der Klimaziele dringend notwendig seien.
"Es ist bitter, dass auch bei diesem Klimagipfel die armen und vom Klimawandel besonders betroffenen Länder von der EU und den USA zu wenig Unterstützung zur Bewältigung der Klimafolgeschäden zugesagt bekommen haben", sagt Klima-Experte Jan Kowalzig von Oxfam***.
"Auf dem Klimagipfel in Glasgow seien wichtige Fortschritte gemacht worden, aber es gäbe noch harte Arbeit zu verrichten“, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Trotz der Enttäuschung über die Abschwächung bezüglich der Forderung nach dem Kohleausstieg bezeichnete EU-Kommissar Frans Timmermans die Abschlusserklärung als „historisch“.
Fazit
Die wichtigsten Errungenschaften des Glasgow-Abkommens sind zweifellos die Verpflichtung zum längerfristigen Abbau der Kohleproduktion und zum Stopp von „ineffizienten“ Förderungen für die fossilen Energien Kohle, Öl und Gas, auch wenn in letzter Minute auf Druck der größten Kohleverbraucher China und Indien die Verpflichtungserklärung abgeschwächt wurde und es keinen Zeitrahmen gibt. Der Erfolg des Glasgow-Klima-Paktes wird letztendlich davon abhängen, ob die Länder im nächsten Jahr mit ehrgeizigeren Plänen zur Senkung ihrer Treibhausgasemissionen, als es in der Vergangenheit der Fall war, zur COP27 nach Ägypten kommen und diese Verpflichtungen auch entsprechend umsetzen.
* Das Regelbuch des Pariser Klimavertrags gibt vor, wie die Staaten die Beschlüsse und Ziele des Pariser Abkommens umsetzen, sowie transparent und überprüfbar dokumentieren werden.
**Methan (CH4) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Der Energieträger Gas besteht aus einem Gemisch von verschiedenen Gasen, wobei Methan den Hauptbestandteil ausmacht. Je nach Fördergebiet besteht Gas bis zu über 90% aus Methan. Durch undichte Stellen (Leckagen) entlang der gesamten Lieferkette, bei der Gasförderung, beim Transport über Gas-Pipelines oder bei der Speicherung in Tanks kann Methan entweichen. Auch bei der Gas- und Erdölförderung durch die Methode des „Frackings“ kommt es häufig zu Methanemissionen.
*** Oxfam ist ein internationaler Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen mit dem Ziel Menschen in armen Ländern dabei zu unterstützen nachhaltige und sichere Existenzgrundlagen zu schaffen und Zugang zu Bildung, gesundheitlicher Versorgung, Trinkwasser und Hygiene-Einrichtungen sowie Unterstützung bei Krisen und Katastrophen zu erhalten.
Danke für die umfassende
Danke für die umfassende Information zu Glasgow. Könnten Sie bitte noch Einzelheiten nachliefern zu den Aussagen über den Verlust der Artenvielfalt und Reparaturmaßnahmen für Natur und Umwelt? Von Ihrem Artikel her habe ich den Eindruck, das Hauptziel war die Reduktion der fossilen Energieträger, während die notwendige Reduktion der Massenproduktion (Transit- und Privattransport, Zement, Asphalt...) kaum Gegenstand der Verhandlungen war, ebensowenig wie die Ernährungsfrage, weswegen die agrochemische nebst der Nahrungsmittelproduktion aus dem Fadenkreuz verschwunden sind. Stimmt dieser Eindruck?
In reply to Danke für die umfassende by Klaus Griesser
@Klaus Griesser Vielen Dank
@Klaus Griesser Vielen Dank für Ihren Kommentar.
Beim Klimagipfel in Glasgow ist es in erster Linie um die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen (CO2 und Methan), die durch fossile Energien verursacht werden, gegangen.
Mehr als 100 Länder haben sich in Glasgow auch verpflichtet, die Abholzung der Wälder bis 2030 zu beenden. Dieses Abkommen betrifft neben dem Klimawandel auch den Artenschutz. Vor allem in den Regenwäldern (z.B. Amazonas-Regenwald) gibt es eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Die Abholzung hat zu einem starken Verlust der Biodiversität und Artenvielfalt geführt. In den Unterzeichner-Staaten dieses Abkommens befinden sich mehr als 85% der weltweiten Waldfläche.
In reply to @Klaus Griesser Vielen Dank by Monika Psenner
Danke @Monika Psenner für
Danke @Monika Psenner für Ihre Informationen. Ich komme zunehmend drauf, dass erst Teilaspekte des Klimawandels, und die unbefriedigend angegangen wurden, wenngleich es noch zu früh ist für eine definitive Bewertung der Konferenz - schließlich muss so manches erst hinterher im Detail ausgehandelt werden. Ich entschuldige mich, dass ich Sie demnach mit meinen Fragen überfordert habe.
Ein kleines, auch für Südtirol bedeutsames Detail aus einem COP26-Dokument ist mir bei meiner Recherche herausgekommen:
"….Die Landwirtschaft ist zwar ein Opfer des Klimawandels, trägt aber auch zu ihm bei. Die wichtigsten direkten Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft sind Lachgasemissionen aus Böden, Düngemitteln und Dung von Weidetieren sowie die Methanproduktion durch Wiederkäuer und den Anbau von Rohreis. Beide Gase haben ein wesentlich höheres Erderwärmungspotenzial als Kohlendioxid. ..." (übersetzt aus https://unfccc.int/news/cop26-sees-significant-progress-on-issues-relat…)
In reply to Danke @Monika Psenner für by Klaus Griesser
@Klaus Griesser Danke für
@Klaus Griesser Danke für Ihren interessanten Kommentar.
Insgesamt wird der Anteil von CO2 (Kohlenstoffdioxid) an den gesamten weltweiten Treibhausgas-Emissionen auf 76% geschätzt, wobei der Großteil durch die Verbrennung fossiler Energien verursacht wird.
16% der Treibhausgas-Emissionen entfallen auf Methan, die hauptsächlich durch die Landwirtschaft und durch fossile Energien verursacht werden. Auch bei der Müllverbrennung kommt es zu Methanemissionen.
Lachgas (N2O) -Emissionen tragen mit circa 6% zu den weltweiten Treibhausgas-Emissionen teil. Landwirtschaftliche Aktivitäten, wie der Einsatz von Düngemitteln, sind die Hauptquelle für N2O-Emissionen, doch auch bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe kommt es zu N2O Emissionen.
2% der Treibhausgas-Emissionen werden durch andere Treibhausgase (fluorierte Treibhausgase / F-Gase) verursacht. Industrielle Prozesse, sowie Kühlsysteme und die Verwendung einer Vielzahl von Konsumgütern tragen zu Emissionen von
F-Gasen bei.
Die Zahlen basieren auf Schätzungen der EPA (United States Environmental Protection Agency). Andere Institutionen kommen auf ähnliche Schätzungen.
Während es für die CO2 Emissionen schon seit Jahren relativ gute Statistiken gibt, mangelt es bei den Methanemissionen und den Emissionen anderer Treibhausgasen noch an verlässlichen Daten.
Umso drastischere Maßnahmen
Umso drastischere Maßnahmen wird man dann wohl in Zukunft ergreifen müssen, wenn die äußeren Umstände dies unausweichlich erfordern werden, mit der Natur und den Naturgesetzen kann man nicht verhandeln... Südtirol, als reiches und geografisch bevorteiltes Land, könnte sich auf die zukünftigen Erfordernisse bestmöglichst vorbereiten, unabhängig der COP26-Ergebnisse in Glasgow,- leider ist die Gesellschaft dazu (großteils) wohl noch nicht dazu bereit bzw. verkennt in den Alltagssorgen das Schlamassel in dem wir uns befinden. Jene Teile der Politik, die nicht nur ihr Klientel bedienen wollen und das als alleinigen Auftrag ansehen, ist dazu noch dem großen unausweichlichem Druck der Verbände mit ihren teils unersättlichen Wünschen ausgeliefert. Das Umsteuern ist schwierig, wird aber kommen müssen und ich hoffe dass zunehmend finanzielle Mittel für diese Ziele zur Verfügung gestellt werden (Ausbau ÖPNV, Kreislaufwirtschaft, soziale Gerechtigkeit usw.) und in anderen Bereichen auch völlig eingestellt wird (z.B. zig Beiträge in der Landwirtschaft, Tourismusförderung usw.).
Für mich liest sich das
Für mich liest sich das Ergebnis von COP26 bezüglich der behandelten Themen prinzipiell analog wie das Verhältnis der Vinschger "Korrnr" (="mier" Normalbürger*n) zu den Anderen (= "sui" Privilegierte), angewandt auf die an COP26 teilnehmenden Nationen: "Sui sein ba di Fuaterborrn, mier bei die Karrn". Romantisch? Nein! Tragisch! Denn es ist nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12. Und der Karren rattert auf den Abgrund zu und wir Erdmenschen sitzen drin. "Obr sui wellen des nou nit verstean!"
Für mutige Entscheidungen
Für mutige Entscheidungen bedarf es der Courage der öffentlichen Entscheidungeträger, der Politiker. Diese hängt, bei Demokratien, leider mit deren Wahlsystem zusammen. Würde die Wiederwählbarkeit von Politikern auf 2 aufeinander folgende Wahlperioden begrenzt, dann würden langfristig wertvolle und notwendige Entscheidungen eher umgesetzt als derzeit. Der Klimaschutz bedarf dringend mutiger Entscheidungen !