Bedingungsloses Grundeinkommen - eine kritische Analyse
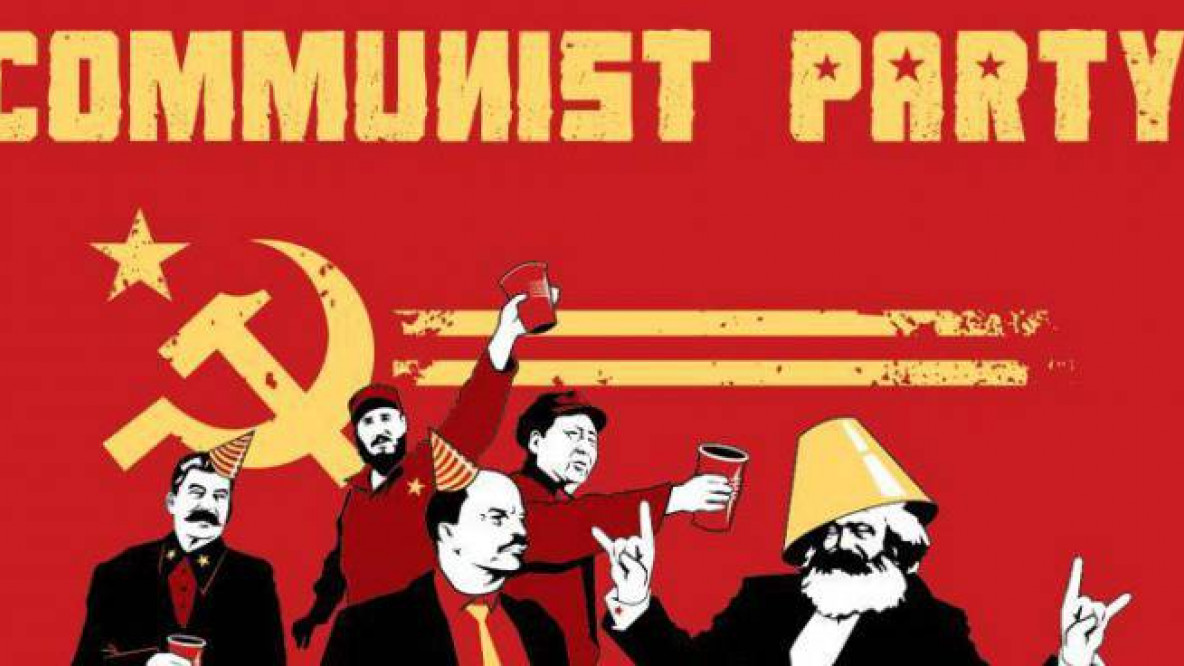
Die BGE-Befürworter haben dahin gehend Recht, dass wir aktuell ein ungerechtes (Um-)Verteilungssystem von Wohlstand haben. Das Hauptanliegen der BGEler ist es eigentlich, das ungerechte Umverteilungssystem durch ein gerechteres zu ersetzen. Umverteilung kann vieles bedeuten. Auf diesen Aspekt werde ich später noch eingehen.
Was ist ein BGE?
Salopp ausgedrückt wollen die BGEler, dass der Staat jedem Bürger im Monat einen Fixbetrag überweist, der ausreicht um „Teilhabe“ zu garantieren. Die Finanzierbarkeit wäre dabei anfangs kein Problem.
Ökonomische Aspekte:
Ich denke allerdings einen Schritt weiter und stelle mir die Frage, wie die Finanzierung nach einigen Jahren BGE ausschauen würde. Der Staat muss schließlich jedes Jahr den Betrag einheben, den er seinen Bürgern auszahlt. Also müssen wir ein Steuersystem schaffen, welches einerseits Teilhabe der BGE-Empfänger garantiert aber andererseits genug Geld in die Staatskassen spült, um diese zu füllen. Ich sprach mit einer Aktivistin, die eine wichtige Rolle bei der europaweiten Initiative für ein BGE spielt und sie sagte mir: „Die Lohnnebenkosten sinken, die Mwst. wird nicht erhöht, wir holen uns das Geld von den Reichen und mit einer Finanztransaktionssteuer.“ Ich halte solche Aussagen für naiv. Wäre es möglich, ein oben beschriebenes Besteuerungssystem zu etablieren, so bräuchte es kein BGE. Fakt ist doch, man kann nur den Wohlstand verteilen, der erarbeitet wurde. Dazu möchte ich einen kleinen Exkurs zum Thema Geld und Inflation machen:
Aus der Größe der Geldmenge und der Größe der Warenmenge ergibt sich der Geldwert. Bleibt die Warenmenge konstant, die nachfrageaktive Geldmenge dehnt sich aber aus (z.B. durch niedrige Zinsen in einem Mindestreservesystem), so steigen zwangsläufig die Preise, was den Wohlstand bei konstanter Produktion senkt, da bei fixen Gehältern weniger gekauft werden kann. Geldmenge und Warenmenge müssen also entweder beide wachsen (Wachstumswahn), um konstante Preise zu garantieren oder beide müssen konstant bleiben.
Was hat das mit BGE zu tun?
Wer seriöse Aussagen zum BGE machen will, muss diese Mechanismen bedenken. Wir können nicht einfach die Notenpresse anwerfen und uns das Geld zur Finanzierung des BGE herbeidrucken, so nach dem Motto: „Es werde Geld!“ Wenn ein BGE finanziert werden soll, so muss es durch die Früchte einer produktiven Gesellschaft erarbeitet werden.
BGE und Löhne:
Die BGEler sagen, durch ein BGE würde der Arbeitnehmer in eine bessere Verhandlungsposition gebracht, da er nicht mehr auf Lohnarbeit angewiesen ist. Folglich stiegen die Löhne (Stichwort Arbeitsleid). Im ersten Moment dachte auch ich, dass dies gut sei. Vor allem im heutigen Niedriglohnsektor würden dadurch sehr lukrative Verdienstmöglichkeiten entstehen. Doch gerade hier liegt eine der größten Schwächen des BGE: Wenn ich nun als Putzkraft oder als Müllmann mehr verdiene, wo kommt dieses Geld her? Es zahlt derjenige, der meine Dienstleistung in Anspruch nimmt, also entweder der Bürger direkt oder indirekt durch den Staat in Form von Steuern. Dasselbe gilt für den gesamten Dienstleistungssektor aber auch für produktive Gewerbe in Form von Preissteigerungen. Ich befürchte, dass wir durch ein BGE in eine Inflationsspirale gelangen und somit mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kein Auskommen mehr haben würden. Ich stellte diese Frage im Rahmen einer Informationsveranstaltung zum BGE und ich wurde lapidar mit: „Ein gerechtes Steuersystem ist wichtig.“, abgespeist. Im Zwiegespräch meinte der Referent dann, in Folge dieser Preissteigerungen müsste man eben das BGE jährlich anheben. Wohin uns die letzte Hyperinflation führte, ist hinlänglich bekannt.
BGE und Produktivität:
Befürworter des BGE glauben, die Produktivität würde steigen, da jeder nun das machen könne, das ihm gefällt. Wie schaut es aber am freien Markt aus? Dort kann sich derjenige über Wasser halten, der etwas gut macht. Gareth Bale ist ein guter Fußballer. So gut, dass Real Madrid bereit war, 100 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. Ein Bekannter von mir spielt gerne Computer. Da er aber mit PC-Spielen nicht genug Geld verdienen kann, studiert er Verfahrenstechnik und gehört zu den Besten seines Jahrgangs.
Was ich damit sagen will, ist folgendes: Es ist kein Zufall, dass man in einer Marktwirtschaft nicht immer von dem leben kann, das einem gefällt. Man kann von dem leben, das man gut kann. Wer es schafft, sein Hobby zum Beruf zu machen, hat es optimal getroffen – Gareth Bale gehört dazu. Wenn aber durch ein BGE auf einmal jeder das macht, was ihm Spaß macht, würden wir in Südtirol wohl sehr viele Berufsfußballer sowie Berufswatter haben. Studenten würden sich viel Zeit lassen, während dem Studium Kinder haben (was positiv wäre) und ob man dann mit 40 wirklich anfängt zu arbeiten, ist eine berechtigte Frage. Wenn jemand länger studiert und sich an sein Familienleben gewöhnt hat, kann er dann in den verbleibenden Jahren so produktiv sein, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben? Die Gefahr, dass relativ schnell mehr aus dem System entnommen wird, als eingezahlt wird, ist sehr groß. Sicher würden viele Menschen trotzdem in irgendeiner Form weiter arbeiten. Die Arbeit muss aber auch produktiv sein.
Ethische Aspekte:
BGEler heben sich oft auf ein Podest und glauben, ihr System sei gerechter als das aktuelle und somit zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
Im BGE-System wird es allerdings nach wie vor Nettozahler und Nettoempfänger geben. Um ein kleines Beispiel zu bringen: Stellen sie sich vor, ihr Nachbar sagt zu Ihnen: „Weißt du was, ich werde nun aufhören zu arbeiten.“ Sie werden das wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen und ihm viel Erfolg wünschen. Wenn er sie aber im nächsten Moment darum bittet, Ihnen ein Drittel oder gar die Hälfte Ihres Gehaltes abzugeben, so werden Sie ihm wohl weniger freundlich begegnen und seine Bitte ablehnen. Genau das aber fordern die BGEler. Heute haben wir einen Sozialstaat. Diejenigen, die es am nötigsten haben, werden von uns solidarisch unterstützt. Doch wie wäre es im BGE? Ich sage es ganz ehrlich, würde ich ein BGE bekommen, so würde ich neben meinen Tätigkeiten als Medizinstudent, Anatomietutor, Eishockeyspieler und Vorstandsmitglied einer Kleinpartei wohl noch weitere Studien beginnen und ein Musikinstrument lernen. Zusätzlich ein Handwerk zu erlernen stünde auch weit oben auf meiner Liste, am besten Mechaniker oder Elektriker. Sicher wäre ich dabei aktiv und würde teilweise meinen Beitrag für die Gesellschaft leisten, ich würde aber nach wie vor ein Nettoempfänger bleiben, bis ich dann irgendwann in X Jahren mein Studium abschließe. Übrigens würde auch ich dann wohl öfters watten und Fußball spielen.
BGE als ESM des Individuums:
Viele BGE-Verfechter sagen, man würde die Früchte seiner Arbeit behalten können. Das stimmt aber nicht, denn per Definition kann nur das verteilt werden, das erarbeitet wurde. Das heißt,die Nettozahler erarbeiten ihr eigenes BGE sowie die fehlenden Beträge für das BGE der Nettoempfänger. Da sie das nicht freiwillig machen, sondern durch die „Bedingungslosigkeit“ des BGE dazu gezwungen werden, könnte man das als Sklaverei bezeichnen. Sie wären mein Sklave, da sie mir bedingungslos Geld geben müssen. Hier liegt wieder ein ökonomischer Faktor versteckt:
Wenn ich also arbeite, muss mir IMMER mein BGE abgezogen werden sowie die Fehlbeträge für die Einkommen der Nettoempfänger. Ob die Steuern nun Lohnsteuer, Finanztransaktionssteuer oder Mehrwertssteuer (man gibt den Menschen Geld, das man ihnen sofort wieder abnimmt) heißen, ist egal. Ich muss mir mein eigenes BGE plus das BGE der Nettoempfänger erarbeiten. Das werden einige nicht glauben wollen, doch wenn man darüber nachdenkt, ist es logisch: Nur der erarbeitete Wohlstand kann verteilt werden. Durch ein BGE sinkt der Anreiz zu arbeiten und die Produktivität würde sinken. Dadurch haben wir wieder weniger Wohlstand zu verteilen. Nachhaltigkeitsgurus werden mich nun kritisieren, aber Wohlstand kann nur mit Produktivität einhergehen, denn man kann nur die Felle verteilen, die man bereits hat. Geld für sich ist nichts wert, womit auch ein BGE für sich nichts wert ist.
Von BGE-Kritikern kann man auch oft hören, dass der einzige Unterschied zwischen BGE und Kommunismus der Arbeitszwang sei. Sie befürchten, der Arbeitszwang würde nach einigen fetten Jahren im BGE früher oder später eingeführt werden.
Außerdem löst das nicht das Problem der staatlich garantierten Zinseinkommen der Superreichen. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Milliardär sein Geld investiert. Jedoch kann es nicht sein, dass er staatliche Garantien für seine Spekulationen bekommt. Insofern bleibt der staatliche Umverteilungsmechanismus von fleißig nach reich erhalten. Staatlich deshalb, weil die Steuerzahler durch die Banken-Rettungsmechanismen den Investoren bedinungslose Gewinne garantieren. Insofern löst ein BGE das Problem der ungerechten Umverteilung nicht.
Fazit:
Mein Ziel ist es nicht, die Hoffnungen der BGEler auf ein gerechteres System zu zerschlagen. Wir müssen aber tiefergehend diskutieren. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende: Wie können alle Menschen vom technologischen Fortschritt profitieren und was hindert uns daran, schon heute davon zu profitieren? Durch ein BGE brechen wir die Umverteilungsmechanismen nicht wirklich auf, sondern ersetzen sie nur. Wie können wir es schaffen, dass wir auch heute die Berufe ergreifen können, die uns sowohl Spaß machen als auch ein finanzielles Auskommen ermöglichen? Das sind die richtigen Fragen. Ich denke ein BGE bringt uns keine Lösung.
Abschließend möchte ich noch sinngemäß das Zitat anbringen, welches mir die Nackenhaare zu Berge stehen ließ und mich dazu animierte, diesen Artikel zu schreiben. Der Vortragende bei der BGE-Infoveranstaltung in Brixen vom 6. September 2013 sagte: „Wir wollen das BGE umsetzen, wenn man es nicht versucht, sehen wir nie, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, ist auch egal, denn schlimmer kann es nicht werden. Außerdem kann man dann im nachhinein ja noch Verbesserungen machen.“ Da muss ich ganz ehrlich sagen: Grundeinkommen, nein danke! Durch die Einführung eines BGE den Kollaps der noch vorhandenen Realwirtschaft zu riskieren, ist kein Kavaliersdelikt! Wenn sich Menschen freiwillig zusammenschließen und unter sich ein BGE-System aufbauen, befürworte ich das, aber bitte ohne mich!
Wieder einmal ein Artikel mit klugem Halbwissen
Ich weiss nicht wie gut du dich mit dem Thema befassen hast, aber dass du es schaffst dich selbst zu wiedersprechen ist wohl eher belustigend. 1. sagst du dass das bge finanzierbar sei, um dann hinzuweisen, dass dies nur durch Gelddrucken gehe.
2. du behauptest es sei naiv sich das Geld von den "Reichen" zu holen um am Ende wieder zu Moniereren: "löst das nicht das Problem der staatlich garantierten Zinseinkommen der Superreichen."
Ja sollen wir uns dann das Geld von den Reichen holen oder nicht?
3. Ist der Vergleich des ESM mit dem BGE falsch. Der ESM wird ja ausgezahlt an jene die schlecht Wirtschaften das BGE ist hingegen bedingungslos und ist keine Belohnung für schlechtes wirtschaften. Am ehesten kann man das ESM mit Sozialhilfe vergleichen
4. Auch wenn man ein gerechtes Steuersystem einführt wird deswegen das BGE noch lange nicht überflüssig. Die Arbeitsgesellschaft mit Vollbeschäftigung ist schon seit Ende der 70ziger in Krise. Es gibt nicht mehr für jeden eine Erwerbsarbeit um diese in die Gesellschaft zu integrieren. Wenn wir auch noch auf dem Wachstum verzeichten, weil er die Umwelt zerstört und am Bedarf vorbeigeht, werden die Arbeitslosenzahlen weiter steigen.
P.S. Übrigens würde mich interessieren an welcher Veranstaltung zum BGE du teilgenommen hast. Wenn sich jemand öffentlch äußerst kann man diese Personen auch namentlich nennen.
Bitte setzte dich einmal mit diesen Widersprüchen auseinander.
In reply to Wieder einmal ein Artikel mit klugem Halbwissen by gorgias
Hallo Oliver
als erstes möchte ich dir sagen, warum ich glaube dass du dich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie kann man sonst, wenn man von einer Sache überzeugt ist und gute Argumente dafür gehört hat, sich von dieser Meinung wieder entfernen weil man schlechte Argumente gehört hat. Die schlechten Widerlegen doch nicht die guten oder?
1. Es ist unsinng davon zu reden etwas als "finanzierbar" zu bezeichnen das längerfristig finanziert werden muss, was jetzt hypothetisch nur ein Jahr gehen soll.
2. Tut mir leid wenn du schon so früh aufgibst, das ist ein grundlegendes Problem das gelöst werden muss, das aber auch lösbar ist. So gab es in den Vereinigten Staaten bis Ende der 70ziger Jahre einen Spitzensteuersatz von über 70%. In den skandinavischen Ländern sind die Steuersätze auch höher. Stiftungen können höhere Auflagen unterliegen und nicht mehr so leicht zur Steuervermeidung Zweckentfremdet werden. Es gibt sogar die Möglichkeit eine umlaufgesicherte Währung einzurichten, diese wird kaum längerfristig im Ausland verweilen.
Auch ist es ein Scheinargument zu sagen, weil man sich zuerst einigen muss ab wann jemand "reich" ist, dass man die Steuern deswegen nicht erhöhen kann. Mann kann einfach die Progression kontinuierlich steigern, was ja sowieso eine elegantere Lösung wäre. Außerdem lassen sich die Zinseinkommen, wie du ja weiter unten monierst am besten durch eine umlaufgesicherte Währung vermindern.
3. Was willst du bitte mit alternativlos sagen? Ich finde das ist ein schiefer Vergleich. Steuern sind auch alternativlos, dann müsstest du Steuern mit dem ESM vergleichen. Das BGE und der ESM haben miteinander nichts gemein. Beim ESM besteht die Gefahr eines Moral Hazard beim BGE nicht. Der weisentliche Unterschied liegt in der Motivation. Um das BGE zu erhalten muss ich nichts tun (z.B. mich als arbeitsunfähig hinzustellen oder unfähig sein meine Schulden zu bezahlen) bei dem ESM muss ein Staat als quasi zahlungsunfähig erscheinen damit er bezuschusst wird. Das ist der entscheidende Unterschied, ich weiss eigentlich nicht warum du auch noch den ESM in dieses Thema hineinpacken musst?
4. Das Problem das eine Arbeitsgesellschaft Vollbeschäftigung, weil sie Personen durch erwerbsarbeit integriert ist eines der Hauptprobleme die mit dem BGE gelöst werden sollen. Dass du dich als Interessierter zum Thema mit diesem Zusammenhang noch nicht Konfrontierts wurdest, wundert mich. Dass bei fehlendem Wirtschaftswachstum die Arbeitslosenzahlen steigen, ist wohl wirklich nichts neues und dass wir seit 30 Jahren in Europa dauernd über Arbeitslosigkeit gesprochen wird ist wohl für dich auch neu? Natürlich ist Vollbeschäftigung keine Utopie, wir brauchen nur die ganzen Maschienen abschaffen die die Produktivität steigern, dann können wir die Wiesen ausschließlich mit der Sense mähen, dann gibt es wieder arbeit genug.
zu P.S. Du bist ja wirklich nobel wenn du nicht bereit bist jemand zu nennen der in der Öffentlichkeit einen Vortrag haltet. Das gehört wohl zum Thema political correctness verhindert kritisches Denken. Da ich bis jetzt zu diesem Datun kein Thema in Richtung BGE gefunden habe werde ich jetzt wohl anfangen müssen nach Esoterik-Scheiss zu googlen. Ich überlegs mir noch ob ich dazu lust habe.
zu a.d.
Ich bin noch nicht restlos überzeugt, finde aber dass ausgerechnet die Punkte die von anderen kritisiert werden schon gelöst wurden. So ist die Finanzierung möglich. Auch die frage der Motivation und der Leistungsgerechtigkeit ist für mich auch gelöst. Außerdem ärgert es mich, wenn jemand der in der Oberschule nicht einmal Volkswirtschaft hatte solche Themen verschludert.
In reply to Wieder einmal ein Artikel mit klugem Halbwissen by gorgias
Antwort
>Die meisten deiner Argumente sind in meinen Augen Desinformationsargumente, da sie von der eigentlichen Thematik ablenken.<
Tut mir leid, dass du für wichtige Zusammenhänge nicht offen bist.
>Dass ein BGE die Produktivität senkt und somit langfristig nicht finanzierbar ist, muss erst widerlegt werden.<
Sozialempirisch ist leider noch wenig belegt, es gibt ein Versuch . Es gibt aber genug Anzeichen die einem Menschenbild widersprechen der davon ausgeht, dass der Mensch nur noch herumliegt wenn er nicht zum arbeiten gezwungen wird.
Es gab ein Versuch in Afrika der in diesem Buch beschrieben wurde, daraus haben viele Eigeninitiative gezeigt:"Ausstieg aus der Arbeit - warum? /Addio società del lavoro?: Wie das Grundeinkommen die Welt verändern kann - Deutsch-italienische Ausgabe /Come il ... cambiare il mondo - Edizione italiana tedesca"
Das BGE befreit und stimuliert Eigeninitiative. Arbeitslosengeld lähmt. Außerdem macht heutzutage die Arbeitswelt viele krank durch den ganzen druck. Durch das BGE würde sich dieser Lösen. Unangenehme Arbeiten würden weiter ausgeführt. Diese würden aber dementsprechend besser bezahlt werden und es würde nicht ausgenutzt dass diese keine Ausbildung Voraussetzen und man deswegen Menschen leichter ausnutzen kann.
>Ist es gerecht, wenn die produktiven Menschen für die unproduktiven Menschen zahlen? Es ist ein großer Unterschied, ob ich einem Bedürftigen ein Auskommen bzw. die Überbrückung einer schwierigen Lebenszeit finanziere oder ob ich einem Menschen ein 20 Jahre andauerndes Studium bezahle, oder etwa nicht? <
Wenn es das BGE gibt, dann wird es keine Gratis-Studium mehr geben. Wer Studiert und nur das BGE als Einkommen hat der wird dies sicher kaum 20 Jahre machen weil es auch mit Entbehrungen verbunden ist.
Das ist eben das tolle beim BGE, weil dort sich jeder genau überlegt für was er sein fixes Geld ausgibt, anstatt überall staatliche Leistungen anzunehmen die ihn nur am Rande interessieren. So z.B. gibt es in Deutschland überteurerte heruntergekommene Harz-IV Wohnungen, weil Menschen nicht direkt Ihre Miete zahlen, sondern diese vom Sozialamt bezahlt wird. Der Mieter hat dann keinen Ansporn sich eine billigere Wohnung zu suchen und der Vermieter nutzt das gleich aus und Verlangt mehr, weil er weiss dass es dem Mieter direkt nicht trifft.
Ich habe mal in Frontal 21 eine Person gesehen die trotz Invalidität und Frühberentnerung sich noch halbtags etwas dazu verdienen wollte und dann die Zuverdienstsgrenze überschritten hatte und für ein Jahr keine Rente mehr bekam.
In Deutschland bekommen Menschen mit der Erbkrankheit Mukovizidose eine Rente, dürfen aber nicht mehr Arbeiten gehen. Manche tun dies schwarz. Würden Sie ein BGE bekommen würden sie ein normales Arbeitsverhältnis anstreben könnnen.
In Deutschland gab es eine alleinerziehende Mutter, die Harz-IV bekommt und eine Ausbildung anfangen möchte, dies aber nicht tun kann, weil sie dann nicht mehr als Arbeitslos gilt sondern als Studentin und deswegen die Ausbildung nicht anfangen kann.
Es gibt heutzutage schon assoziale die nicht arbeiten wollen und sozialhilfe bekommen und immer eine Ausrede haben warum sie nicht eine Arbeit haben. Diese wird es immer geben mit und ohne BGE, deswegen aber auf alle anderen zu schließen ist falsch. Wie schon gesagt es gibt noch keine empirischen Beweise, viele werden aber weiterhin noch arbeiten, weil sie nicht mit dem BGE als einkommen zufrieden sein werden.
Wenns dich wirklich interessiert, dann würde ich dir mal diesen Film empfehlen:
http://www.youtube.com/watch?v=ExRs75isitw
Lieber Oliver,
ich find’s sehr schade, dass dein Text so schnell „aus dem Sichtfeld“ da ganz vorne gerückt ist – gerade auch durch deine Konversation mit gorgias hat sie maximal gewonnen, finde ich. Ich glaube nämlich, genau das ist es, was wir in der Sache dieser und anderer, großer Gesellschaftsthemen brauchen: Konstruktive Rede und Widerrede, und es müssen wahrhaftig nicht alle Diskussionen und Diskutanten Volkswirtschaft studiert haben – wichtig ist, dass darüber gesprochen und darüber nachgedacht wird, und zwar von und in der Bevölkerung. Denn jede Meinung und jeder Gedanke hat seine Berechtigung und seine Relevanz. Was ich persönlich noch anmerken möchte: „Hartz IV verbessern“ ändert doch nichts daran, dass vermutlich ein sehr großer Teil der Empfänger auch eines verbesserten H4 oder was auch immer stets als „Verlierer“ und als minderwertig empfinden würden?! Wenn hingegen jemand sich mit BGE bescheiden will (in der CH werden ja aber Summen genannt, da ist von "bescheiden" keine Rede, DA sehe ich eher schwarz...), dann ist das ihre freie Entscheidung. “BGE in den Sozialsystemen austesten“ ändert vielleicht die Vorgehensweise, nicht aber das Prinzip der „Stütze“-Empfänger gegenüber denen, die nichts „empfangen“. Bei BGE sind m. E. alle „Empfänger“, und somit niemand. Das ist das große Potential der Idee, finde ich. Nicht zuletzt: Meines Wissens ruhen alle großen Ideen auf dem Fundament eines Traums. Es gibt kein Allheilmittel für alle Probleme, das solltest du als angehender Arzt wissen, oder?! Das heißt aber doch nicht, dass du ein Heilmittel, welches das Potential hat, sehr viele Übel zu heilen, nicht verabreichst, bloß, weil es da noch ein paar andere Probleme gibt… Und ja, manchmal muss man tatsächlich einfach „tun“, eventuelle Risiken in Kauf nehmen, solange wie man die vorher sorgfältig er- und abgewogen hat. Überdies haben wir ja meist gar keine Vergleichsmöglichkeit, wie’s gelaufen wäre, wenn wir anders gehandelt hätten – ich zumal hatte mich schon mal gefragt, warum wir Südtirol das BGE nicht einfach austesten. Das Potential hätten wir doch, oder?!
In reply to Lieber Oliver, by Sylvia Rier
@Hopfgartner
Ich finde es naiv die Anzahl der Personen, die sich an einer Testphase beteiligen würden als Indikator für die Akzeptanz der Idee zu nehmen. Es würde einen Ansturm sondergleichen. Wer schlagt den schon Geld ab?
Das beste wäre man nimmt ein bestimmtes Einzugsgebiet und Menschen die an einem bestimmten Stichtag in diesem Gebiet ihren Wohnort haben, würden dann das BGE erhalten.
Strukturschwache Gebiete
Da fällt mir ein: Im Sinne eines "bestimmten Einzugsgebietes" zum "Austesten" des BGE: Wie wär's denn eigentlich mit einem unserer sog. "strukturschwachen" Gebiete?! Statt immer nur und überall die "Patentrezepte" à la Tourismus?! Könnte doch mal eine interessante Alternative sein, oder?!
Sicht eines Laien
Lieber Oliver, du weißt, dass viele in der Partei für die ich kandidiere, sehr stark für das BGE werben und dass ich im Gegensatz dazu noch sehr skeptisch bin. Ich danke dir für deine kritischen Anmerkungen (und auch gorgias für seine Widerworte). Zeigen sie doch, dass bei weitem nicht so viel klar ist wie man oft gerne hätte.
Und das ist für mich das Entscheidende. Wenn ich so manche absolute politische Slogans höre über das Thema, stellt es mir die Haare zu Berge. Es gibt noch so viele ungeklärte Fragen in diesem Zusammenhang, so viele kontroverse Standpunkte, dass ich es für arrogant halte, ausgehend von einem absoluten JA oder absoluten NEIN zu argumentieren.
Was ich hingegen sehr gut finde ist, dass von den Befürwortern eines BGE zurzeit versucht wird 1.000.000 Unterschriften zu sammeln (europäische Bürgerinitiative) um die europäische Kommission dazu zu bringen, das Thema anhand von Studien, Pilotprojekten usw zu untersuchen. Da wird noch gar nichts einfach probiert oder fahrlässig eingeführt. Aber es setzen sich kompetente Personen damit auseinander um Antworten auf die berechtigten Fragen zu finden. Das muss der Weg sein. Oder um es mit H. Knoflach's Worten zu sagen: ergebnissoffen sollten wir diskutieren.
Diesen Weg unterstütze ich, warne aber davor nur auf ein positives Endergebnis zu hoffen. Genauso wie ein BBT als Heilmittel irgendwann verkauft werden kann, kann ich auch ein BGE als Heilmittel irgendwann verkaufen. Wir brauchen jetzt Lösungen, für die Krisenspirale in der wir stecken. Neue Wirtschaftsmodelle wie die Gemeinwohlökonmie (aber nicht nur die) sind bereits vorhanden, sind zu einem hohen Prozentsatz praxistauglich und könnten sehr schnell angewandt werden.
Ich weiß, die Postwachstumstheoretiker sagen das bringt alles nix, weil das nicht die Wurzel des Problems löst. Ich weiß, die Geldtheoretiker sagen das bringt alles nix, weil das nicht die Wurzel des Problems löst. Ich weiß, alle Fundis sagen das bringt alles nix, weil das nicht die Wurzel des Problems löst.
Ich aber sage euch, das Grundproblem ist viel zu komplex um einfach zu lösen. Wir brauchen zuerst den Spatz in der Hand, einige Male, um in die richtige Richtung zu gehen. Dann erreichen wir hoffentlich irgendwann die Taube auf dem Dach. Oder um es mit Gorbatschow zu sagen: „Es gibt keine einfachen Lösungen für sehr komplizierte Probleme. Man muß den Faden geduldig entwirren, damit er nicht reißt.“
In reply to Sicht eines Laien by Klaus Egger
@Oliver
Ich bin nicht wirklich der grosse Kenner auf diesem Gebiet, aber wenn du sagst, dass es nicht funktionieren kann, frage ich dich wie lange das aktuelle System noch funktionieren kann?? Wie lange gibt es noch den Sozialstaat? Wie lange noch werden Menschen hart arbeiten gehen, mit einem Lohn, der kaum zum überleben reicht, bevor sie rebellieren?
Wie lange haben unsere Kinder in diesem System noch eine Zukunft?? Wie lange können die Staaten im Euroraum noch überleben, mit wieviel Billionen Schulden, bevor alles implodiert??