»Unser Städtchen liegt …« (Teil 2)
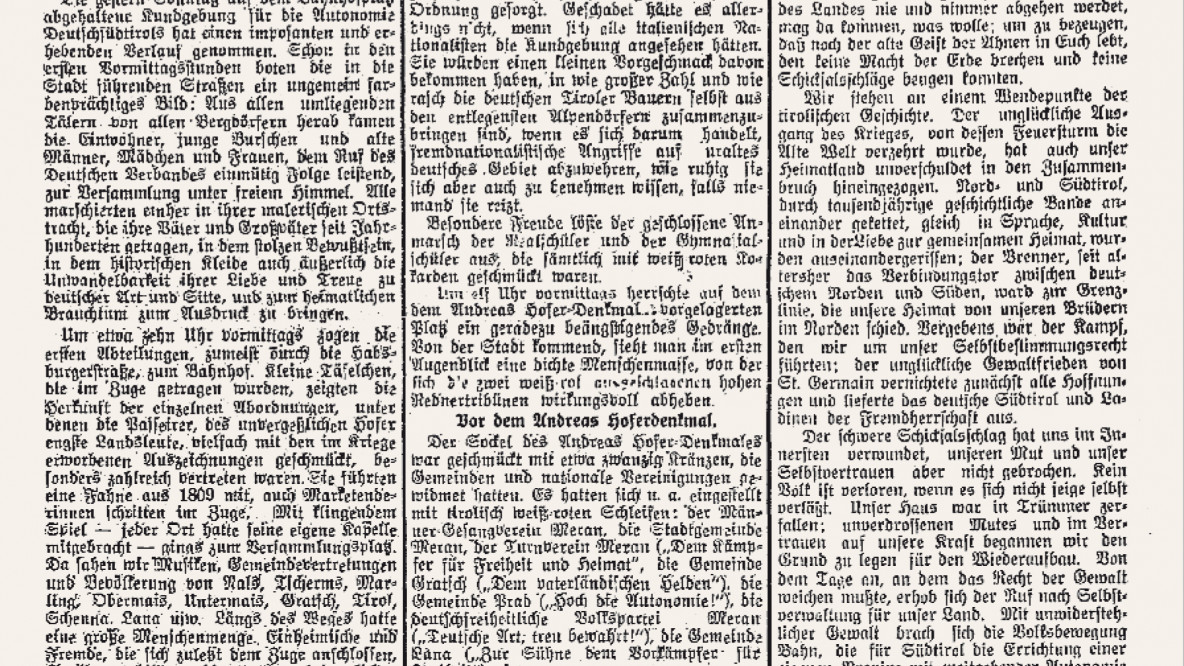
Rund um 1920 – ein Übergang, eine Verwandlung?
Der historische Augenblick, in den der bahnreisende Prager Beamte am 3. April 1920 unvermittelt geriet, machte ihn ungeplant zu dessen absichtslosem Zuschauer, mit Carlo Ginzburg zu einem überzeitlichen Zeugen, einem testis, der zwar nur über verklausulierte Umwege zu uns spricht, aber doch intensiv kommuniziert, wenn wir ihn befragen. Mehrere Begegnungsebenen Kafka–Südtirol lassen sich hier, in hypothetischer und erkenntnisleitender Absicht, postulieren. Es ist der besondere historische Moment des Südtiroler Schwellenjahres, sodann der Kurort als eigener Soziotop und schließlich die Frage nach dem etwaigen literarischen Reflex dieses Momentums in Kafkas Werk.
Der regionale Epochenbruch ist gekennzeichnet von einer Teilungsgeschichte, vom posttraumatischen Doppelstress der Kriegsniederlage und vom Verlust der alten, jahrhundertelang eingeübten Ordnungen.
Zu der ersten Dimension dieses Abgleichversuchs: Kafkas Kuraufenthalt fällt in die politisch hochbrisante Phase, die mit der am 10. September 1919 von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs beschlossenen Annexion des südlichen Tirol in den italienischen Staatsverband schrittweise vollzogen wurde. Der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye regelte die Auflösung der ehemaligen österreichischen Reichshälfte. Er besiegelte das Ende des – in den Begriffen der k.u.k. Bürokratie gesprochen – cisleithanischen Teils der früheren österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Der Showdown der alliierten Signatarmächte USA, Großbritannien, Frankreich und Italien mit der von Karl Renner angeführten österreichischen Delegation in der Schlossanlage westlich von Paris veränderte nicht nur nachhaltig die geopolitische Landschaft Mitteleuropas, sondern baute auch die Lebenswelt Franz Kafkas um, der sich im neuen republikanischen Nationalstaat Tschechoslowakei wiederfand. Aber die staatspolitische tektonische Plattenverschiebung betraf ebenso das Tirol südlich des plötzlich zur Grenzscheide gewordenen Brennerpasses: Im Londoner Geheimvertrag von 1915 noch als »cisalpines Tirol« bezeichnet, zog der Zusammenbruch der Mittelmächte 1918/19 auch die Zellteilung des früheren Kronlandes Tirol-Vorarlberg nach sich und leitete die Früh- und Sturzgeburt der neuen Entität »Südtirol« ein. Die formalrechtliche Integration des zentral- und südalpinen Territoriums in das Königreich Italien erfolgte schließlich am 10. Oktober 1920, nachdem die Republik Deutschösterreich bereits am 21. Juli desselben Jahres, einen Monat nach Kafkas Abreise aus Meran, die 381 Artikel des Vertrags von Saint-Germain im Staatsgesetzblatt publiziert hatte.
Franz Kafkas Meraner Aufenthalt vom April bis zum Juni 1920 fiel also punktgenau in die Transitions- und Formationsphase der neuen Südtiroler Region. Der regionale Epochenbruch ist gekennzeichnet von einer Teilungsgeschichte, vom posttraumatischen Doppelstress der Kriegsniederlage und vom Verlust der alten, jahrhundertelang eingeübten Ordnungen. Ebenso ist diese historische Zwischenphase bestimmt von den – wiewohl dürftigen – Chancen der erzwungenen Neuerfindung und des Heraustretens aus dem »Schatten des Krieges«, des soeben hinter sich gelassenen, aber nicht bewältigten ressourcen- und zivilisationsvernichtenden Mordens und Darbens. Diese Periode maximaler Ungewissheit trägt damit auch transformatorischen Charakter – sie führt von sich aus auf die Kafka’sche Chiffre der Nacht, einer dunklen Zeitlichkeit, und sie lässt sich in kulturhermeneutischen Begriffen mit der von Heiner Mühlmann entworfenen Theorie der Nachkriegszeiten und ihrer verschobenen, unebenen Bewältigungsstrategien von maximaler Stresserfahrung fassen.
Im Meraner Andreas-Hofer-Denkmal bricht sich der falsche Mythos eines überzeitlichen Tirol Bahn.
Als verlässlicher Indikator für die verqueren regionalen Strategien der Bewältigung von gesellschaftspolitischem Untergang und Neubeginn kann die Einweihung des mächtigen Andreas-Hofer-Denkmals gelten. Der höchst performative Vorgang nahm am Meraner Bahnhofsvorplatz Gestalt an, just am 3. April 1920, dem Tag von Kafkas Ankunft mit dem Zug (so dass man sich die Frage stellen kann, auf welche Weise er davon Notiz genommen hat), und die Aktion verrät viel über das prekäre Verhältnis von öffentlichem Gedächtnis und regionaler Geschichtskultur. Die entscheidenden Stichworte hierzu verdanken wir der kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie von Maurice Halbwachs und Pierre Nora und ihren Begrifflichkeiten. Geschichte wird hier, im Sinne des eingangs geäußerten Postulats der Umkehrung von Ereignis und Text, zum allgemeinen Protokoll – oder zumindest zur Textur im öffentlichen Raum, in dessen Körper beinahe ostentativ soziale Bedeutungen eingeschrieben werden sollen. Die Hofer-Statue des aus Meran gebürtigen, vor allem durch seine Plastiken für die Wiener Ringstraßenbauten bekannten Bildhauers Emanuel Pendl war zwar im Wesentlichen bereits 1914 errichtet und für den Ersten Weltkrieg funktionalisiert worden, aber kriegsbedingt über Jahre nur notdürftig mit Brettern verschalt geblieben. Das nunmehr offiziell eingeweihte Artefakt bedient den Mythos des solitären, aber charismatischen Volksführers, dessen historisch entscheidende Aktion eingebettet sei in die metaphysischen Ordnungssysteme von »Gott, Kaiser und Vaterland«, wie die Pathosformel am Sockel des Monuments verkündet. Dieser Hofer, aller seiner subversiven Anteile entkleidet, ist weitgehend losgelöst von seinen historischen Kontexten, die realhistorisch einen Vorgang des großen Scheiterns darstellen und deren Meraner Denkmalerzählung einer entschieden außengelenkten, dem geschichtlichen Material übergestülpten Konstruktion verpflichtet ist. Im Denkmal bricht sich der falsche Mythos eines überzeitlichen Tirol Bahn, und der historische Moment seiner Enthüllung am 3. April 1920 hätte zugleich passender (im Sinne der Informationen, die der Vorgang preisgibt) und unglücklicher (weil vollkommen anachronistisch) nicht gewählt werden können. Die emphatische Einweihung mit ihrer Betonung von Regionalität und »Freiheitskampf« war freilich auf die unglückliche politische Gegenwart gemünzt, die ihr innewohnende Provokation durchaus beabsichtigt.
Der gebaute Widerspruch der Hoferstatue stand im scharfen Kontrast zu den realhistorischen Vorgängen. Die Zeit der italienischen Militärverwaltung Südtirols unter Führung des umsichtigen und zurückhaltenden Generals Guglielmo Pecori Giraldi war im Sommer 1919 in eine reguläre Zivilverwaltung, unter der Leitung des zögerlichen, aber hochgebildeten und dem deutschen Kulturraum gegenüber aufgeschlossene Zivilkommissärs Luigi Credaro als oberster ziviler Autorität, überführt worden. Immerhin gingen damit die drakonischen Maßnahmen der militärischen Administration zu Ende, unter anderem endete die kategorische Absperrung der Grenze am Brenner. Doch keinerlei Zweifel konnten nunmehr über die dauerhafte Zugehörigkeit des südlichen Tiroler Landesteils zum italienischen Staatsverband bestehen. Auch die ehemaligen Zeugnisse des kollabierten Habsburgerreichs wurden nach und nach entsorgt. Symbolpolitik fand hier ihr bevorzugtes Terrain vor – der Prozess der Enthabsburgisierung und Entaustrifizierung schritt auch in Meran hurtig voran und markierte entscheidende Etappen allgemeiner Desillusionierung, wie den teils heftigen Reaktionen der noch ausschließlich deutschsprachigen Tagespresse zu entnehmen ist. So musste etwa am 11. April 1919 der schwarze Doppeladler am Meraner Hauptsteueramt weichen – die Meraner Zeitung kommentierte dies mit den unfreiwillig Musil’schen Worten, wonach hier »ein bekanntes Wahrzeichen vergangenen Bürokratismus der einstigen schönen Doppelmonarchie« verschwunden sei. Auf das noch mit Brettern verhüllte Hoferdenkmal wurde im November 1919 sogar ein, freilich missglückter, Brandanschlag – mutmaßlich durch italienische Militärangehörige – verübt, die altösterreichischen Briefkästen in Meran wurden zur selben Zeit übermalt. In der Nacht vom 26. auf den 27. April 1920, Kafka wohnte in der Pension Ottoburg, wurde auf den Unterbau des Denkmals ein »Evviva Italia« samt dem Grün-Weiß-Rot der Trikolore aufgemalt – der Erinnerungskrieg mit seinen identitären und gegenidentitären Aufwallungen war mitten in Meran angekommen. Dies geschah zu einer Zeit, als Autonomieverhandlungen mit der römischen Zentralregierung unter Ministerpräsident Francesco Saverio Nitti mühsam in Gang gekommen waren, aber immer wieder entweder an den römischen Blockaden oder der nationalen Unnachgiebigkeit der im Deutschen Verband zusammengeschlossenen politischen Eliten Südtirols scheiterten.
Die Zwischenphase 1918–1922, die Zeit nach dem Zusammenbruch der Mittelmächte, von Versailles und vor dem »Marsch auf Rom«, offenbarte die Konzeptlosigkeit und konfliktuelle Verhärtung beider Seiten und ihrer Akteure.
Nach der Demissionierung Nittis im Juni 1920 verschärfte sich die nationale Tonlage mit der Ernennung Giovanni Giolittis zum neuen Ministerpräsidenten. Die Zentralregierung reagierte auf die zunehmende faschistische Agitation in Italien auch in der deutschsprachigen Grenzprovinz mit für die Minderheitenanliegen zunehmend ungünstigeren und tendenziell antiautonomistischen Positionen. Die Zwischenphase der vier Jahre 1918–1922, die Zeit nach dem Zusammenbruch der Mittelmächte und von Versailles und vor dem »Marsch auf Rom«, offenbarte immer deutlicher die Konzeptlosigkeit und konfliktuelle Verhärtung beider Seiten und ihrer Akteure: Das Quadriennium im Vorfeld der faschistischen Machtübernahme im Oktober 1922 lässt sich zwar als krisenhaft-liberale Zwischenphase begreifen, doch gewannen spätestens mit der Ratifizierung des Annexionsdekrets am 9. August 1919 durch das italienische Parlament die Hardliner beider Seiten immer stärker Auftrieb. Dabei muss freilich eingeräumt werden, dass angesichts der schwachen Verhandlungsposition Südtirols, dessen Forderungen auf keinerlei international verbindliche Schutzmechanismen rekurrieren konnten, eine grundsätzliche Asymmetrie der Machtverhältnisse zwischen Grenzregion und Nationalstaat bestand. In einem solchen tendenziellen Zielkonflikt – Einheit und Uniformität des jungen Nationalstaats vs. Autonomie seiner Minderheiten – entfalteten Patriotismen und Nationalismen rasch all ihr destruktives Potenzial. Mit Ronald Inglehart sind – innerhalb einer Soziologie der Emotionen – beide Phänomene ohnehin nicht klar zu unterscheiden, sodass sich die Annahme eines »gesunden« als eines noch hinnehmbaren oder gar positiven Patriotismus verbietet. Als Handlungsmuster einer gesellschaftlichen Emotionskultur der Jahre »dazwischen«, als deren model of agency, boten sich die konträren und sich gegenseitig ausschließenden nationalen Verhärtungen geradezu an. Sie bildeten das Korsett sozialer Identitätskonstruktionen und wurden wesentlich über sprachliche Markierungen hergestellt. Dem italienischen Nationalismus und seinen Dominanzansprüchen, auf die Spitze getrieben in der Figur des ultranationalistischen Senators Ettore Tolomei, setzte sich deutsch-tirolischer Patriotismus entgegen, in einer Spirale von langer Dauer, in der Fremd- und Selbstzwänge sich gegenseitig verstärkten und überlagerten und zu einer dauerhaften Ethnisierung von Politik, zur Schaffung eines essenzialistisch veranlagten, eindimensionalen homo ethnicus führten. Rein administrative Vorgänge konnten so rasch zu ethnopolitischen Pulverfässern werden. Das wird etwa an der Causa Gemaßmer deutlich. Als Merans seit 1914 amtierender Bürgermeister Josef Gemaßmer wegen angeblichen Betrugs im Juni 1919 von den italienischen Behörden verhaftet wurde, übernahm sein Stellvertreter, der Augenarzt Karl Bär, die Amtsgeschäfte. Die Vorgänge rund um Gemaßmer, dem man Unterschlagung im Amt vorwarf, wurden nie richtig aufgeklärt, was nationalen Verschwörungstheorien Tür und Tor öffnete. Im November 1920 zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt, kehrte Gemaßmer nicht mehr in sein früheres Amt zurück. Der Stadtregierung stand weiterhin Bär geschäftsführend vor, ehe er im Februar 1922 von Max Markart abgelöst wurde.
Patriotismen und Nationalismen sind voneinander nicht klar zu unterscheiden, sodass sich die Annahme eines »gesunden« als eines noch hinnehmbaren oder gar positiven Patriotismus verbietet.
Absolut hemmend auf jegliche demokratisch-subsidiäre Eigenentwicklung Südtirols wirkte sich auch die enge administrativ-politische Klammer mit dem Trentino im Rahmen des revanchistisch eingefärbten Regionalkonstrukts der Venezia Tridentina aus. 1919 als Verwaltungseinheit der Militärverwaltung geschaffen, aber erst 1921 formaljuridisch als Einheitsregion abgesichert, schuf die Zwangsehe der späteren Provinz Bozen mit der Provinz Trient (der zudem das teilweise gemischtsprachige Bozner Unterland angegliedert wurde) ein ebenso ungeliebtes wie verteufeltes Junktim und befeuerte als zähmendes und disziplinierendes Element die nationale Frustration nachhaltig. Besonders verhasst war den deutschsprachigen Eliten und ihrer Presse die numerische Unterlegenheit gegenüber der italienischsprachigen regionalen Bevölkerung, die der Zusammenschluss mit sich brachte. Die Missachtung der Wilson’schen Prinzipien bei der Annexion an Italien (namentlich des Punktes 9 des Vierzehn-Punkte-Katalogs, wonach das readjustment von Italiens Grenzen entlang klar erkennbarer nationaler Grenzen hätte erfolgen sollen) schien nun nochmals gesteigert. Ähnliche Entfremdungserfahrungen schlugen auch im slowenisch-kroatisch-italienischen Grenzbereich Friaul-Julisch Venetien durch, hier intensiviert durch eine von Beginn an aggressive antislawische Grundstimmung und Gewaltbereitschaft, wie die Niederbrennung des Narodni dom, des slowenischen Volkshauses und Kulturzentrums in Triest, am 13. Juli 1920 durch faschistische Squadristen verdeutlicht.
»Unter freiem Himmel« – Kollektive Autonomie und ein Zuschauer
Sprachliche Minderheiten waren im Nationalstaat Italien einem steigenden kulturellen und ethnischen Homogenisierungsdruck ausgesetzt, der im Umbruch zum Faschismus dauerhaft Gestalt gewinnen sollte. Dies war freilich kein Einzelschicksal im Europa der Zwischenkriegszeit, das allenthalben vor ungelösten Minderheitenproblematiken strotzte. Trotz der Begründung des zwischenstaatlichen Völkerbundes in Genf in der Nachfolge der Friedensverhandlungen von 1919/20 stellte die systematische Missachtung von Minoritätenrechten einen der Treibsätze dar, die den Aufstieg autoritärer und totalitärer Bewegungen förderten – sie unterdrückten die eigenen Minderheiten und funktionalisierten Bevölkerungsgruppen des Auslandes für die eigenen nationalistischen Ziele. Der Bewusstseinsbildungsprozess innerhalb von sprachlich-kulturellen Minderheiten in der frühen Zwischenkriegszeit war zumeist durchsetzt von Abwehrhaltungen und gruppeninternem Uniformitätsdruck. Dem Majorisierungs- und Entnationalisierungsdruck, dem die Nachkriegsminoritäten seitens nationaler Mehrheiten ausgesetzt waren, entsprachen rasch die ethnozentrische Verhärtung der Minderheiten selbst und der damit einhergehende Verlust interkultureller Verständigung und Bereicherung.
Ein »Los von Trient« wurde zum ersten Mal auf der Meraner Autonomiekundgebung vom 9. Mai 1920 lanciert – anwesend war vermutlich auch Kafka.
So auch in Südtirol, das sich nach Kriegsniederlage und Abtrennungserfahrung – zumindest in der Perspektive von deutsch- und ladinischsprachiger Landesbevölkerung – zunächst um ein geeignetes, identitäres Narrativ bemühen musste und sich gewissermaßen kollektiv neu zu erfinden hatte. Ein relativ verlässlicher Indikator für die Suche nach einer solchen neuen nationalen Sinngebung ist die Meraner Autonomiekundgebung vom 9. Mai 1920. Nach der Hypothese von Reiner Stach war Franz Kafka auf der Großveranstaltung anwesend, er glaubt dessen hagere Gesichtszüge auf einer Großaufnahme vom Event erkennen zu können.
Setzen wir diese Realpräsenz als schieres Faktum voraus oder gehen wir einfach von Kafkas gleichsam ontologischer Anwesenheit im Sinne einer mehrdimensionalen Raumzeit aus – das Ereignis musste er wahrgenommen haben, entweder direkt oder in der ausgiebig hierzu berichtenden Presse bzw. als frei schwebendes Gesprächsthema. Sollte er aber auch an der Autonomierallye nicht unmittelbar teilgenommen haben, so war spätestens mit dem 9. Mai klar, dass er nicht bloß in einer beschaulich-provinziellen Kurstadt weilte. Man könnte mit David Clay Large formulieren, dass gerade der Kurort mit dem für ihn konstitutiven Oppositionspaar Gesundheit/Krankheit ein besonderer Schnitt- und Kreuzungspunkt von individueller Heilung und politischem Fieber, von Politik und Intrige, von Kommunikation im Zeichen von »Krieg und Frieden« war.
1920 wies Meran mit knapp 15.000 Einwohnern nicht ganz die Hälfte der Bevölkerung der späteren Provinzhauptstadt Bozen auf, doch dieser gegenüber war die alte Landeshauptstadt der früheren Grafschaft mehrfach ausgezeichnet: einmal durch die Nähe zu der dem Land seinen Namen gebenden Burg Tirol (die Kafka besuchen würde), durch das besondere Fluidum der Heil- und Kurbadstimmung und vor allem durch die ab 1920 wieder langsam einsetzende Internationalität der Gästeströme. Die schon zitierte Fremdenliste, auf der Kafkas Ankunft vermerkt war, hatte ebenso die Anreise des Zivilkommissärs Luigi Credaro und seiner Ehefrau gemeldet: Beide teilten offenbar, wenn auch für kürzeste Zeit, das Grand Hotel Emma. Der »objektive Zufall« der abwesenden Anwesenheit Kafkas wiederholte sich auf der Autonomieversammlung. Wenn wir solche Präsenzen chaostheoretisch bestimmen wollen, so handelt es sich um nicht reduzierbare Ereignisse; sie sind fundamental unbestimmt und dürfen also nicht rationalisierend als zweckgerichtete Handlungen gedeutet oder gar positiv verwendet werden.
Dennoch ermöglicht uns das Kafka’sche Zufallsereignis, ein Ereignis, »das also nirgends als Glied einer Kette auftritt« (Philipp Frank), wertvolle Einblicke in den schwer bestimmbaren Geist der Zeit. Die Meraner Versammlung steht für einen Aufbruch ins Ungewisse, sie fand statt nach dem Inferno des zu Ende gegangenen globalen Kriegs und vor dem Hintergrund einer noch ungewissen, wenngleich weitgehend festgelegten staatlichen Zukunft. Im Raum standen die teilweise noch ungelösten Währungs- und Staatsbürgerschaftsfragen, der Annahme der italienischen Bürgerrechte oder der Abwanderung in die junge Republik Österreich, der sich etwa zahlreiche, rasch arbeitslos gewordene Staatsbeamte unterzogen. Es ging also um die Erfahrungen der Menschen, ihre Hoffnungen, aber vor allem Ängste, die natürlich zentral auf das gute Überleben in der prekären Nachkriegsordnung gerichtet waren. Die aus Südtiroler Sicht erlittene doppelte Niederlage (militärisch im Krieg und ordnungspolitisch mit dem Wegfall des Herkunftslandes) trat hierbei in den Hintergrund – sie war einer passiven Schutz- und Schockstarre gewichen, einem Schwebezustand von nationaler Depression und einsetzender Wagenburgmentalität. Als öffentliches Event markiert die Meraner Versammlung daher einen wichtigen Wendepunkt für das neue kollektive Setting Südtirols: Die autonomiepolitischen Gehversuche dokumentieren die Absicht, von passiven Zuschauern des historischen Prozesses zu dessen selbstbewussten Akteuren aufzurücken und weitergehende Handlungsoptionen auszuloten. Die Meraner Kundgebung ist daher als epochemachendes Ereignis der Regionalgeschichte zu werten und ist als erster demokratiepolitischer Emanzipationsakt nicht weniger bedeutsam als die einschlägigen Ereignisse der zweiten Jahrhunderthälfte (der »Tag von Sigmundskron« 1957 und, in geringerem Maß, die »Paketschlacht« 1969) – das Meraner Ereignis war deren eigentlicher Vorläufer und stellt sich vor allem, ungeachtet einer deutlichen nationalistischen Grundierung, als letzte freie kollektive Meinungsäußerung vor den oppressiven faschistischen und nationalsozialistischen Folgejahren dar. Die kollektive Willensbekundung deutete aber auch eine sich immer stärker durchzeichnende, ethnozentrisch orientierte Sammlung aller Kräfte an und steht am Beginn des Uniformitätsdrucks, der mangelnden zivilgesellschaftlichen Diversifizierung und der ethnopolitischen Abschottung, allesamt Faktoren, die Südtirols demokratiepolitische Defizite des 20. Jahrhunderts auf weite Strecken bestimmen würden. Verständlicherweise löste die Versammlung heftige Reaktionen bei den italienischen Stellen aus, und ihre scharfen Parolen spielten den Exponenten des italienischen Nationalismus in die Hände, die in Meran – in bewusster Gegnerschaft zur Autonomiebekundung vom Mai – am 10. Oktober 1920 eine »Annexionsfeier« ausrichteten – zu dieser Zeit war Kafka freilich längst wieder an seinen Beamtenschreibtisch zurückgekehrt.
Die aus Südtiroler Sicht erlittene doppelte Niederlage war einer passiven »Schutz- und Schockstarre« gewichen, einem Schwebezustand von nationaler Depression und Wagenburgmentalität.
An der Kundgebung auf der weitläufigen Mall zwischen Bahnhof und Hoferdenkmal nahmen laut Presseberichten rund 15.000 Menschen teil, eine Menge, die etwa der damaligen Stadtbevölkerung entsprach. Laut der eindrücklichen Beschreibung der Meraner Zeitung waren die Teilnehmenden der »Autonomieversammlung der Bevölkerung der politischen Bezirke Meran und Schlanders […] aus allen umliegenden Tälern von allen Bergdörfern herab« gekommen; »junge Burschen und alte Männer, Mädchen und Frauen« seien dem »Ruf des Deutschen Verbandes einmütig« gefolgt und hätten sich zur »Versammlung unter freiem Himmel« eingefunden. Mit der effektvollen Charakterisierung der Demonstration als Freiluft-Volksversammlung beschwört der durch und durch affirmative Artikel den Moment der schicksalhaften Gegenöffentlichkeit, der Willensbildung in Gestalt eines altdeutschen Thinggerichts bzw. eines Rütlischwurs zu Meran. Die zusätzliche Konnotation des »Südtirol will deutsch und frei bleiben!« und »Fünfzehntausend deutsche Südtiroler haben es gestern auf dem Bahnhofsplatz bekundet« – so die markige Schlagzeile und der Untertitel des Berichts – stellt deutlich auf den ethnozentrischen Gehalt ab, der der voluntaristischen Veranstaltung innewohnte. Ihre Forderungen wurden von den Rednern, den »Wortführern«, unter den wachsamen Augen der bewaffneten, aber abseitsstehenden Carabinieri und italienischen Militärs zu Gehör gebracht. Das Wort ergriffen der Reihe nach ausschließlich Vertreter des Deutschen Verbandes, also Repräsentanten des konservativen Polit-Establishments bzw. jener politischen Dachorganisation, zu der sich die deutschsprachigen Parteien – mit Ausnahme der Sozialdemokraten – unter dem Eindruck von Versailles und der italienischen Annektierung ab 1919 zusammengeschlossen hatten. Diese Koalition mündete in einer zeittypischen Mischung aus autonomistischer Selbstbestimmungsemphase und beginnendem, antiitalienisch eingefärbtem Revanchismus, dessen sich später, gerade auch in Südtirol, der Nationalsozialismus bedienen würde. Dass die Sozialdemokratie es bevorzugte, sich der nationalen Fraktion anzuschließen, und damit vom Deutschen Verband Abstand nahm, war zum einen auf den deutschnationalen Einschlag des konservativen Parteienbündnisses zurückzuführen, fußte zum anderen aber auch auf der internationalistischen Orientierung der Sozialisten, deren tendenzieller Universalismus noch in den (im Ersten Weltkrieg freilich schwer beschädigten) Traditionen der Zweiten Internationale wurzelte. Zudem waren die Südtiroler Parteigänger der Sozialdemokratie, deren lesenswertes Tagblatt Volksrecht programmatisch am 1. Mai 1920 erstmals erschien, zusehends der Marginalisierungspolitik der bürgerlichen Parteien des Deutschen Verbandes ausgesetzt. Ihre Stammwählerschaft – vielfach Staatsbeamte, Arbeiter und Beamte – war von der Möglichkeit, nach der Annexion die italienische Staatsbürgerschaft zu erwerben, häufig ausgeschlossen und wählte im Zuge der sogenannten Ersten Option den Verzug bzw. die Rückkehr nach Österreich.
Der Deutsche Verband umfasste die Tiroler Volkspartei, eine Fusion von Konservativen und Christlich-Sozialen, und die Deutschfreiheitliche Partei, eine vor allem städtische Schichten repräsentierende bürgerlich-liberal und deutschnational, teilweise auch antisemitisch veranlagte Gruppierung. Als Erster sprach bei der Kundgebung in Meran Rechtsanwalt Bernhard von Zallinger als Repräsentant der Deutschfreiheitlichen Volkspartei. Nach den revisionistischen Standardformeln vom »unverschuldeten« Zusammenbruch Österreich-Ungarns und vom »Gewaltfrieden von St. Germain« führte er das endzeitliche, an Oswald Spenglers Untergangsfantasien anschließende Thema von »Sein oder Nichtsein [der] tirolischen Heimat« ein – das »deutsche Volkstum in Südtirol« werde ohne Änderung der herrschenden Verhältnisse »mit der Zeit vom italienischen Volk aufgesogen und damit vernichtet«. Dieses apokalyptische Untergangsszenario vor Augen, appellierte er an das »Gewissen der Welt«, dem »Sklavenschicksal« Südtirols in Italien Einhalt zu gebieten. Mit der Parole von der »Unterjochung Südtirols durch Trient in der einheitlichen Provinz« rekurrierte Zallinger auf das Narrativ des »Los von Trient!«, das als eine Art J’accuse bereits einen Monat zuvor die Schlagzeile des in Bozen verlegten Tagblatts Der Tiroler vom 11. April 1920 bestimmt hatte. Die weiteren Redner schlugen in dieselbe Kerbe: Josef Menz aus Marling protestierte im Namen der Katholischen Volkspartei ebenso gegen die »Diktatur von Trient« und die »Hetze der Welschen«. Auf ihn folgte mit dem Meraner Rechtsanwalt Josef Luchner (1877–1931) ein prominenter Vertreter der Christlichsozialen, der von April bis Dezember 1919 Delegierter in der Konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich, dem ersten frei gewählten Wiener Parlament, gewesen war. Sollte Kafka noch zugegen gewesen sein, dann hätte ihn Luchners martialische Rede vom »Kampf um den deutschen Süden« an Parolen der deutschen Schutzvereine erinnert. Deren völkische Propaganda war auch im südlichen Tirol und im Trentino vor 1914 omnipräsent und vor allem von der Vereinigung Südmark vorangetrieben worden. Die nationale Mobilisierung am Meraner »Volkstag« mündete in eine »Entschließung […] der politischen Bezirke Meran und Schlanders«, die von der italienischen Regierung die Gewährung einer »vollen Selbstverwaltung Südtirols« einforderte.
(Schlussteil 3 folgt)
Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.