Politik | Sanität
„Ich bin ein Südtiroler“
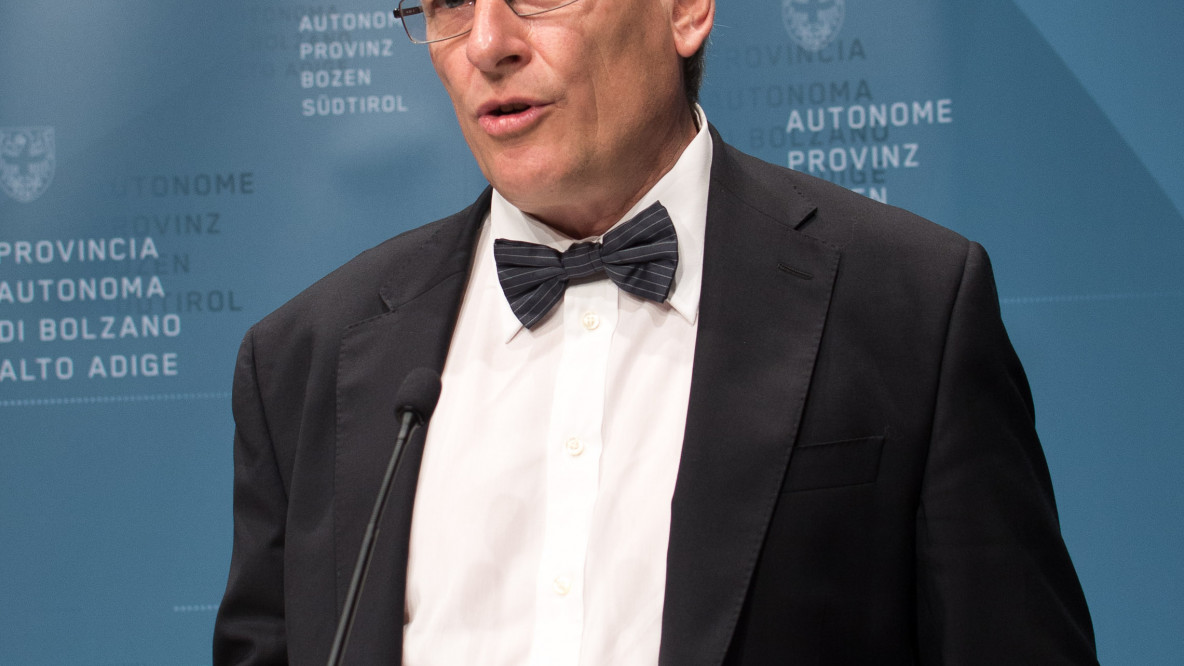
Foto: LPA
Salto.bz: Herr Generaldirektor Schael, der Pakt mit der Athesia scheint geplatzt?
Thomas Schael: Welcher Pakt mit Athesia?
Sie haben bisher mit der RAI und den Athesia-Medien auf einer Art Vorzugsschiene kommuniziert.
Nein. Mir geht es insgesamt um eine ausgewogene Berichterstattung. Derzeit kann ich mich aber des Gefühls nicht erwehren, dass die politischen Vernetzungen und Verstrickungen sich letztlich auch in der Berichterstattung der Medien über das Gesundheitssystem widerspiegeln. Wahrscheinlich sagt man: Landesregierung, Kompatscher, Stocker, Schael. Da haben einige anscheinend nicht verstanden, dass der Schael von der Landesregierung beauftragt wurde, sich um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Ich bin kein Politiker. Ich brauche keine Stimmen.
Sie sagen: Die Athesia greift den Landeshauptmann an....
Nein, sie schalten ihn aus. Im Hintergrund sind hier gewisse Seilschaften und Netzwerke aktiv, die Druck auf Kompatscher und die amtierende Landesregierung machen wollen.
...und auch Schael soll ausgeschaltet werden?
(lacht) Sagen wir mal so. Wir haben jede Menge gute Nachrichten, die wir - so glaube ich – an die Bürger heranbringen sollten. Auch um ihnen das Vertrauen und die Sicherheit zu geben, dass sie in einem Land leben, wo sie bestens versorgt sind. Doch gewisse Medien haben sich auf Reizthemen eingeschossen. Dabei kommt es in der Berichterstattung zu Verzerrungen, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Sie haben am Wochenende getwittert: „Boulevardjournalismus beim @TagblattD startet Serie #DrHouse über #Notaufnahme #Bozen“?
Ja. Die Dolomiten machen jetzt Dr. House zur Notaufnahme. Ich war ja auch einmal journalistisch tätig. Wenn man Journalist ist, dann recherchiert man. Wenn man recherchiert, dann kommt aber nicht das heraus, was in den Dolomiten oder im Alto Adige steht. Da wird fast täglich eine Horrorgeschichte aus der Notaufnahme serviert. Wenn jetzt die Dolomiten aber auch noch eine Dr-House-Serie startet, über all das, was angeblich in der Sanität nicht funktioniert, dann ist das zuviel.
Würden Sie die Zustände in der Ersten Hilfe in Bozen als Verzerrung der Realität bezeichnen?
Sicher gibt es hier noch Vieles zu tun. Hier braucht es unzweifelhaft noch Verbesserungen. Natürlich ist die Erste Hilfe in Bozen derzeit überlastet. Aber man muss dazu auch sagen, dass ein großer Teil der Menschen, die in die Notaufnahme des Bozner Krankenhauses kommen, dort eigentlich nichts zu suchen haben. 70 Prozent sind weiße oder grüne Kodexe. Also nichts für eine Notaufnahme.
Ein Fehler im System?
Hier müssen wir noch Vieles verbessern. Wir müssen sicher das Territorium in Zukunft stärken. Das heißt aber nicht, dass nur der Hausarzt mehr machen soll. Sondern auch der Sanitätsbetrieb ist gefordert, über den Aufbau eines Gesundheitszentrums die Versorgung, die Sicherheit und das Gefühl der Sicherheit im direkten Wohnumfeld zu verbessern. Aber man muss auch sagen: Südtirol hat 520.000 Menschen als Wohnbevölkerung. Dazu kommen noch einmal 80.000 bis 90.000 Touristen. Das heißt, wir versorgen täglich 600.000 Personen. Vor allem in der Versorgung und in der Notfallmedizin sind wir absolute Spitze.
„Wir haben bei den wirklichen Notfällen Goldstandard. Wir hatten erst kürzlich einen Kongress zum Schlaganfall. Dort sind wir in den Versorgungszeiten Weltspitze. Wir versorgen die Menschen innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden.“
Sagen Sie das mal einem Touristen, der zehn Stunden in Ersten Hilfe in Bozen steht?
Wir bekommen von den Touristen weitaus mehr Lobesbriefe als Beschwerden. Und wissen Sie, warum das so ist? Vor zwei Wochen ist genau dasselbe Thema auf Mallorca medial hochgekocht, wo es ja besonders viele deutsche Touristen gibt. In der Ersten Hilfe war eine Warteschlange von 150 Leuten und manche warteten seit 48 Stunden. Die Leute kommen auch nach Südtirol, weil sie wissen, dass hier alles gut funktioniert.
Jetzt reden Sie sich die Realität aber schön?
Nein. Wir haben bei den wirklichen Notfällen Goldstandard. Wir hatten erst kürzlich einen Kongress zum Schlaganfall. Dort sind wir in den Versorgungszeiten Weltspitze. Wir versorgen die Menschen innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden. Das ganze System ist so aufgebaut, dass wir wirklich Spitze sind. Ebenso bei Polytraumata nach Unfällen. Natürlich haben wir auch Verbesserungsbedarf. Sei es in der Notaufnahme in Bozen, sei es in der chronischen Versorgung. Daran arbeiten wir. Zwanzig Jahre lang wurde nichts getan, jetzt tun wir was und mein Wunsch ist es nur, dass man uns endlich arbeiten lässt.
„20 Jahre wurde nichts getan“, spätestens jetzt bekommt ihr Vorgänger Andreas Fabi einen Infarkt?
Nein, Andreas Fabi sollte die Rente genießen. Ich habe das in meinem offiziellen Bericht relativ klar dargestellt. Man muss das nur nachlesen. Ich habe genau beschrieben, wie ich den Sanitätsbetrieb bei meinem Amtsantritt vorgefunden habe und wohin ich die Südtiroler Sanität bringen möchte.
Wir sind ganz Ohr.
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet eine qualitativ hochwertige Versorgung. Auch aufgrund der hochmotivierten und -qualifizierten Mitarbeiter. Letztendlich ist dieser Betrieb nur dank der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so gut, wie er ist. Jetzt aber versuchen wir das Ganze noch besser zu machen. Dazu braucht es Struktur, Prozesse, Visionen und Strategien. Das zu machen ist meine Aufgabe. Die Journalisten haben dabei eines vergessen, was ich bei meinem Amtsantritt gesagt habe. Ich möchte hier weggehen, wenn ich eines der best funktionierenden Gesundheitssysteme Europas aufgebaut habe.
„Sowohl die Politik als auch die Medien sollen uns endlich arbeiten lassen.“
Die Politik hat Ihnen dazu mit der Sanitätsreform eine neue Machtfülle in die Hand gegeben?
Ich verstehe mich nicht als mächtigen Generaldirektor, sondern als Garant der Bevölkerung und der ausgewogenen Beachtung aller Interessen. Denn in einem Betrieb mit 1,3 Milliarden Euro Umsatz, der der größte Arbeitgeber Südtirols ist, gibt es natürlich die verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Interessen. Ich wünsche mir deshalb, dass endlich ein bisschen Ruhe in die Sanität reinkommt. Die Politik hat mit dem Landesgesundheitsplan und den beiden Reformgesetzen ihre Arbeit getan. Jetzt aber ist Wahlkampf. Und ich glaube, sowohl die Politik als auch die Medien sollen uns endlich arbeiten lassen.
Sie sehen die Kritik an der Südtiroler Sanität als Teil des beginnenden Wahlkampfes?
Ja, wie ich schon gesagt habe. Es geht hier um die Bestätigung von Arno Kompatscher. Ob die Landesrätin wieder kandidiert, weiß ich nicht. Aber letztendlich geht es um Mehrheiten. Was dabei interessant ist: In Restitalien und auch in Deutschland hat sich die Politik längst aus der gesundheitspolitischen Debatte zurückgezogen, weil man dort verstanden hat, dass man damit keine Wahlen gewinnt. Wenn man den Technikern den Raum lässt, ordentlich zu arbeiten, dann braucht es keine großen politischen Vorgaben.
„Die Athesia will den Landeshauptmann ausschalten. Im Hintergrund sind hier gewisse Seilschaften und Netzwerke aktiv, die Druck auf die amtierende Landesregierung machen.“
Ein aktuelles Beispiel zeigt uns aber genau das Gegenteil. In Italien wurde jetzt die Impfpflicht massiv ausgeweitet. Verstehen Sie, dass Menschen dagegen protestieren?
Nein. Denn das ist inzwischen weltweit Standard. Auch der deutsche Bundesgesundheitsminister überlegt seit Wochen, die Pflichtimpfung auch in Deutschland einzuführen. Das Problem der Masern haben wir in ganz Europa...
Sie haben das richtige Wort gebraucht: Deutschland überlegt. In Italien hat man über Nacht die Pflichtimpfungen vervierfacht.
Die FDP hat bereits beschlossen, dass die Pflichtimpfung ins Koalitionsprogramm muss. Das wird auch in Deutschland kommen. Wir haben in Europa längst diese Diskussion, ob es sich um Gurt-, Helmpflicht oder Rauchverbot handelt. Es geht um Themen, die letztlich zum Schutz des Gemeinwohles Gesundheit wichtig sind. Man denkt hier in der Optik des Bevölkerungsschutzes. Letztlich ist das genauso wie mit der Gurtenpflicht.
Sie sind also für den autoritären Staat, in dem individuelle Bürgerrechte nicht mehr gelten und die Menschen zur Gesundheit gezwungen werden?
Das ist eine sehr komplexe und schwierige Diskussion. Es geht da auch um sehr ethische Themen, die gerade in der Gesundheit, wo es um Leben und Tod geht, immer wieder kontrovers diskutiert werden. Nehmen wir das Biotestament. Es sind schwierige Fragen, in denen die Politik eine klare Verantwortung hat. Wir können es nur wissenschaftlich unterstützen. Hier hat die Politik die Verantwortung zu entscheiden.
Impflicht ist doch nicht nur ein Gesundheitsthema. Es geht auch um Umsätze der Pharmaindustrie in Billionenhöhe.
Auch dieses Interesse der Wirtschaft ist nicht gegeben. Wenn wir nicht impfen, dann verdienen alle mehr. Sei es die Privatkrankenhäuser, sei es die Pharmalobby. Dann bekommen wir die Akutpatienten, die wir behandeln müssen oder die sogar auf die Intensivstation kommen. Das hat dann nichts mehr mit 50 Euro zu tun, sondern da geht es um Tausende von Euros.
„Wenn wir nicht impfen, dann verdienen alle mehr. Sei es die Privatkrankenhäuser, sei es die Pharmalobby.“
Der Unterschied: Geimpft werden Milliarden. In die Intensivstation müssen aber nur ganz ganz wenige?
Dann aber sind die Kosten zehntausendmal so hoch. Sinkt die Durchimpfungsrate, werden wir Tausende von solchen Fällen bekommen.
Gesundheitslandesrätin Martha Stocker ist in Sachen Impfzwang anderer Meinung. Gibt es hier Differenzen?
Das müssen Sie die Landesrätin fragen. Ich glaube aber nicht. Ich spiele in dieser Diskussion eine institutionelle Rolle. Ich bin verantwortlich für die Gesundheit der Bevölkerung. Wissenschaftlich gibt es hier keine Diskussion mehr. Deshalb habe ich meine Meinung auch klar gesagt. Die Politik kann dann auch anders entscheiden. Von mir aus kann man auch sagen: In Südtirol wird nicht geimpft. Nur dann bin ich der falsche Generaldirektor.
Nach zwei Jahren scheinen Sie in der Südtiroler Realität angekommen zu sein?
Ich bin Südtiroler. Ich habe meine Familie hierher gebracht, ich zahle hier Steuern, ich wohne im Lauben-Milieu Bozens. Was will Südtirol mehr? Ich habe mich integriert. Obwohl Integration in Südtirol sehr schwierig ist. Auch oder gerade für Deutsche.
Ihnen ist bewusst, dass Sie in der Wertung der drei meistgehassten Südtirolern derzeit auf dem Stockerl stehen?
Da frage ich, gehasst von wem? Hier sind wir genau wieder bei dieser Diskussion. Ich bin der Garant für die beste Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger Südtirols. Das ist meine institutionelle Aufgabe. Wir sind jetzt in der Versorgung bei 80 Prozent. Und die letzten 20 Prozent sind am schwierigsten. Denn wenn nichts da ist, dann ist es einfach zu verbessern.
„Ich bin kein Politiker. Ich brauche keine Stimmen.“
Kann man jede Kritik aber als Boulevardjournalismus abtun?
Das mache ich nicht. Jetzt diskutiert man aber boulevardmäßig über Sachen, die wir kennen und bei denen es wirklich nicht notwendig ist, dass sie jeden Tag wieder groß aufgewärmt und auf die Titelseite geklatscht werden. Das ist kein Zufall, sondern dahinter steckt Strategie. Es geht um die Aushöhlung der amtierenden Landesregierung. Dazu kommen aber auch wirtschaftliche Interessen. Wir haben ein reiches Land, wir haben viele Medien und natürlich haben diese Medien auch finanzielle Interessen.
Sie meinen den Werbekuchen, mit dem der Sanitätsbetrieb jahrzehntelang die Athesia gemästet hat?
Ich habe in meiner Rolle als Generaldirektor immer mit den Medien gearbeitet. Die Gesundheit ist ein Gut des Gemeinwohls, deshalb interessiert es auch alle. Und es ist mir noch nie passiert, dass ich für das Thema Gesundheit keine Sonderkonditionen bei den Anzeigen bekommen habe. Überall wo ich gearbeitet habe, war es so, dass es für Gesundheitskampagnen, in denen es um das Allgemeinwohl geht, also um das öffentliche Interesse, ein weit niedriger Preis für Inserate verlangt wurde. Man kann uns doch nicht so behandeln wie ein beliebiges privates Großunternehmen. Nur in Südtirol ist das anders.
Pecunia non olet – das Geschäftsmodell im Ebner-Verlag?
Ich darf ihnen ein Erlebnis dieser Art anvertrauen. Sie erinnern sich an die Medienkampagne zum Landesnotruf-Dienst 112. Auch dort hat man auf der großen Medienklaviatur gespielt: Schuler, Stocker, Schael und wer da angeblich alles Mist baut. Das eigentliche Problem, das wir aber hatten, war Disponenten zu finden. Ein Problem, das alle angeht. Denn es geht hier um Katastrophenschutz und um Notfall-Situationen. Wir haben deshalb vorgeschlagen, dass man redaktionell dieses Problem thematisiert. Der Artikel war bereits fertig, da hat man uns abends mitgeteilt, dass der Chef vom Dienst den Artikel aus der Zeitung genommen hat. Am nächsten Tag hat dann die Werbeabteilung angerufen: Wir sollten doch ein Inserat für die Disponentensuche schalten. So geht das aber nicht. Denn die Medien und auch die Familie Ebner haben auch eine soziale Verantwortung.
Herr Schael, wie lange wollen Sie noch an der Spitze des Südtiroler Sanitätsbetriebes bleiben?
Noch acht Jahre. Das habe ich von Anfang an gesagt: Ich werde zehn Jahre bleiben. Weil es viel strukturelle Arbeit braucht, schafft man das in den ersten fünf Jahren einfach nicht. Aber man sollte mich endlich arbeiten lassen. Dann werde ich dafür sorgen, dass man zur Bewertung meiner ersten fünf Jahre alle Daten und Fakten auf dem Tisch hat. Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung dann merkt, dass es besser geworden ist. Und nicht, weil es so oder so in der Zeitung steht. Ich messe mich nicht an den Zeitungen, deshalb bin ich auch so glücklich.
Ihnen gefällt der Job immer noch?
Ja. Und wenn man nicht mehr über die Sanität reden würde, wäre ich noch glücklicher.
Zumal die Kinderrechte in
Zumal die Kinderrechte in Südtirol aufgrund der fehlenden Kinderärzte mit Füssen getreten werden, die Impflicht das Persönlichkeitsrecht verletzt, die Dolomiten einen Notstand bei Tierärzten auf der Titelseite konstatiert, frage ich mich mittlerweile täglich ob ich im falschen Film bin.
Für mich ist Schael der falsche Generaldirektor, der Landeshauptmann der falsche Landeshauptmann, bei Frau Stocker habe ich geteilte Meinung und noch nicht entschieden.
Ich weiß nur eines, keine Kinderrechte ist wie in der Mathematik das Zählen zu verbieten und deshalb befürchte ich das Schlimmste, da Tierrechte offenbar mehr wert als Kinderrechte sind.
Antwort auf Zumal die Kinderrechte in von Markus Falk
Was hat Impfpflicht mit
Was hat Impfpflicht mit Kinderrechten zu tun? Wer seine Kinder nicht impfen lässt, verletzt ihr Recht auf ein gesundes Leben!
Hier kommt ja prompt die
Hier kommt ja prompt die Bestätigung. Gesundheit zum Wahlkampfthema.
Was haben bitte Fabi, Zerzer und Theiner auf die Füße gestellt und nicht alles verbockt? Stichwort Digitalisierung?
Wo, wo fehlen denn die Kinderärzte? Nur weil ein Kinderarzt mehr verdienen will als der Staatspräsident und im November die Praxis schliesst? Dai.
Mir fehlt allerdings ein
Mir fehlt allerdings ein Thema: Maulkorp.
Wie sollen bitte ehrliche Journalisten zu Informationen kommen, wenn über alle ein Damoklesschwert hängt?
Auch das Fehlen der
Auch das Fehlen der Kinderärzte ist relativ. Anders als der Mangel an Hausärzten!
Es ist schon verrückt, mit
Es ist schon verrückt, mit welcher Aufmerksamkeit die mediale Öffentlichkeit Südtirols den Sanitätsbetrieb begutachtet... Maßstäbe sind da irgendwo schon lange verloren gegangen. Und obwohl die Dolomiten sogar aus dem Abschied von igrndeinem Primar gern mal einen Titelblattthema macht, muss man irgendwie auch konstatieren, dass nicht bloß die Ebner-Presse hier den bösen Buben spielt. Auch die Tageszeitung und salto berichten mit erstaunlicher Regelmäßgkeit über jeden Pups. Die Tagesschau von Rai Südtirol sendet praktisch jeden Abend (!) irgendeine Nachricht aus dem Sanitätsbetrieb. Manchmal frag ich mich, ob’s wirklich nicht andere Themen gibt und ob das die Leute denn tatsächlich dermaßen ernsthaft interessiert...
Ich bin keine Südtiroler mehr
Ich bin keine Südtiroler mehr wenn Schael einer ist.
Kinderrechte haben wesentlich mehr mit der Impflicht zu tun als man glaubt. Man denke nur an die sachgemäße Aufklärung. Zudem gibt es fast ausschließlich nur mehr Mehrfachimpfstoffe, eine erneute Impfung bei bestehendem Impfschutz kann massive Nebenwirkungen nach sich ziehen. Wo gibt es ein Register für verpatze Impfungen (nicht nur der Impfstoff, sondern auch derjenige der die Impfung durchführt und das Follow-Up müssen dokumentiert werden) usw. usf.?
Es gibt Kaufläute mit hohem Umsatz und Null Gewinn. Was nützen einem Kinderarzt 240k wenn er 220k Kosten hat?
Wie gesagt, wir treten für die Rechte unserer Kinder ein und wir sind es bereits gewöhnt, dass dies niemanden so richtig schert. Als ich in Bruneck rief, „Ich bin gegen Kinder, wer sei noch gegen Kinder?“, hat es nur 5 Minuten gedauert und die Polizei war da, geschickt von Pensionisten. Diese waren die einzigen die den Wert von Kindern erkannt hatten und meinten „wer bitte, soll dann unsere Pension zahlen?“.
Antwort auf Ich bin keine Südtiroler mehr von Markus Falk
Koennten Sie bitte erklären
Koennten Sie bitte erklären wie ein Arzt auf 220.000 Euro Kosten im Jahr kommt ? Danke.
Leider neigt der Mensch zum
Leider neigt der Mensch zum Vergessen und kann daher leicht irregeführt werden. Erinnert ihr euch an die obligatorische Impfung des Impfstoffes für Hepatitis B vor 26 Jahren, eingeführt vom damaligen Gesundheitsminister De Lorenzo und als zwingend vorgeschrieben wurde? Nun ja, Hepatitis B wird nur durch engen, körperlichen Kontakt, bzw. über Bluttransfusionen, Speichel, sexuelle Kontakt etc. übertragen und da stellt sich nun die Fragen, weshalb Kleinkinder mit dieser Impfung gequält werden müssen, die sie nachweislich NICHT zur Gefahrengruppe zählen? Nun, der damalige Minister hat zusammen mit seinen Kumpanen (Pharmaindustrie ...) in Italien ca. 600 Millionen Lire kassiert. Für EINE Impfung wohlgemerkt! Jetzt, mit der neuen Impfkampagne, sind es gleich 11 Impfungen, da ist es ein Leichtes 1 + 1 zusammenzuzählen und es ist irreführend diesbezüglich das Rad umzudrehen.
Was fehlt ist eine objektive Information. Es darf nicht sein, dass sich Eltern ihrer elterlichen Gewalt entzogen fühlen, dass Kleinkinder vorbeugend Impfungen unterzogen werden, die eventuell gar nicht nötig sind ... und und. Hier würde ich mir einiges mehr von unserer Sanität wünschen - zum Bsp. eine Art InfoPoint, verteilt auf die ganze Provinz ... ?
Ich wollte hier eigentlich
Ich wollte hier eigentlich keine Kinderarzt oder Impfdiskussion starten. Zur Impfung gibt es bereits hier eine zweite Diskussion (https://www.salto.bz/de/article/20052017/imfpfaschismus).
Was ich aber aufzeigen wollte ist, dass das System SS (Schael-Südtirol) nicht funktionieren kann. Wieso?
Die Dolomiten kann nur dann etwas schreiben, wenn es Vorfälle gibt. Eine nicht funktionierende Notaufnahme ist so ein Vorfall. Wie kann es sein, dass es dort zu Engpässen kommt? Kavaliersdelikt ist dieses sicherlich keines.
Wie kann es sein, dass Kinderärzte fehlen oder zusperren müssen? Die Kinderarztsituation im Pustertal (5.000 Kinder ohne Arzt) entspricht einem Hausarzt für ganz Bruneck! Ist dies ein Kavaliersdelikt?
Einen Termin für eine OP kriegt man in Bruneck noch relativ schnell. Auf die Visite muss man aber durchaus Monate warten und macht diese privat (150€). Was wenn ich morgen meine stationäre Aufnahme auch privat bezahlen muss (15.000€)? Kavaliersdelikt?
Für mich hat das allgemeine Versagen System und was wir sehen sind erste Anzeichen für den Zusammenbruch. Stellt euch vor die Ambulanzen könnten nur mehr eine Stunde pro Tag offenhalten, da das Personal fehlt bzw. nicht finanziert werden kann. Kavaliersdelikt?
Wir sollten uns schon genauer fragen was Mr. Super Schael so im Schilde führt. Er selbst glaube ich, weiß auch nicht auf welchen Felsen er zusteuert und eine zweite Costa Concordia wünsche ich uns allen nicht.
Antwort auf Ich wollte hier eigentlich von Markus Falk
Sie erklären den Schäel als
Sie erklären den Schäel als Schuldigen an der aktuellen Misere. Er hat also ein perfekt fuktioniendes System übernommen
und es in kurzer Zeit riuniert. Seine löblichen Vorgänger sind schuldlos. Sie haben ja, wie Schäel sagt, 20 Jahre lang nichts gemacht. Oder ?
Antwort auf Sie erklären den Schäel als von 19 amet
Von einem Top-Sch kann man
Von einem Top-Sch kann man erwarten, wenn er einen nicht mehr ganz fahrtüchtigen Karren übernimmt, dass er ihn vorher verkehrstüchtig macht bevor er uns damit herumkutschiert. Alles andere wäre grob fahrlässig. Was ich aber beobachten kann ist genau das Gegenteil. Es wird sogar noch Gas gegeben.
Antwort auf Von einem Top-Sch kann man von Markus Falk
Ich warte immer noch auf Ihre
Ich warte immer noch auf Ihre Erklärung wie ein Hausarzt auf 220.000 Euro Kosten im Jahr kommt. Sind Sie noch beim Rechnen ?
Antwort auf Ich warte immer noch auf Ihre von 19 amet
Sry, hatte die Frage nicht
Sry, hatte die Frage nicht gesehen.
Im Falle der beiden Kinderärzte Mair und Panzenberger sind mit 240.000.- EUR folgende Kosten pro Jahr zu decken (1500 Kinder):
Gerätekosten: 50 – 60k EUR (k = tausend)
Personal (Krankenschwester): 70k
Verbrauchsmaterial: 40- 70k
Betriebskosten (Miete, Strom, Heizung, Müll, Sondermüll etc.) = 40k
Dies macht in Summe 200k bis 240k vor Steuern aus. Die Ärzte verdienen also eindeutig zu viel, denn für das eigene Gehalt bleibt nichts mehr übrig.
Im restlichen Staatsgebiet ist die Anzahl an eingeschriebenen Kindern pro Kinderarzt auf 800 begrenzt. Dort reichen die 240.000€ aus und es sind keine Probleme bekannt. In Südtirol gibt es eine Maximalgrenze von 1320 Kindern. Proportional umgerechnet würde dies 396.000.-€ ergeben.
Antwort auf Sry, hatte die Frage nicht von Markus Falk
Ändern sich diese Kosten aber
Ändern sich diese Kosten aber so entscheidend durch 100 Kinder mehr oder weniger?
Antwort auf Ändern sich diese Kosten aber von Martin B.
Ja, die Kosten sind z.T.
Ja, die Kosten sind z.T. proportional durch das Verbrauchsmaterial. Ein Schnelltest z.B. auf Bakterien kostet an die 2-10€ pro Stück, Stuhltest an die 15€, Laktose um 90€, Allergie an die 20€ usw.
Wird ja schon alles gut sein,
Wird ja schon alles gut sein, aber zur Diskussion über die Notaufnahme hätte ich schon einmal gern festgehalten, dass der Laie, der jetzt nicht weiß was ihm fehlt, vielleicht lieber einmal zu viel in die Notaufnahme rennt als zu wenig, und nicht erst noch den Hausarzt anruft (Sonntags?), sich von ihm untersuchen lässt (dadurch vielleicht wertvolle Zeit verliert), um dann ggf. doch in der Notaufnahme zu landen und trotzdem stundenlang zu warten. Also ein Vorschlag: wenn’s in der Notaufnahme für eine erste Diagnose schnell ginge, könnte man den Patienten dann doch einfach zum Hausarzt schicken. Ich möchte den sehen, der lieber 8 Stunden in der Notaufnahme wartet, als sich dann an den Hausarzt zu wenden.
Antwort auf Wird ja schon alles gut sein, von Karel Hyperion
Kann ich nur zustimmen und
Kann ich nur zustimmen und deshalb brauchen wir auch eine Aufwertung der Hausärzte. Dafür braucht es aber auch gute Hausärzte.
Es ist immer gut zu
Es ist immer gut zu diskutieren und den Status Quo zu hinterfragen. Debattiert man über spannende Themen wie die Notaufnahme, Kinderärzte-Problematik, Hausärzte oder die Impfkampagne, so spiegelt sich darin dann schlussendlich die Gesamtsituation der medizinischen Versorgung wieder. Der Laie kann nur debattieren, mehr oder weniger Fachgerecht. Sucht seine Antworten in den sozialen Netzwerken und begeht schwerwiegende Fehler. Warum? Weil er bei konkreten Fragen, der Ohnmacht/Überforderung/Überlastung der Fachkräfte ausgesetzt ist. Wie Fragen der Bürger diskutiert und beantwortet werden oder auch nicht, spiegelt die Qualität der Versorgung wieder. Eine objektive Informationsvermittlung, keine Bevormundung, sondern eine Beziehung zum mündigen Bürger/Patienten herstellen und den Umgang mit dem Gesundheitssystem aktiv mitgestalten zu lassen, sind Eckpfeiler unserer heutigen Gesellschaft und können nicht außen vor gelassen werden. Helfen Informationen zur Gesundheit und Krankheit finden und umsetzen zu können, neue Informationstechnologien nutzen zu können, sind Anforderungen an mündige Patienten von heute. Die Entscheidungsträger im Gesundheitssystem müssen aber die Rahmenbedingungen dazu schaffen.
Antwort auf Es ist immer gut zu von David Gebhardi
Treffender könnte man dies
Treffender könnte man dies nicht ausdrücken.