„In Sorge bleiben“

-
Das Frauenmuseum Meran lädt gemeinsam mit dem Internationalen Verband der Frauenmuseen (IAWM) am 27. August um 19 Uhr zu einer öffentlichen Konferenz ein. Unter dem Titel „Feminist Strategies of Resistance in Women’s and Gender Museums“ widmet sich die siebte Auflage der Frage, wie Frauen- und Gender-Museen zu Orten feministischer Erinnerung und gesellschaftlichen Wandels werden können. In einer Zeit, in der Gewalt, Ungleichheit und Machtmissbrauch weltweit sichtbar bleiben, gewinnen solche Räume, die Fragen nach Gerechtigkeit, Anerkennung und Solidarität stellen, besondere Bedeutung.
Im Vorfeld sprachen die beiden Impulsreferentinnen, Elke Krasny und Daniela Gruber, über ihre Arbeit und gaben Einblicke in ihre Schwerpunkte.
-
Räume der Auseinandersetzung
Dr. Elke Krasny, Kulturtheoretikerin, Kuratorin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien, wird unter dem Titel In-Sorge-Bleiben: Reparatives Kuratieren und restaurative Gerechtigkeit ihr Impulsreferat halten. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit feministischen Strategien im kuratorischen Feld. Mit Publikationen wie Curating as Caring, Critical Care: Architecture and Urbanism for a Broken Planet oder dem Sammelband Radicalizing Care. Feminist and Queer Activism in Curating (2021) prägt sie internationale Debatten.
„Mit Sorgfalt zu arbeiten bedeutet (...) zu einem wiederherstellenden Prozess beitragen.“
Sie versteht Museen nicht als neutrale Institutionen oder bloße Orte der Bewahrung, sondern als politische Räume der Auseinandersetzung. Im Zentrum steht für sie das Konzept der Sorgfalt – „Mit Sorgfalt zu arbeiten bedeutet, Geschichten und Objekte so zu kuratieren, dass sie nicht erneut verletzen, sondern zu einem wiederherstellenden Prozess beitragen.“
Dieses „restaurative Kuratieren“ soll Ungleichheiten sichtbar machen, Leerstellen füllen und Erfahrungen von Frauen, marginalisierten Gruppen und Überlebenden von Gewalt ins Zentrum rücken. Sie sieht Kuratieren als epistemische und gesellschaftliche Praxis. Eine Form des feministischen Sorgetragens und Strategie des Widerstands gegen Vergessen und Unsichtbarmachung.
-
Infobox: Frauenmuseen im internationalen Netzwerk
Frauenmuseen entstanden weltweit, um Frauengeschichte und -kultur sichtbar zu machen – meist unabhängig und oft privat initiiert. Das Frauenmuseum Meran, eines der ältesten in Europa, ist seit den 1990er-Jahren im internationalen Austausch aktiv und Mitbegründer des globalen Netzwerks der Frauenmuseen (IAWM, 2008). Heute ist Meran Sitz des internationalen Vereins und Teil eines weltweiten Netzwerks, das Frauenperspektiven sichtbar macht.
In Italien gibt es zwei Frauenmuseen: in Meran und das Associazione Museo delle Donne del Mediterraneo – „Calmana“ in Neapel. In Österreich existieren ebenfalls zwei, darunter das Frauenmuseum Hittisau (Vorarlberg). In Deutschland gibt es insgesamt 8.
-
Zugleich reflektiert sie kritisch die ambivalente Position von Frauenmuseen: Einerseits seien sie ein notwendiges Korrektiv gewesen, weil weibliche Stimmen in klassischen Institutionen kaum vorkamen. Andererseits reproduzierten viele noch immer ein binäres Geschlechterverständnis. „Heute braucht es queere und transnationale Perspektiven“, betont Krasny. Ansätze, die Geschlecht als vielfältig begreifen und globale Verflechtungen sichtbar machen. Museen hätten in der Vergangenheit koloniale und patriarchale Ordnungen verfestigt, könnten aber zugleich zu Orten des Dialogs und der Vielstimmigkeit werden.
„Es geht um die Möglichkeit, neue Formen des Zusammenlebens zu denken.“
Feminismus versteht sie nicht nur als politisches Programm, sondern als Haltung. „Care-Feminismus“ verbinde Hoffnung und Widerstand: Hoffnung, weil sich Gesellschaften verändern lassen; Widerstand, weil man sich Ungleichheiten nicht fügt. „Es geht um die Möglichkeit, neue Formen des Zusammenlebens zu denken“, sagt sie, auch in den Beziehungen zwischen Menschen, Natur und anderen Spezies.
-
Forschung, die Tabus bricht
Eine andere Ebene bringt Daniela Gruber in die Konferenz ein. Als Forschungsassistentin im Projekt TRACES – Transgenerational ConsEquences of Sexual Violence untersucht sie gemeinsam mit Kolleginnen die langfristigen Folgen sexualisierter Gewalt. „Wir wollen verstehen, welche Mechanismen dazu führen, dass Traumatisierungen nicht an einer Generation enden, sondern weitergegeben werden – und zugleich, welche Ressourcen Frauen finden, um Widerstand zu leisten und Resilienz zu entwickeln“, erklärt sie.
„Wir sehen, dass Enkelinnen oft mit denselben Themen ringen, obwohl sie die ursprünglichen Gewalterfahrungen gar nicht selbst erlebt haben“.
Das Projekt, getragen von Partnerinnen wie der Universität Trient, Medica Mondiale, dem Frauenmuseum Meran sowie dem Forum Prävention mit Christa Ladurner, verbindet wissenschaftliche Analyse mit feministischer Praxis. Wichtig sei der partizipative Anspruch: „Wissen entsteht nicht nur im Universitätskontext. Es entsteht in der Zusammenarbeit mit Betroffenen, mit Fachkräften, mit lokalen Institutionen.“
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, wie tief die Spuren sexualisierter Gewalt reichen. Viele Frauen berichten von lebenslangen psychischen und physischen Folgen, die oft bis in die nächste Generation wirken. „Wir sehen, dass Enkelinnen oft mit denselben Themen ringen, obwohl sie die ursprünglichen Gewalterfahrungen gar nicht selbst erlebt haben“, so Gruber.
„Das zeigt, dass sexualisierte Gewalt kein privates Problem ist.“
Besonders kritisch sei das soziale Umfeld. Gruber verweist auf „silent complicity“, das stille Mitwissen und Schweigen. Gerade in ländlichen Regionen wie dem Vinschgau, wo die Studie durchgeführt wurde, schützen Dorfstrukturen häufig Täter oder verharmlosen Gewalt, während die Betroffenen allein bleiben. „Das zeigt, dass sexualisierte Gewalt kein privates Problem ist. Sie ist ein gesellschaftliches Phänomen, das von patriarchalen Normen und historischen Machtverhältnissen gestützt wird.“
-
Das Frauenmuseum greift TRACES auch in einer Ausstellung auf, die am 17. November eröffnet wird. Unter dem Titel „Meine Großmutter, meine Mutter und ich“ erzählt sie in einer fiktiven, aber auf Interviews basierenden Familiengeschichte von drei Frauengenerationen. Die Ausstellung sei bewusst traumasensibel gestaltet, zeigtehistorische Veränderungen, aber auch Kontinuitäten von Gewalt und Schweigen.
„Uns war wichtig, dass es nicht nur bei wissenschaftlichen Erkenntnissen bleibt“, so Gruber. „Frauen wollen, dass ihre Geschichten sichtbar werden und dass sich etwas verändert, in der Gesellschaft, in den Institutionen, in den Köpfen.“
-
Verantwortung und Widerstand
So unterschiedlich die Arbeitsfelder von Krasny und Gruber auch scheinen, ihre Verbindungslinien sind deutlich. Beide plädieren für eine Erweiterung des Verantwortungsbegriffs: Krasny in der kuratorischen Praxis, Gruber im Hinblick auf gesellschaftliche Strukturen, die Gewalt ermöglichen und Täter schützen. Beide machen sichtbar, dass feministische Strategien des Widerstands nicht nur auf individuelle Befreiung zielen, sondern auf strukturellen Wandel.
„Es ist eine kollektive Verantwortung.“
Am Ende steht die Frage, wie Museen, Forschung und Gesellschaft gemeinsam dazu beitragen können, Kontinuitäten von Gewalt und Unterdrückung zu durchbrechen. „Es ist wichtig zu verstehen, dass ich als Einzelperson das nicht lösen kann“, betont Gruber. „Es ist eine kollektive Verantwortung.“ Krasny spricht von einer Notwendigkeit, Sorgetragen und Solidarität als politische Kategorien ernst zu nehmen: „Feministische Erinnerungskultur ist kein abgeschlossenes Kapitel. Sie ist eine Aufgabe, die in die Zukunft weist.“
Damit wird die Konferenz im Frauenmuseum Meran nicht nur zu einem Ort des wissenschaftlichen Austauschs, sondern zu einem Resonanzraum für feministische Praxis.
-
More articles on this topic
Society | MUSEEintritt frei für Benachteiligte
Culture | AusstellungIm Kunstboot gegen Gewalt an Frauen



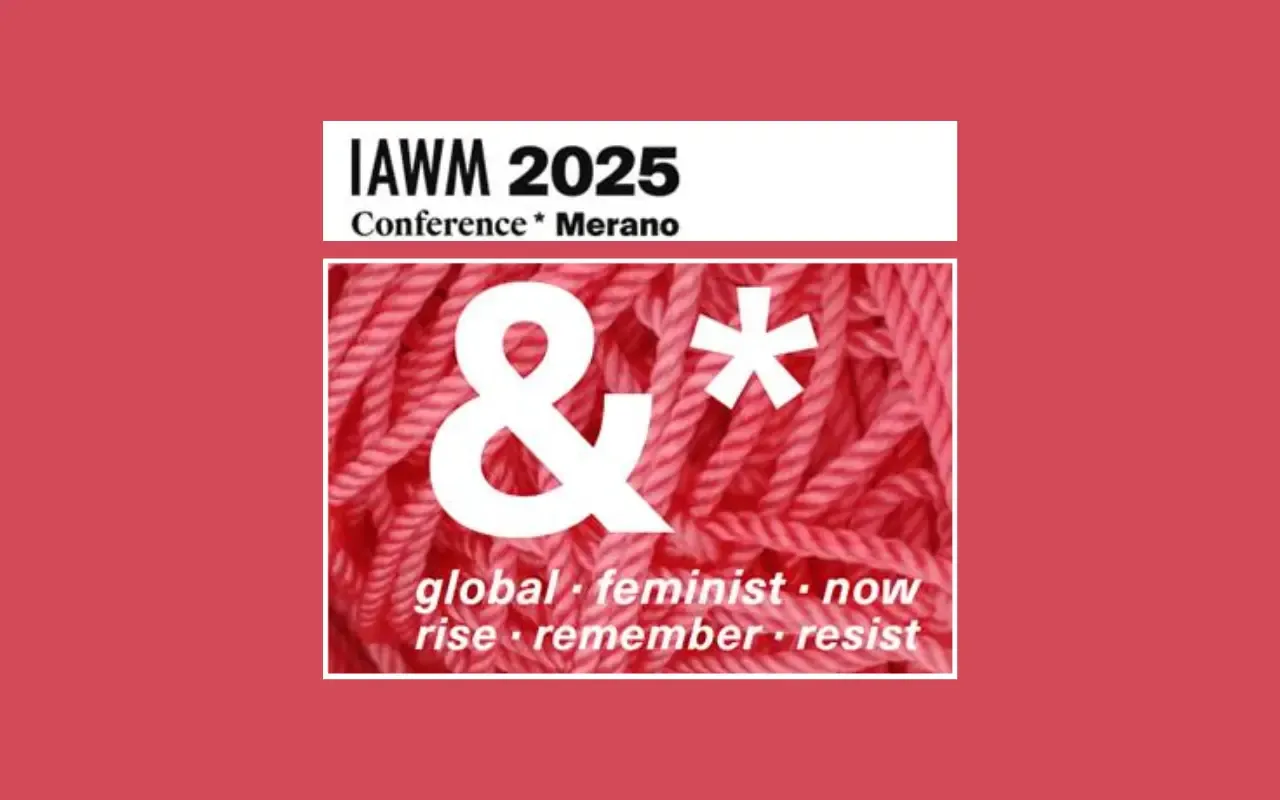


Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.