Bürgerwille & politische Kommunikation
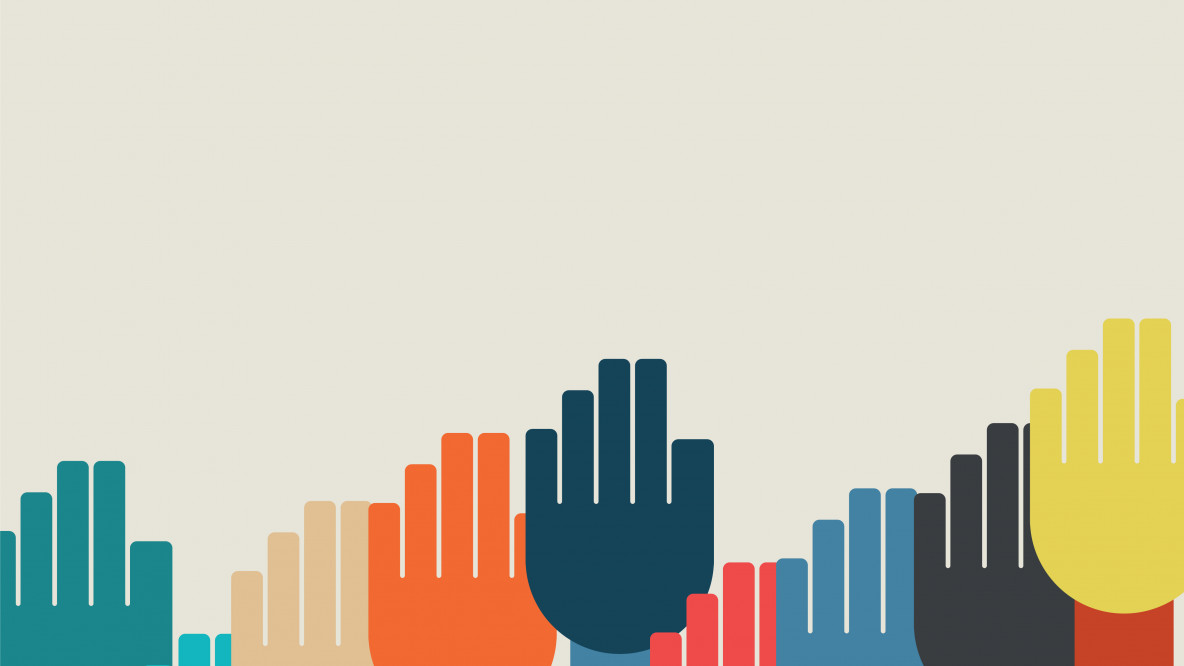
„Sind Sie für den Bau eines Gefängnisses in Ihrer Gemeinde?“
So lautete in etwa die Frage, über welche die Bürgerinnen und Bürger im schwäbischen Rottweil abstimmen durften. Das Ergebnis überrascht vielleicht: 60 Prozent stimmten im Herbst 2015 für das Gefängnis. Ein Einzelfall? Wohl kaum – denn direkte Demokratie gehört in Deutschland zur politischen Tagesordnung. Ob die Privatisierung der Stadtwerke in Augsburg (abgelehnt), ein Kirchenbau in Magdeburg (auch abgelehnt) oder ein IKEA bei München (zugestimmt) – die Menschen in Deutschland sind selbstbewusst und nehmen aktiv teil an politischen Entscheidungen. Ein spannendes Thema, zu dem ich als Wahl-Münchner und Kommunikationsberater vor wenigen Wochen bei der Jahresversammlung der Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft in Bozen referierte. Einen Abstract zu den wichtigsten Punkten möchte ich nun auf salto vorstellen.
Anders als in Südtirol gehört direkte Demokratie in den deutschen Städten und Gemeinden schon seit Jahren zum politischen Leben dazu. Die Bürgerinnen und Bürger wollen an politischen Entscheidungen teilnehmen, anstatt nur zuzusehen. Insbesondere dann, wenn es um Veränderungen in ihrer persönlichen Umgebung geht: was vor der eigenen Haustür passiert, bewegt und ruft Emotionen hervor. Und das ist gut so – denn eine repräsentative Demokratie benötigt die aktive Beteiligung von uns Bürgern als korrigierendes Element. Direkte Demokratie ist Sache der 16 Bundesländer, bundesweite Referenden gibt es hingegen nicht. Stellvertretend nun in aller Kürze das bayerische System.
Die Landesebene: Volksbegehren und Volksentscheide
Am Anfang eines Volksbegehrens stehen sehr viele Unterschriften. Für den Antrag sind zunächst 25.000 notwendig. Ist das Begehren zulässig, kommt die nächste Hürde. Innerhalb von 14 Tagen müssen nochmals 10 Prozent der Bürger unterschreiben (rund 960.000). Erst dann entscheidet die Staatsregierung, ob sie die Forderung entweder umsetzt oder einen Volksentscheid anordnet. In diesem Fall entscheidet die Mehrheit, ein Quorum gibt es nicht. Das bisher bekannteste Volksbegehren betrifft fast alle Bayern: Über 60 Prozent votierten 2010 für ein allgemeines Rauchverbot in Gaststätten. Deutlich mehr Unterschriften – insgesamt 85.000 kamen letztes Jahr gegen CETA zusammen. Allerdings ohne Folgen, denn für das Verfassungsgericht ist ein solches Volksbegehren nicht zulässig.
Die Gemeindeebene: Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
Das Prinzip ist sehr ähnlich. Zunächst müssen auch in diesem Fall Unterstützerunterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt werden – je nach Gemeindegröße zwischen 3 Prozent und 10 Prozent der Bürger. Sind die Unterschriften gültig und das Begehren zulässig, kann der Gemeinde- oder Stadtrat die Forderung per Beschluss übernehmen oder einen Bürgerentscheid ansetzen. Beim Entscheid gibt es allerdings ein Zustimmungsquorum zwischen 10 Prozent und 30 Prozent. In jedem Fall und unabhängig vom Wahlausgang gibt es eine einjährige Sperrfrist – erst danach kann das Thema von der Politik ggf. neu behandelt werden. Laut Gesetz können sich Bürgerbegehren mit nahezu allen Themen aus dem Kompetenzbereich der Kommune beschäftigen. Am häufigsten wollen die Bürger aber bei Vorhaben aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich mitreden. In einigen Bundesländern können sie sogar über die Besetzung vom Ämtern entscheiden. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Nach der Loveparade-Tragödie 2010 sprachen sich in einem Bürgerentscheid 85 Prozent für die Abwahl des amtierenden Duisburger Oberbürgermeisters aus. Seine politische Karriere war damit zu Ende.
In den letzten Jahren habe ich über 15 Dialogverfahren und Bürgerentscheide mit Bürgern, Unternehmen und Kommunen in Strategie und Kommunikation begleitet. Dabei habe ich die Regelungen zur direkten Demokratie in Bayern schätzen gelernt und bewundernswertes politisches Engagement der Bürger gesehen. Ich habe allerdings auch die Schattenseite kennengelernt.
Wutbürger und Quoren
Über die Notwendigkeit oder den Unsinn von Quoren für die Beteiligung oder Zustimmung bei Referenden haben wir auch in Bozen trefflich diskutiert. Der Idealzustand direkter Demokratie ohne jegliche Beteiligungshürden hört sich erst einmal sehr gut an: Alle Wähler sind vollständig aufgeklärt, objektiv informiert und können die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen ihrer Wahlentscheidung bewerten und nachvollziehen. Und wer nicht mitmacht und sich nicht am Referendum beteiligt, ist selber schuld. So einfach ist es aber nicht.
Den rein rational denkenden Wähler gibt es nicht, stattdessen sind Emotionen in Form des „Bauchgefühls“ meist spielentscheidend. Umso mehr, wenn es um Veränderungen im persönlichen Umfeld geht. Genauso wenig gibt es keine perfekt objektive Informationslage. Die allermeisten Medien sind in irgendeiner Form parteiisch, die Mehrheit der Bürger konsumiert keine große Bandbreite an unterschiedlichen Webportalen, Blogs oder Zeitungen. Hinzu kommt die Komplexität vieler Sachfragen, die nicht ohne weiteres auf eine einfache ja / nein Entscheidung komprimiert werden kann.
Leider ist es Fakt, dass die Beweggründe für ein Bürgerbegehren nicht immer „selbstlos“ oder im Sinne des Allgemeinwohles sind. Stattdessen kommt es vor, dass persönlicher Opportunismus oder ideologische Motive ausschlaggebend sind. Dann wird eine vermeintliche Relevanz für die „Allgemeinheit“ vorgeschoben.
Man kann an dieser Stelle nicht über direkte Demokratie in Deutschland sprechen ohne auf das Wutbürger-Phänomen einzugehen. Laut einer Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung handelt es sich dabei überwiegend um Männer ab 40, die mehrheitlich über einen akademischen Abschluss verfügen und sich in guten materiellen Lebensumständen befinden. So weit so gut. Was sie wütend macht, ist ihre Unzufriedenheit mit dem demokratischen System – eine Wut, die sich meist dann äußert, wenn vor ihrer Haustür eine neue Straße gebaut, eine Stromtrasse geplant oder ein Gewerbegebiet ausgewiesen wird. Oder ein Bahnhof wie Stuttgart 21. Ganz gemäß dem St.-Florians-Prinzip: Gute Idee, aber auf keinen Fall vor meiner Haustür.
Ich spreche hier natürlich nicht von Naturschützern oder direkt betroffenen Bürgern. Sondern von Menschen, die entweder aus purem Opportunismus oder aus einem ideologischen Reflex heraus handeln. Selbstverständlich müssen auch ihre Positionen und Argumente gehört und bewertet werden. Wenn direkte Demokratie aber hauptsächlich von solchen Bürgern gemacht wird, haben wir ein Problem.
Deshalb auch die Bedeutung von Beteiligungshürden. Direkte Demokratie muss immer das Ergebnis einer möglichst breiten Mehrheit sein. Und nicht bloß der Spiegel einer kleinen, aber gut organisierten und aktiven Minderheit. Vereinfacht gesagt: Je höher die Wahlbeteiligung, desto höher auch die Legitimation des Ergebnisses. Es gibt kein Anzeichen, dass die Quoren in Deutschland der direkten Demokratie geschadet hätten. Im Gegenteil: Seit 1956 gab es in den Kommunen der Bundesrepublik über 7.000 Bürgerbegehren, bei rund der Hälfte ist es auch zu einem Bürgerentscheid gekommen. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung beträgt im Übrigen rund 50 Prozent – die Quoren werden also in den allermeisten Fällen deutlich erreicht. Umso wichtiger ist es deshalb, eine Absicherung nach „unten“ zu haben, um etwa opportunistischen Wutbürgern oder populistischen Forderungen erst gar keine Chance zu geben. Diesen verantwortungsvollen Umgang ist man direkter Demokratie schuldig.
Ob die gültigen Hürden zu hoch oder zu niedrig sind, ist und bleibt eine spannende Frage. In München beispielsweise haben sich 2012 53 Prozent gegen den Bau einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen ausgesprochen. Bei einer Wahlbeteiligung von gerade einmal 32 Prozent waren das in Summe 175.000 Wählerinnen und Wähler – von insgesamt über einer Million Wahlberechtigten. Eine der Folgen: 2017 ist die Startbahnfrage in München lebendiger denn je.
Mehr und bessere Kommunikation
Direkte Demokratie als Bestandteil des politischen Lebens ist in Deutschland nicht so sehr eine Herausforderung für die Bürger, sondern vielmehr für Politik und Wirtschaft. Die Erfahrung hat mich gelehrt: Um mit dieser Situation auf Augenhöhe umzugehen, müssen Mandatsträger, Parteien, Verbände und Unternehmen deutlich mehr und noch viel besser als bisher kommunizieren. Zum Abschluss deshalb vier Learnings aus der Praxis. Vermeintlich logische Empfehlungen – die in der Realität aber meist ganz anders aussehen.
- Die Kommunalpolitik muss strategischer denken und handeln. Viele Projekte vergessen leider den Faktor „Bürger“ – und gehen deshalb zu Recht unter.
- Unternehmen und Politiker müssen Vorhaben frühzeitig, transparent und glaubwürdig kommunizieren. Denn wo es keine Fakten gibt, entstehen Gerüchte. Und die Bürger haben Anrecht auf volle Information.
- Doch mit Fakten macht man keine Politik. Ein Fehler, den besonders oft die Wirtschaft macht. Genauso müssen Emotionen, Betroffenheiten und Befindlichkeiten berücksichtigt werden.
- Projekte benötigen eine zielgruppenspezifische Kommunikation. Denn Anwohner, Betroffene, Mandatsträger und Unternehmen haben unterschiedliche Fragen und Interessenslagen.
Das Beispiel Deutschland zeigt: Gut funktionierende direkte Demokratie benötigt nicht nur engagierte Bürger – sondern auch eine mutige Politik und dialogbereite Unternehmen.
Sehr guter Artikel.
Sehr guter Artikel.
Ergänzend der Hinweis dass es in Deutschland KEIN bundesweites Instrument der direkten Demokratie gibt. Warum? Die Aushebelung der demokratischen Ordnung ab 1933.
In reply to Sehr guter Artikel. by Alfonse Zanardi
Vollkommen richtig. Wir
Vollkommen richtig. Wir dürfen übrigens gespannt sein: im Herbst ist schließlich Bundestagswahl, bis auf die CDU sind derzeit alle derzeitigen Fraktionen für die Einführung bundesweiter Referenden...