Lohnschere will sich nicht schließen
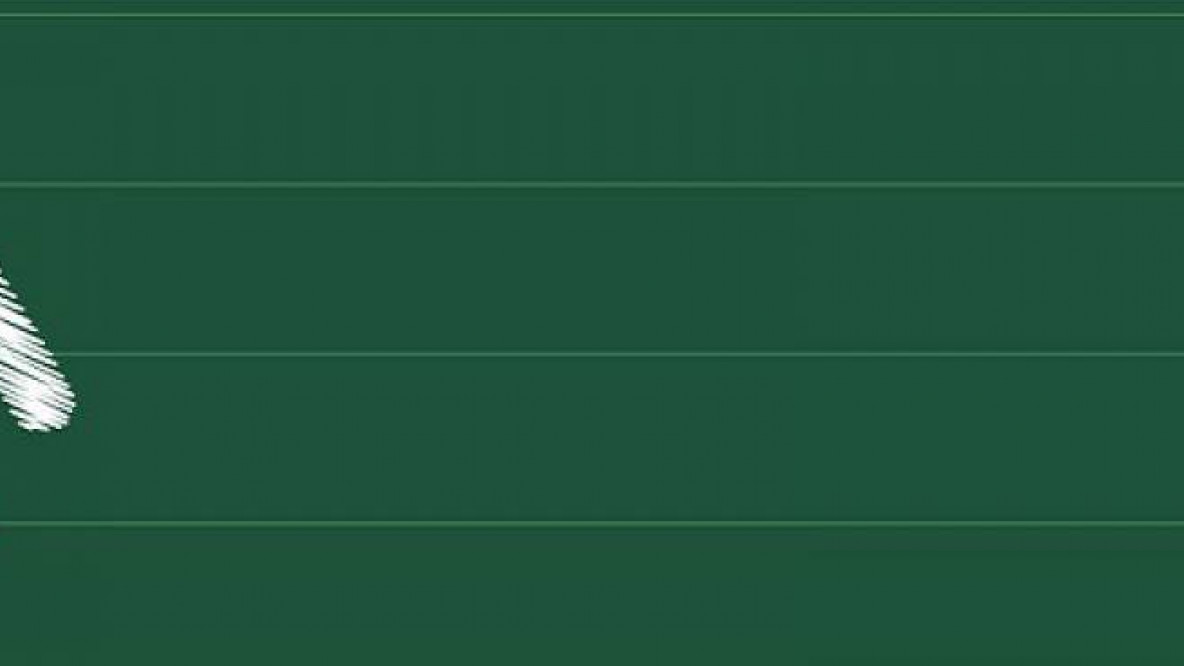
Laut dem vom österreichischen Rechnungshof vorgestellten Einkommensbericht ist die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen eklatant: Das Medianeinkommen von Frauen betrug 2013 61% von dem der Männer – und das ohne Lehrlinge. Der Median bezeichnet jenes Einkommen, das genau in der Mitte gereiht ist – sprich es gibt gleich viele Werte darunter und darüber. Auf die Frage hin, warum Frauen immer übermäßig stark in Teilzeit gingen, gaben über 40% Kinderbetreuung und Pflege als Grund an. Mehr als vier Fünftel der ganzjährig Teilzeitbeschäftigten sind Frauen.
Südtirol steht in dieser Frage besser dar: Laut Gender-Bericht des Astat ist das Einkommen von vollzeitarbeitenden Männern um 17,1% höher als jenes von vollzeitarbeitenden Frauen. Unter Teilzeitarbeitenden beträgt die Differenz immerhin noch 10,7%, wirft man beides in einen Topf, verdienen Frauen 29,6% weniger als Männer.
Aus der vom Arbeitsförderungsinstitut Anfang November veröffentlichten Studie unter dem Titel „Zwischen gläserner Decke und prekären Verträgen“ geht klar hervor, dass der Lohnunterschied bei Frauen vor allem in Führungspositionen noch höher ist als im Durchschnitt. Die Studie zeigt auf, dass das Gefälle gerade in Führungspositionen noch größer ist, dabei beschäftigt sie sich ausschließlich mit Unternehmen mit über 100 Mitarbeiter/innen. Michela Morandini, Gleichstellungsrätin und Co-Autorin der Studie, ist überzeugt, dass das Lohngefälle in Kleinbetrieben noch größer ist.
Es sei im Prinzip eine Dreierkonstellation, die sich nach vorne bewegen müsse: „Eines ist die politische Ebene. Hier geht es um gesetzliche Maßnahmen, um Quotenregelungen, um Teilzeitregelungen und ähnliches – wo auch in den letzten Jahren schon viel passiert ist. An zweiter Stelle steht dann die Unternehmenskultur, an dritter die Frauen selbst.“ In der Unternehmenskultur herrsche noch die Idee vor, dass acht Stunden am Tag an der Arbeitsstelle notwendig sind – währenddessen seien alternative Arbeitszeitmodelle möglich, machbar und vor allem notwendig. Die Frauen selbst, so Morandini, müssten selbstbewusster in die Gehaltsverhandlungen gehen: „Frauen, das zeigen unzählige Studien, verhandeln anders als Männer – nicht schlechter, nicht besser, aber anders.“ Dies führe aber unter anderem zu diesem Lohngefälle.
Unterstreichen will die Gleichstellungsrätin die Bedeutung von Vorbildern: „Frauen in Führungspositionen zeigen auf, was möglich ist und können Vorbild darin sein, wie Frauen für ihre Rechte und Pflichten einstehen.“ Diese Frauen gibt es – das besagt die AFI-Studie – quer durch alle Bereich und auch in für Frauen dem Klischee entsprechend untypischen Berufen. Was Morandini aber klarstellt: „Sehr oft wird behauptet, in Studien zum Lohngefälle würde Vollzeit- mit Teilzeitarbeit verglichen. Das ist falsch.“
Im Global Gender Gap Report von 2014 des World Economic Forum nimmt Italien Platz 69 ein – hinter Staaten wie Tansania (47), der Mongolei (42), Moldawien (25) und Burundi (17). Laut dem staatlichen Statistik-Institut Istat arbeiteten 2010 30% der arbeitenden Frauen in Teilzeit – bei Männern waren es rund 5%. Der Lohnunterschied zwischen den teilzeitbeschäftigten Männern und teilzeitbeschäftigten Frauen betrug 2010 20% - zu Ungunsten der Frauen.
Die erwähnte Studie des Arbeitsförderungsinstituts ist auf dessen Homepage einsehbar.
> Südtirol steht in dieser
> Südtirol steht in dieser Frage besser dar: Laut Gender-Bericht des Astat ist das Einkommen von vollzeitarbeitenden Männern um 17,1% höher als jenes von vollzeitarbeitenden Frauen. Unter Teilzeitarbeitenden beträgt die Differenz immerhin noch 10,7%, wirft man beides in einen Topf, verdienen Frauen 29,6% weniger als Männer. <
Wie kommt man auf 29,6% wenn man beides in einem Topf wirft? Das ist für mich nicht nachvollziebar. Wenn man beide Durchschnitte zusammenfassen möchte müsste ein Wert zwischen 10,7% und 17,1% herauskommen. (Je nach dem Verhältnis der teilzeitarbeitenden und vollzeitarbeitenden Personen)
Hat hier die Autorin diese 29,6% selbst zusammengebastelt oder wo kommen diese her? Bitte manchen Sie das nachvollziehbar!
Nebenbei ist der Vergleich von zwei Meridianeinkommen nicht geeignet die Einkommensunterschiede zwischen zwei Gruppen zu ermitteln. Das Meridianeinkommen ist, im Gegensatz zum arithmetischen Mittel besser geeignet ein Durchschnitteineinkommen einer Gruppe festzustellen und dabei Verzerrungen durch Ausläufer zu vermeiden. Der Vergleich zwischen zwei Meridianeinkommen zwischen Männern und Frauen ist nicht geeignet, weil beim Vergleich von Meridianeinkommen, kann es sein, dass genau an diesem Punkt sehr große Ungleichheiten bestehen, aber nicht im Rest des Spektrums. Wenn man das nicht genau analysiert ist diese Zahl nicht aussagekräftig. Was ist wenn sich rund um den Meridian sich überdurchschnittlich viele Frauen in Teilzeit gegenüber Männer befinden? Dann werden indirekt teilzeit arbeitende Frauen mit vollzeitarbeitende Männer verglichen.
Wenn man schon seriöse Zahlen haben will, dann sollte man entweder vergleichen wieviel Männer und Frauen innerhalb bestimmter Berufssparten pro h verdienen in den selben Positionen mit der selben Berufserfahrung.
Wenn man sonst noch eine intelligente Analyse machen möchte dann kann man feststellen ob Frauen über- bzw. unterrepresentiert sind in Spitzenpositionen. (Hier natürlich nur im Vergleich zu den Frauen, die in der Sparte arbeiten und eine bestimmte Anzahl von Dienstjahren erreicht haben).
Aber so kann ich das nicht wirklich ernst nehmen mit diesem Zahlengefrickle!
In risposta a > Südtirol steht in dieser di gorgias
Kann sein das du "Median"
Kann sein das du „Median“ nicht „Meridian“ meinst? Ansonsten stimme ich den Ausführungen zu, leider zeigt sich dass die simple Forderung der Lohngleichheit in Wirklichkeit und „ceteris paribus“, eine verdeckte monetäre Bevorteilung von Frauen darstellt. Daher täte man besser daran die Ursachen der Lohnschere (wirklich und nicht ideologisch) zu begreifen und Gegebenenfalls zu beseitigen, oder zu akzeptieren und im Rechenmodell zu berücksichtigen (Teilzeit etc.)
„Gegebenenfalls“ bedeutet fuer mich, sich so wenig wie möglich in die Lebensgestaltung und Entscheidungen von Personengruppen einzumischen.
In risposta a Kann sein das du "Median" di Roland Kofler
"Kann sein das du "Median"
„Kann sein das du “Median„ nicht “Meridian„ meinst?“
Ja :-)))
Ich finde es nicht gerade
Ich finde es nicht gerade transparent den Artikel zu ändern, ohne auf die Änderung hinzuweisen. Aber lassen wir das mal . . .
Ich habe nach der Zahl von 29,6% gesucht, konnte aber nichts finden, was sich auf Einkommensunterschiede zwischen Männer und Frauen bezieht. Für mich steht die Frage noch offen, wie es zu dieser Zahl kommt.
Bitte Frau Gasteiger klären Sie mich doch auf!
P.S. Was dem Gender-Gap angeht, gibt es anscheinend ein Mittel wie man diesen zu Gunsten der Frauen ändern kann. Anscheinend sind laut diesem SPIEGEL-Artikel forsche Frauen bei Gehaltverandlungen erfolgreicher als Männer mit der selben Haltung:
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/gehaltserhoehung-mann-oder-f…
Aber vieleicht wissen Frauen besser was ihnen gut tut, und tun gut daran nicht zuviel auf ideologisch verbrämte Feministinnen zu hören:
http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/studie-fuehrungsposit…
In risposta a Ich finde es nicht gerade di gorgias
Ich habe mir die AFI-Studie
Ich habe mir die AFI-Studie kurz angesehen und kann mir die 29,6% wie folgt erklären:
* Laut Studie arbeiten wesentlich mehr Frauen in Teilzeit, als Männer.
* Menschen mit Teilzeitarbeit verdienen weniger als mit Vollzeit (Annahme meinerseits, keine Ahnung ob dazu in der Studie etwas steht)
Damit ist es verständlich, dass das Gefälle zwischen den Medianen nicht zwischen 10% und 17% liegt, sondern durchaus auch außerhalb (konkret mit 29,6% noch wesentlich höher) liegen kann, da sich der Median des Einkommens nach Hinzunahme der Teilzeitarbeiter bei Frauen stärker nach unten bewegt, als bei den Männern.
Mit etwas statistischem Vorwissen ist die Zahl also leicht erklärbar. Leider wird dieses Wissen in unserer Schule immer noch nicht ausreichend vermittelt..
Wie genau Frau Gasteiger auf die 29,6% gekommen ist, konnte ich nach einem schnellen Blick auf die Studie auch nicht erkennen. Eine kurze Erklärung (oder genauer Verweiß auf die entsprechende Seite in der Studie) wäre hier sehr hilfreich gewesen. (Falls ich die Stelle in der Studie nur übersehen habe, nehme ich die letzten zwei Sätze zurück)
In risposta a Ich habe mir die AFI-Studie di HAM STER
Das wäre durchaus möglich.
Das wäre durchaus möglich. Aber als ich diesen Satz gelesen habe „wirft man beides in einen Topf, verdienen Frauen 29,6% weniger als Männer. “ war es für mich kontraintuitv es so zu interpretieren, weil so Vollzeiteinkommen und Teilzeiteinkommen direkt verglichen werden und so ein Gepansche ist für mich ein Witz, oder besser gesagt ein Zeichen dass viele Akademiker beim Umgang mit Zahlen funktionale Analphabeten sind, weil sonst muss man sich schämen so einen verzerrenden Stumpfsinn zu verbreiten.
Meines Erachtens sollte man den Stundenlohn von Frauen und Männern in der selben Branche vergleichen und die Vertretung in Spitzenpositionen im Verhältnis zum Anteil der Frauen in einer bestimmten Branche, aber die Lohnschere darf sich ja nicht schließen und mit so einem herumgepansche kommt man auf die fast 30%.
Ich behaupte mal aus meinem persönlichen Eindruck, dass sich stetig vieles in die richtige Richtung entwickelt und sehe mich dabei glaubwürdiger als jemand der Zahlen präsentiert an denen so stümperhaft herumgeschraubt wurde.
In risposta a Das wäre durchaus möglich. di gorgias
Die gemeinsame Interpretation
Die gemeinsame Interpretation ist sicherlich fragwürdig. Hätte die Autorin allerdings die Unterscheidung in Teil- und Vollzeit gar nicht angeführt, wären die 29,6% vollkommen korrekt.
Geht man in die Richtung und möchte einen vollständigeren Vergleich der Gehälter, wäre auch die Verwendung des Medians des Stundenlohns nicht 100% repräsentativ, da z.B. Berufserfahrung, Ausbildung, Fähigkeitsniveau ignoriert werden. Und sogar wenn diese zusätzlichen Einteilungen vorgenommen würden, wäre zum Schluss die Auswertung der Studie so zersplittert, dass man gar nichts mehr sieht.
Womit die prinzipielle Unsinnigkeit solcher Studien aufgezeigt wird. Es ist nahezu unmöglich sie so zu präsentieren, dass objektiv der Sachverhalt wiedergegeben wird und gleichzeitig übersichtlich zu bleiben.
Andererseits sind sie das einzige Mittel um eine immerhin halbwegs objektive Darstellung der Zustände zu ermöglichen (auch mit statistischen Mittel kann zwar pink zu rosa, aber nur sehr schwer zu blau werden).
Kurz gesagt: die Darstellung der Daten hätte besser sein können (mir gefällt der Ansatz direkt den Stundenlohn zu verwenden), zeigt aber trotzdem auf, dass ein Ungleichgewicht herrscht.. Und das war wohl das Kernergebnis der Studie/-aussage dieses Berichts.
geht es hier nicht viel mehr
geht es hier nicht viel mehr um ein problem von rollenbildern und familienpolitik? die diskriminierungen, die hier angeführt werden - teilzeitarbeit wegen kinderbetreuung und pflege sowie niedriglohnbranchen - betreffen ja die (zugegebenermassen wenigen) männer die wegen der kinder in teilzeit gehen bzw. in niedriglohnbranchen sog. frauenberufe arbeiten (z.b. erzieher etc.). wenn ich die bericht richtig analysiere, dann bleibt der gender gap der sich rein auf das geschlecht bezieht bei ca. 10-15%, dazu kommt die (ungerechte) gläserne decke zu den hohen einkommen bei führungspositionen.
Ich habe jetzt Marita
Ich habe jetzt Marita Gasteiger einige Zeit gelassen auf die Fragestellungen zu antworten. Bis jetzt ist es aber dazu nicht gekommen.
Ich finde es schade dass es Menschen gibt, die so ideologisch verstockt sind, dass Sie, wenn sie etwas in der eigenen Position in Frage stellen müssten lieber verstummen und mauern anstatt in einem Dialog zu treten.
So werden Medien wie salto nicht in ihrem Potenzial wahrgenommen, sondern zu einem reinen Verkündigungskanal degradiert.
In risposta a Ich habe jetzt Marita di gorgias
Ein Verkündigungskanal der
Ein Verkündigungskanal der anscheinend nur von wenigen Frauen genützt/gelesen wird, denn ich sehe auf salto außerhalb der Redaktion nur 2-3 Frauen kommentieren, die m.W. eine ähnliche Fokusierung wie die Autorin hier haben. Es fehlen also andere weibliche Meinungen und Stimmen. Immer nur diesselben männlichen Kontrageber ist auch langweilig, fast schon wünsche ich mir einen Button der gewisse Themen ausblenden lässt („ich wünsche das nicht mehr zu sehen“) ;-)
Hier, für die
Hier, für die Verschwörungstheoretiker und die Gelangweilten: Mal eine andere weibliche Stimme: http://www.sueddeutsche.de/karriere/gehaltsgefaelle-zwischen-maennern-u…
In risposta a Hier, für die di Sylvia Rier
Finde auch, dass die Politik
Finde auch, dass die Politik lieber das Modell „beide Teilzeit“ fördern sollte, statt „beide Vollzeit + Kinderkrippe für die Kleinen“. Leider auch bei uns nicht der Fall.
In risposta a Hier, für die di Sylvia Rier
Ich finde es als derangiert,
Ich finde es als derangiert, die hier bis jetzt stattgefundene Diskussion als Produkt von Verschwörungstheoretikern und Gelangweilten zu Ettikettieren. Wenn man schon mit Zahlen kommt, dann sollen Sie doch bitte auch Sinn ergeben und wenn man Einkommen von Teilzeitarbeitende und Vollzeitarbeitende zusammenfasst, um Sie zu Vergleichen und um bestimmte Zahlen zu Produzieren ist das in keinster Form seriös und redlich und verschleiert die eigentlich Sachverhalte.
Wenn der Staat etwas gegen den gender gap mit gesetzlich verankertes Rückkehrrecht in Vollzeit unterstützen will, so dass Frauen wieder leichter in die Vollzeit finden, bzw. für Männer die Hemmschwelle herabsetzen eine Aus- und/oder Teilzeit für die Kinderbetreuung zu nehmen, würde ich das übrigens sehr begrüßen. Auf solche Ideen kommt man aber nicht, wenn man in halb verschleierter Form Teilzeiteinkommen mit Vollzeiteinkommen vergleicht, wie das die oben genannte Studie tut.
P.S. Ich glaube nicht dass Martin B. Sie zu den „anderen weiblichen Stimmen“ zählt, sondern eher zu den 2 - 3, die sich zu dem Thema melden. - Was Sie aber wiederum nicht abhalten soll sich an der Diskussion zu beteiligen.
In risposta a Ich finde es als derangiert, di gorgias
Ich glaube auch nicht, dass
Ich glaube auch nicht, dass Martin B. mich zu den „anderen weiblichen Stimmen“ zählt. Ich selbst tue das übrigens auch nicht, sondern dachte an die Autorin des verlinkten Textes. Vielleicht hätte ich das besser ausführen sollen... Was den Rest Ihres Kommentars angeht, werden Sie zugeben (müssen), dass das viel praktizierte Leugnen, die Nicht-Anerkennung und das Kleinreden der Gehaltsunterschiede die Diskussion (auch) nicht wirklich weiterbringt, genauso wenig wie das Herumdoktern an den Zahlen und der Frage, ob’s ein Prozentpunkt mehr oder weniger ist, ob’s der Durchschnitt sein darf oder doch der Median sein soll. Tatsache ist: Die Unterschiede bestehen, und das ist einer modernen Gesellschaft nicht würdig, ihrem Fortschritt und Wachstum kein bisschen förderlich.
In risposta a Ich glaube auch nicht, dass di Sylvia Rier
Hier geht es am Ende nicht um
Hier geht es am Ende nicht um ein Prozentpunkt mehr oder weniger. Es macht einen großen Unterschied ob es sich um 10% oder um 30% handelt. Übrigens ist das dann nicht kleinreden sondern einmal die Tatsachen bestimmen. Nebenbei möchte ich einmal diese Zahlen sehen, die Branche, Position und Berufserfahrung auch berücksichtigen und Ungleichheiten aufzeigen.
Dann sollte man auch sorgfältigen Ursachenanalyse betreiben, an was es liegen kann. Ist es Diskriminierung am Arbeitsplatz oder sind es Verhalten die Frauen an Tage legen?
Wenn Frauen gut verhandeln können sie anscheinend sogar mehr herausholen als Männer: http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/gehaltserhoehung-mann-oder-f…
Natürlich erklärt das nicht alles, aber ein Aspekt könnte das sicher sein. Und wenn sie den Unterschied schon als Tatsache hinstellen, belegen Sie diesen mal mit sauberen Zahlen.
In risposta a Hier geht es am Ende nicht um di gorgias
Nö. Ich habe, ehrlich gesagt,
Nö. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Lust, a) immer das Gleiche zu wiederholen und b) an diesen oder anderen Zahlen herum zu werkeln, nicht nur, weil ich grundsätzlich nicht viel von ihrer Aussagekraft halte, noch weniger, wenn sie als Statistik verkleidet daher kommen. (Auch diese) Zahlen sind letztlich nichts anderes als der Ausdruck einer gesellschaftlichen Schieflage (die es zu begradigen gilt) und ich bleibe dabei, dass es in diesem Sinne nachrangig bis irrelevant ist, wie hoch der jeweilige Prozentsatz ist und dass es jedenfalls weder der „Diskussion“ noch der Sache dienlich ist, sich an der Frage, ob’s denn nun 10, 20 oder 30 Prozent sind, abzuarbeiten. Aber ich habe gestern einen interessanten Text gelesen, der die Problematik (vielleicht, wer mag) erklären hilft und Lösungsansätze aufzeigt.http://derstandard.at/2000010125574/Was-Frauen-Karrieren-bremst
In risposta a Nö. Ich habe, ehrlich gesagt, di Sylvia Rier
Naja wenn Sie Zahlen nicht in
Naja wenn Sie Zahlen nicht in Statistiken verarbeiten können Sie auch keine Aussagekraft haben,dann bleibt die Behauptung dass Frauen weniger verdienen als Männer bzw. für die selbe Leistung nicht den selben Lohn erhalten kaum mehr als eine „gefühlte Tatsache“.
In risposta a Nö. Ich habe, ehrlich gesagt, di Sylvia Rier
"Während 43 Prozent der
„Während 43 Prozent der Berufsanfängerinnen den Aufstieg ins Topmanagement planen, haben fünf Jahre später nur noch 16 Prozent diesen Ehrgeiz. Dagegen starten 34 Prozent der Männer [...] und sind nach mehreren Jahren noch genauso zuversichtlich“
Für mich bedeutet Topmanagement die Spitze einer Firma. Gefühlt max 15% der Mitarbeiter finden darin Platz.
Also würde ich den Artikel so lesen, dass Frauen utopischer starten, dann aber realistisch werden. Männer hingegen sind so stur/blöd/optimistisch/ehrgeizig, dass sie nicht erkennen, dass nicht für alle ein Platz an der Spitze sein wird.
Und warum man den Anteil von 43% bei den Frauen halten sollte, gleichzeitig aber nicht die Rede ist, dass der Anteil der ehrgeizigen Männer ja anscheinend zu niedrig ist und damit sofort gesteigert werden muss, kann ich auch nicht verstehen..
In risposta a Ich glaube auch nicht, dass di Sylvia Rier
tatsache ist (mannigfaltige)
tatsache ist (mannigfaltige) unterschiede bestehen und trotzdem oder vielleicht auch deswegen gibt es fortschritt und wachstum. ich glaube mich richtig zu erinnern, dass die forderung des feminismus in den 70er jahren lautete: „gleicher lohn für gleiche arbeit“. den finde ich richtig, den unterstütze ich und überall dort, wo er nicht eingehalten wird ist dies ein skandal. auch unterstütze ich die forderung einer gleichen teilhabe u.a. an führungs- und entscheidungspositionen genauso wie eine faire aufteilung der familienlasten. wenn ich aber nun mit etwas unzufrieden bin und beginne etwas (sehr komplexes wie geschlechtsspezifische lohn- bzw. einkommenverhältnisse auf nationaler bzw. internationaler ebene) zu analysieren (mittels sozialwissenschaftlicher methoden) um erkenntnisse zu gewinnen wo und wie ich veränderung herbeiführen kann und dabei auf eine vielzahl von faktoren und interpretationsmöglichkeiten stosse, ist es ein bisschen billig am ende zu sagen die zahlen und die begriffe sind eigentlich nicht so wichtig. wofür nämlich? für lösungen oder um sich gegenseitig was vorzuwerfen?
In risposta a tatsache ist (mannigfaltige) di Michael Bockhorni
Bravo, dieses Statement
Bravo, dieses Statement unterstütze ich voll!