Es braucht ein neues Frauenhaus

-
Seit 25 Jahren begleitet das Gewaltschutzzentrum GEA Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Heute, am 18. September 2025, feierte die Genossenschaft GEA ihr 25-jähriges Bestehen. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Land, Gemeinde und Justiz waren gekommen, um gemeinsam Bilanz zu ziehen und den Blick nach vorne zu richten.
-
Fast 4.000 Frauen in 25 Jahren
Seit der Gründung wurden 3.955 Frauen begleitet, die meisten von ihnen mit Kindern. Die Zahl der Hilfesuchenden sei kontinuierlich gestiegen und habe in den vergangenen vier Jahren sogar exponentiell zugenommen. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 verzeichnete das Zentrum bereits 151 Erstkontakte. Parallel dazu steigt auch der Bedarf an geschützten Wohnungen.
„Viele gaben sich selbst die Schuld und schwiegen.“
Gabriella Kustatscher, eine der Mitbegründerinnen und ehemalige Präsidentin von GEA, nahm die Anwesenden mit auf eine „Reise in die Vergangenheit“.
Mitte der 1980er-Jahre begannen Frauen unterschiedlicher politischer und sozialer Hintergründen, sich für ein Frauenhaus starkzumachen. 1984 wurde erstmals die gesetzliche Grundlage zur Errichtung von Frauenhäusern geschaffen. „Es war ein extremes Bedürfnis da. Damals war Gewalt an Frauen ein Tabuthema, viele gaben sich selbst die Schuld und schwiegen“, erinnerte sich Kustatscher.
-
1988 wurde die erste Vereinigung von Frauen gegen Gewalt gegründet, 1989, fünf Jahre nach dem ersten Vorschlag, wurde das Landesgesetz verabschiedet - nach vielen Diskussionen und Verzögerungen. 1997 konnte in Meran ein provisorischer Standort eingerichtet werden, im Januar 1998 öffnete das erste Frauenhaus schließlich offiziell.
„Noch immer fehlt uns ein richtiges, funktionales Haus.“
Der Weg dorthin war voller Hürden. „Wir arbeiten seit 25 Jahren, und noch immer fehlt uns ein richtiges, funktionales Haus. Das schmerzt“, sagte Kustatscher sichtlich bewegt. Ihre Worte machten deutlich, dass der Kampf für sichere Räume für Frauen und Kinder auch heute noch nicht abgeschlossen ist.
-
Die aktuelle Präsidentin Christine Clignon belegte den dringenden Bedarf mit Zahlen. Im Jahr 2024 suchten 95 Frauen gemeinsam mit 91 Kindern Schutz im Frauenhaus. „Wir dürfen nicht vergessen, dass rund 80 Prozent der Frauen Kinder haben“, betont Clignon. Doch nur 23 Frauen und 19 Kinder konnten aufgenommen werden. „Die große Frage bleibt: Was passiert mit den anderen Frauen?“
Häufig greife man auf bestehende Beherbergungsstrukturen zurück und stehe in engem Austausch mit anderen Frauenhäusern in Südtirol. Dennoch sei die Situation problematisch: 30 Prozent der Frauen, die um Aufnahme angesucht hatten, meldeten sich anschließend nicht mehr.
Der Stellvertretende Staatsanwalt Igor Secco ergänzte die Perspektive der Justiz und wies auf die steigende Zahl an Verfahren im Rahmen des „Codice Rosso“ hin. 2022 wurden in Südtirol 661, 2023 insgesamt 879 und im Jahr 2024 912 Verfahren eröffnet.
Besonders Fälle psychischer und ökonomischer Gewalt hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Rund 30 Prozent der Verfahren würden eingestellt, häufig weil Betroffene ihre Anzeige zurückzögen oder die Beweise nicht ausreichten. „Ob der Anstieg darauf zurückzuführen ist, dass Frauen heute mehr anzeigen, oder ob die Gewalt tatsächlich zunimmt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Sicher ist nur: das Problem ist groß und komplex“, so Secco.
„Wir hoffen sehr, dass das aktuelle Projekt tatsächlich geheim bleibt. Vertraulichkeit ist unverzichtbar, um Frauen und Kinder schützen zu können.“
Um die Sicherheit der Betroffenen zu gewährleisten, seien die Geheimhaltung von Adressen und vertrauliche Strukturen entscheidend. Auch aktuell werde am Projekt eines neuen Frauenhauses gearbeitet. „Wir hoffen sehr, dass das aktuelle Projekt tatsächlich geheim bleibt. Vertraulichkeit ist unverzichtbar, um Frauen und Kinder schützen zu können“, unterstreicht Clignon.
-
Das Netzwerk zwischen Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren in Südtirol sei bereits stark, trotzdem bleibe die Herausforderung groß. Durch zunehmende Sensibilisierung und Präventionsarbeit steige das Bewusstsein in der Gesellschaft. „Es wagen immer mehr Frauen den Schritt, eine Gewaltsituation zu verlassen“, ist Clignon überzeugt. Aufgabe der Gesellschaft und der Institutionen sei es nun, diesen Frauen gerecht zu werden.
„Wir sind stolz auf jede einzelne Frau, die diesen Kraftakt geschafft hat.“
Trotz aller Schwierigkeiten war die Feier auch ein Moment des Stolzes. „Das Herzstück unserer Arbeit ist die Begleitung beim Ausstieg. Wir sind stolz auf jede einzelne Frau, die diesen Kraftakt geschafft hat und nun frei und selbstbestimmt leben kann“, betonte Clignon.
Kustatscher schloss mit einem emotionalen Appell: „Wir haben nie an Wunder geglaubt. Aber wir wissen, dass die Welt ein kleines Stück besser wird, wenn jede und jeder das Seine beiträgt.“
Die Hoffnung auf ein neues, sicheres Haus in Bozen zog sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Die 25-jährige Geschichte von GEA ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft.
-
Kontakte für betroffene Frauen:
Antigewaltstelle GEA - grüne Nummer (0-24h): 800 276 433
Haus der geschützten Wohnungen - grüne Nummer: 800 892 828
-
More articles on this topic
Society | FemizideSchutzimpfung gegen Gewalt
Society | Tutela delle donneViolenza, incontro tra Gea e Carabinieri
Society | GesellschaftBozen will die Frauen schützen
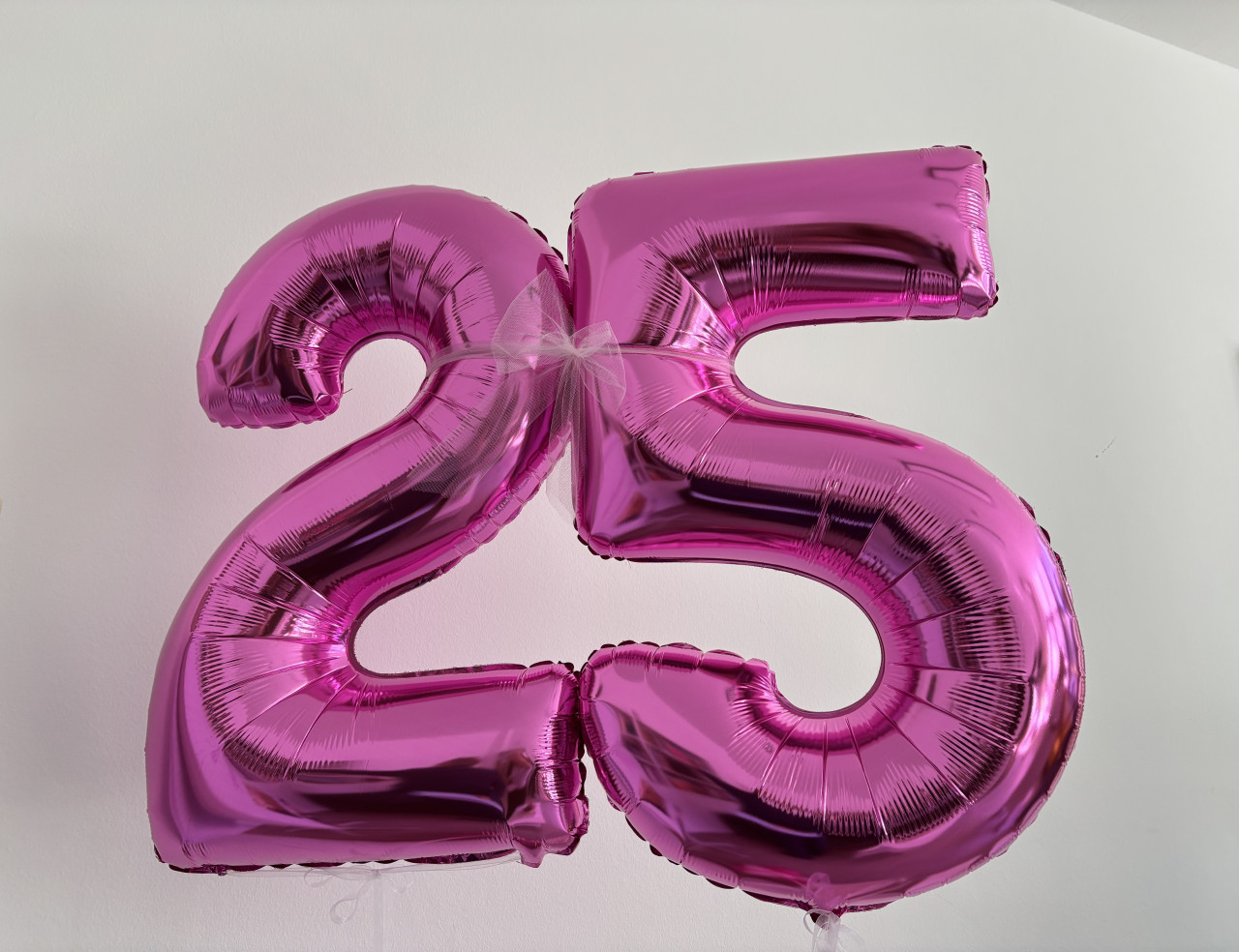





Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.