Schweizer Geheimnis

-
Als die Walliser Bundesrätin Viola Amherd Mitte März im schweizerischen Parlament ihre Abschiedsrede hielt, widmete sie sich der Frage, was denn die politische Schweiz ausmache. Dazu erzählte sie dem Parlament eine Geschichte: „Ich war spätabends allein im Dunkeln zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Da rannte plötzlich ein Jogger auf mich zu, machte abrupt halt vor mir und rief meinen Namen. Ich erschrak und dachte, was will der wohl jetzt, worauf er bemerkte: „Sie machen einen super Job, aber bei der nächsten Abstimmung stimme ich trotzdem Nein.“ Es ging damals um die Abstimmung über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Ich war erleichtert und dachte: Puh, wenn es nur das ist, dann geht es ja noch.
Die Folgerung Amherds aus dieser Begegnung: „Die Schweiz ist ein Land, in dem die Bevölkerung Anteil nimmt an der Politik und auch direkt mit einer Bundesrätin in Kontakt treten kann – praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit, sogar frisch verschwitzt. Politikerinnen und Politiker sind nicht eine eigene ‚Klasse‘, sondern ein Teil der Bevölkerung. Ein Zug fährt einem Bundesrat mit derselben Pünktlichkeit vor der Nase davon wie jedem anderen Bürger auch.“
Doch da war Viola Amherd fast etwas zu bescheiden. Denn „Anteil an der Politik“ nimmt beispielsweise ganz gewiss auch das italienische Volk. Aber vor allem und abgesehen vom Wahltag fast ausschließlich vor dem Fernseher, als Zuschauer, oder am Radio als Zuhörer, genauso wie es Anteil nimmt am Schicksal der Ferraristi an einem Rennen in Monza oder an der Diva in der Oper auf der Bühne der Mailänder Scala: passiv, zusehend und – zumindest was die Politik betrifft – (vor Graus) sich mehr und mehr abwendend.
Die Schweizerinnen und Schweizer wagen mehr Demokratie als die meisten anderen Europäer.
-
In der Schweiz empfinden sich die Bürgerinnen und Bürger nicht als Zuschauer und Zuhörerinnen der Politik. Sie wissen, dass sie selber auf der Bühne stehen. Sie tun mehr als die Wahl der Akteure auf der Bühne. Immer wieder, genauer gesagt, vier Mal jährlich in meist etwa zehn Angelegenheiten nationaler, regionaler und kommunaler Art, besteigen sie selber die Bühne und entscheiden direkt mit. Die Schweizerinnen und Schweizer überlassen die Gestaltung unserer gemeinsamen Existenz nicht einigen wenigen Auserwählten. Sie übernehmen sie selber. Darin liegt der kleine aber schwerwiegende Unterschied. Das macht das Besondere der schweizerischen politischen Ordnung aus. Die Schweizerinnen und Schweizer wagen mehr Demokratie als die meisten anderen Europäer.
Schwerwiegend ist dieser kleine Unterschied deswegen, weil er die Statik der politischen Ordnung, das Wesen der Demokratie, total verändert. Der Schweizer Bürger steht nicht an der Seitenlinie. Er sitzt nicht im Zuschauerraum. Er ist nicht ein Objekt der Politik, sondern ihr Subjekt. Er entscheidet zusammen mit allen anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Ausrichtung der Politik ebenso wie über die Geschwindigkeit der Veränderungen. Der Bürger ist das Zentrum. Quelle der Macht ebenso wie deren wichtigster Autor und Adressat.
Die Bürgerinnen und Bürger haben über jede Veränderung oder Ergänzung der Bundesverfassung das letzte Wort.
Demokratietheoretisch bedeutet dies eine vielfach geteilte und fein verteilte Macht. Bürgerinnen und Bürger delegieren anlässlich der Wahl ihres Parlamentes nicht einfach alle ihre Macht an das Parlament und an die durch das Parlament gewählte Regierung. Sie behalten auch nach der Wahl ein Stück der Macht bei sich. So haben sie über jede Veränderung oder Ergänzung der Bundesverfassung das letzte Wort; ohne Zustimmung der Mehrheit der Bürgerinnen lässt sich in der Schweiz die Bundesverfassung nicht verändern. Sie behalten sich auch das Recht vor, über im Parlament verabschiedete Gesetze zu entscheiden; das Parlament weiß also nie, ob es ein von ihm beschlossenes Gesetz nicht doch noch vor dem Volk verteidigen muss; denn es ist nie sicher, dass nicht doch noch ein Teil des Volkes mit einem „Referendum“ nachfragt und über das Gesetz mitentscheiden möchte.Dieses Damoklesschwert schwebt ständig über dem Bundeshaus. Es schafft eine ganz andere Beziehung der Parlamentarier (und der Bundesräte) zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die Politiker wissen, dass sie immer wieder auf die Unterstützung und Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind. Das macht sie viel demütiger, offener und zugänglicher als in jenen Ländern, in denen sie sich erst wieder bei der nächsten Wahl auch wieder an die Bürgerinnen und Bürger wenden müssen.
Die Stärke der Schweizer Bürger gegenüber dem Parlament spiegelt sich auch in der Stärke des Parlamentes gegenüber der Regierung. Und selbst innerhalb der relativ kleinen Regierung – die Schweizer Regierung umfasst seit 1848 jeweils nur sieben Minister – sind die Hierarchien flach. Das heißt, alle Minister sind gleich mächtig. Keiner, auch der jeweils für ein Jahr vom Parlament gewählte „Ministerpräsident“ (in der Schweiz Bundespräsident genannt) nicht, kann einen Kollegen „entlassen“, oder hat wie in Deutschland die „Richtlinien-Kompetenz“ inne, gleichsam das letzte Wort. Das letzte Wort hat in der Schweiz meist „das Volk“, die Bürgerinnen und Bürger.
In der Schweiz ist die Macht so vielfältig geteilt, dass niemand, kein einzelner Mensch und keine einzige Institution so viel Macht hat, dass sie nicht immer wieder auch lernen muss.
Zur ausgesprochen geringen Fallhöhe der Macht, zur berühmten mehrfachen – vertikalen wie horizontalen – „Teilung der Macht“, trägt in der Schweiz auch der Bruder der Direkten Demokratie bei, der noch ältere Föderalismus. Die Kantone, die Gliedstaaten der schweizerischen Eidgenossenschaft, haben im Bund eine sehr große Autonomie. Auch sie haben nach wie vor viel Kompetenz bei sich behalten und nicht alle Macht an den Bund delegiert. Das ist historisch bedingt. In der Schweiz gab es im Unterschied zu fast allen europäischen Staaten nie einen nationalen Adel, eine absolutistische Monarchie und somit auch nie eine starke Zentralgewalt. Der Bund wurde „von unten hinauf“ gebaut. Kantone und Bürger waren 1848 die Baumeister des Bundes und blieben die wichtigsten Bauingenieure. „Der Staat“ ist bis heute ein Titel, den die Kantone für sich beanspruchen; die Eidgenossenschaft ist bloß „der Bund“...
Ein berühmter deutsch-amerikanischer Politikwissenschafter vertrat schon vor 50 Jahren die These, wonach einem die Macht das zweifelhafte Privileg verschaffe, nicht mehr lernen zu müssen. In der Schweiz ist die Macht so vielfältig geteilt, dass niemand, kein einzelner Mensch und keine einzige Institution so viel Macht hat, dass sie nicht immer wieder auch lernen muss. Die Macht ist vielmehr so gut verteilt, dass keiner dem anderen etwas befehlen kann; er kann nur versuchen, den anderen zu überzeugen. Das heißt, man muss viel mehr diskutieren, deliberieren, nachdenken, sich um die Verständigung bemühen, offen sein allen anderen gegenüber, immer bereit, sich vom besseren Argument überzeugen zu lassen und zu lernen. Mehr kann man von einer Regierung eigentlich nicht verlangen.Andreas Gross ist Politikwissenschaftler, Historiker und Urheber zahlreicher eidgenössischer Volksinitiativen. Nationale Bekanntheit erlangte Gross als Mitbegründer der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee.
Hier geht`s zu: KulturelementeWeitere Artikel zum Thema
Kultur | GastinterviewDer Mut, Neuland zu betreten
Kultur | InklusionDort, wo die Welt passiert
Kultur | Kleider machen LeuteNennt sie nicht „Lumpen“!


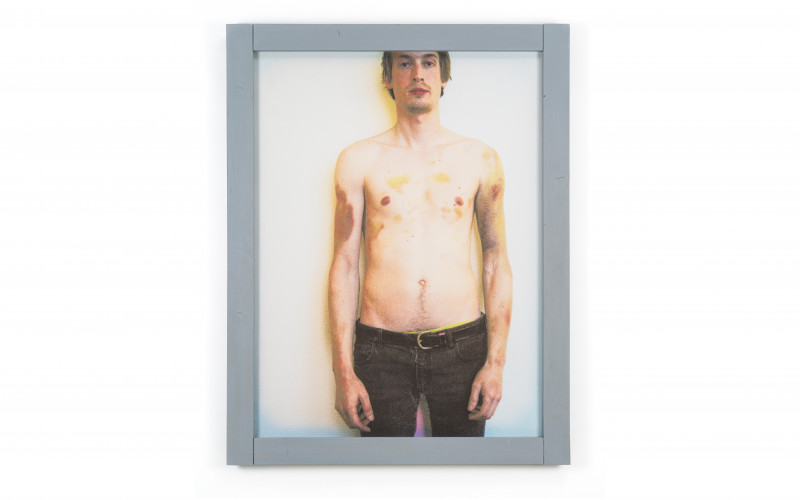


Klingt einfach grossartig!…
Klingt einfach grossartig!
Ich nehm dazu nochmal das Buch von Franziska Schutzbach zur Hand, welche zu rechtspopulistischer Rhetorik forscht, auch Schweizerin ist und sagt:
"Gerade die Schweiz ist ein Exempel für den Erfolg rechtspopulistischer Agitation und erwiesenermassen ein Vorbild für zahlreiche AkteurInnen der westlichen Welt."
auf Seite 30 (link)beschreibt Schaubach das " Schweizer Modell":
https://www.franziskaschutzbach.com/die-rhetorik-der-rechten
Eine Leseeinladung.
- auch weil sich viele rechtspopulistischen Diskurse länder - und akteurInnenübergreifend beobachten lassen.
Antwort auf Klingt einfach grossartig!… von Herta Abram
Da fällt mir gleich Blocher…
Da fällt mir gleich Blocher und seine SVP ein. Diese Art Rechtspopulismus hat auch weit in den deutschsprachigen Raum gestrahlt.
Abgesehen davon, dass sich …
Abgesehen davon, dass sich -UNSRIGEN- viel zu reichlich -s e l b e r- füttern, leben -s i e- in der Gewissheit in allen Fällen die einzig richtige Meinung zu haben!