HELL NO

-
Der Universalkünstler Andrè Heller beginnt seinen Vortrag mit dem Nachäffen eines Tschechen. „Viel Arbeit, wenig Geld,“ sagt er in osteuropäischem Akzent und als ihm jemand das Mikro einschaltet, sagt er noch: „Oh, jetzt wird es kompliziert.“ So beginnt am 30. Januar im Gemeinderat Brixen die Abstimmung eines 14-Millionen-Euro-Projekts, und kompliziert wird’s dann erstmal nicht und um wenig Geld geht’s schon mal gar nicht. Heller sagt Dinge wie: „Ich habe mich in den arabischen Ländern in die Gräser verliebt, die erzählen Geschichten“, dass der „Garten ein Ort werden soll, wo Junge und Alte auszittern können“ (was auch immer das heißt) und wo außerdem an „jeder dritten Ecke Unvorstellbares lauert“. Die Kalendersprüche des Künstlers holen die Politiker:innen-Mehrheit (SVP, Fratelli, PD) emotional ab, man ist begeistert, nur einmal entgleiten Ferretti (SVP) die Gesichtszüge und Heller fragt nach, ob er ihn „auslache oder anlache.“ Die Opposition sitzt fassungslos bis belustigt aufm Hocker und kriegt keine Antworten auf ihre zahlreichen Fragen, zumal der Businessplan, das Verkehrskonzept und die halbe Finanzierung noch fehlen und die Einblicke in die gartentechnischen Details klingen wie damals, als man unvorbereitet in Kunst geprüft wurde und sich irgendwas aus den Fingern saugen musste: Die Wege würden „mal schmäler, mal breiter“ werden, außerdem „mal höher und mal tiefer“, das Wort „Wasserlauf“ muss dem Universalkünstler eingeflüstert werden. Unten auf der Powerpoint steht sicherheitshalber: „Pflanzen + Kunstwerke = botanisches Gedicht“, damit sich alle Anwesenden der lyrischen Tiefe der Sache bewusst werden.
-
Etwas konkreter wird Heller in Sachen Baumkunst und erklärt den Anwesenden, dass im besagten Gras „merkwürdige Köpfe“ aka lustig frisierte (Maulbeer)Bäume stehen werden. Außerdem wird er wie immer ein Labyrinth anpflanzen, wo „man sich verlieren soll“, um in der Mitte dann auf „einen Wunschbrunnen“ zu treffen, dort könne man sich etwas wünschen (zum Beispiel dass die beste Freundin einen Besuchsslot vor dem nächsten Touristenbus bekommt). Rührende Dinge hätten sich die Menschen am „Wunschbaum“, der in einem anderen seiner Labyrinthe steht, schon gewünscht, wie etwa, „dass die Stöffl Gerlinde sich in einen verliebt“. Die netten Ideen, die man von den Kindern der naheliegenden Grundschule Tschurtschenthaler möglicherweise um deutlich weniger Geld hätte haben können, stoßen bei der SVP auf Euphorie, man findet es „gelungen bis paradiesisch“. Dass die Bepflanzung eher nicht arabisch sein wird, erfahren wir dann noch von der Technikerin Helga Salchegger, die erfrischend sachlich und ohne Kitschphrasen die eigentliche Arbeit machen darf und immer wieder inhaltlich übernehmen muss. Später darf noch ein Hellerscher Fanboy reden, der offensichtlich weniger wegen seiner kunsthistorischen Expertise engagiert wurde, sondern um den Meister, die „Marke Heller“, starstruck in den Himmel zu loben. Ab und zu bringt Heller mit spontanen Eingebungen Leben in den Vortrag, „Viele junge Menschen, die das sehen, werden Gärtner werden wollen“, ruft er einmal erfreut aus oder erzählt aus seiner Kindheit in Wien und hustet laut ins Mikro, um den Provinzpolitiker:innen zu demonstrieren, wie übel die Keuchhustenkinder damals im Palmenhaus abgehustet haben. Man merkt schnell: Der Mann ist jeden Cent wert.
Ein Garten, der nicht frei zugänglich ist, verliert seine soziale Funktion als Treffpunkt, als Ort der Erholung und des zufälligen Miteinanders.
Jeden Cent der 1,3 Millionen, die er dafür einsteckt. Dabei ist der „Gartenkünstler“ mit seinen pathetischen Gemeinplätzen noch nicht mal das Hauptproblem an der Sache. Denn der Kirschbaum im Hofburggarten wird dann so oder so blühen und uns faszinieren – egal ob er uns 100, 1.000 oder 100.000 Euro gekostet hat und irgendein schnulziges Liebesgedicht daneben steht. Und gewiss ist es Geschmacksache, ob einem die Baumfrisuren gefallen oder nicht und wenn einer im Hofburggarten sitzt und das Gras reden hört, ohne dass er welches geraucht hat – ben venga! Das Problem ist nämlich gar nicht so sehr, was Heller drinnen veranstaltet, sondern dass viele draußen bleiben müssen: Das Grundkonzept des Gartens als geschlossenes Areal für zahlendes Klientel ist der eigentliche Kritikpunkt des Millionenprojekts. „Auszittern“ werden im Garten nämlich in erster Linie die sächsischen Silver Ager und die piemontesischen Pensionist:innen – und nicht die steuerzahlenden Südtiroler:innen. „Aber für die Brixner:innen soll es ganz wenig kosten, vielleicht wird es sogar gratis“, sagt die SVP an jenem 30. Januar wieder und es bleibt unklar, ob sie nun wirklich noch immer nicht verstanden hat, was der Unterschied zwischen öffentlichen und geschlossenen städtischen Grünflächen ist oder ob sie nur so tut als ob. Ein Garten, der nicht frei zugänglich ist – egal ob der Eintritt 5, 15 oder 50 Euro ist – verliert seine soziale Funktion als Treffpunkt, als Ort der Erholung und des zufälligen Miteinanders. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass geschlossene oder kostenpflichtige Gärten den Zugang der Bevölkerung einschränken und die sozialen und gesundheitlichen Vorteile von öffentlichen Grünflächen für die Bevölkerung vermindern.
Wunschbrunnen oder Behindertentransport, sozialer Wohnraum oder arabisches Gras, wir können nicht alles haben. Dafür haben wir aber unsere Politiker:innen, die verantwortungsvoll entscheiden, wie sie den Haushalt einsetzen.
Konkret heißt das: In diesem Garten werden wir nicht unsere Mittagsbowl im Schatten eines auffrisierten Maulbeerbaums essen – die Zugangsbeschränkungen verändern nämlich sowohl Niederschwelligkeit als auch Aufenthaltsqualität erheblich und so gerne wird man dann auch nicht von norddeutschen Bustourist:innen angestarrt, während man am Selleriestick kaut. In diesem Garten werden wir nicht mit unserer Freundin aus Sterzing kurz mal eine Runde drehen, weil sie nämlich die „Brixencard“ (oder was auch immer sie für eine Karte erfinden müssen) nicht hat und extra zahlen muss. In diesem Garten werden die Studierenden von der Uni nebenan, die keinen Campus haben, nicht zum Slacklinen oder Pauken gehen – weil die allerwenigsten sind von Brixen und einer hat immer keine Karte. In diesem geschlossenen Garten werden wir nicht mal eben eine Stunde Wartezeit bis zum nächsten Zug mit einem Buch überbrücken, uns nicht spontan in einer ruhigen Ecke zum Stillen zurückziehen, uns nicht die Schuhe ausziehen und zwischen Steuererklärung und Wocheneinkauf kurz die Füße in die Sonne halten. Der Garten ist nicht für uns, obwohl wir dafür zahlen werden – und es zahlen übrigens alle Südtiroler:innen, ganze 80 Prozent zahlen die Vinschgauer:innen, die Pustertaler:innen und die Bozner:innen mit. Gelder, die für Sozialausgaben dann nicht zur Verfügung stehen, aber man muss eben priorisieren! Wunschbrunnen oder Behindertentransport, sozialer Wohnraum oder arabisches Gras, wir können nicht alles haben. Dafür haben wir aber unsere Politiker:innen, die verantwortungsvoll entscheiden, wie sie den Haushalt einsetzen. Und nicht nur mit Geld, sondern auch mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, verstopften Straßen, schlechter Luft, weiter ansteigenden Wohnraumpreisen und einer schlechteren Lebensqualität werden wir dafür zahlen, dass endlich mal wer Gras nach Südtirol bringt.
Denn das wird in dieser Gemeinderatsitzung nun mehr als deutlich: Die Illusion eines „Garten für alle“ kann die SVP nicht länger aufrechterhalten. Während Paula Bacher sich zwar noch immer naiv unterm Kirschbaum watten sieht, redet Sarah Dejakum (die bis Januar in Leitungsfunktion für das Hotel „My Arbor“ gearbeitet hat) von einem „Exzellenzprojekt für den Tourismus“ und einer „Pilgerstätte für Augenmenschen“. Das ist pathetisch für: alles voller Influencer:innen und wenige werden daran verdienen. Die SVP rechnet mit mindestens 100.000 bis 105.000 Besucher:innen, die jährlich im Garten auszittern und dem Gras zuhören und damit kämen dann bei 23.000 Einwohner:innen fünf Tourist:innen auf jede:n Brixner Bürger:in. Mit Hellers „Kunst“ wird das Zentrum der Kleinstadt zur Kulisse eines auslaufenden Tourismusverständnisses.
-
Die Wortmeldungen der Gemeindepolitiker:innen am 30. Januar zeigen jedenfalls auf, was für ein genialer demokratischer und qualitätssichernder Kniff die Sache mit den öffentlichen Wettbewerben ist. Wettbewerb ist das, wo Expert:innen, die vom Fach sind, über ein riesiges Millionenprojekt entscheiden, das die gesamte Dynamik, das Verkehrsaufkommen, das Zusammenleben und die Freizeitgestaltung einer Kleinstadt beeinflussen wird – und eben nicht die Bettina, der Andi und der Gerold, die untertags durchwegs ehrbar Geschirr verkaufen, Möbel verhökern und Tabellen formatieren, aber halt eben nicht (Landschafts)Architektur studiert haben. So einen Wettbewerb hat es bereits unter Bürgermeister Pürgstaller für den Hofburggarten gegeben und das coole Siegerprojekt hat die Hälfte gekostet, aber die SVP hat das Ding versenkt und wenn Paula Bacher jetzt sagt, dass die Verzögerungen der Kritiker:innen zu Teuerungen führen, möchte man wirklich irgendwohin zum Auszittern gehen. Denn hätte die SVP nicht den Hellerschen Geniestreich gehabt und den Wettbewerb versenkt, wäre das Siegerprojekt längst umgesetzt und wir würden alle schon seit Jahren um sehr viel weniger Geld im Hofburggarten in der Sonne sitzen. Am 30. Jänner geht das Vorprojekt jetzt aber wie erwartet durch – die Opposition hat zwar die Argumente auf ihrer Seite, aber die Mehrheit, gestellt von SVP, Fratelli und PD, hat, nun ja, die Mehrheit. Und unten auf der Straße singt derweil der Beschwerdechor, der ebenso ungehört bleibt wie 3.000 Brixner Unterschriften oder die Appelle des Direktors der bayerischen Bundesgärten und anderer Expert:innen.
Sie können Ihre Bowl auch irgendwo anders essen.
Am nächsten Tag komme ich in der letzten Dreiviertelstunde zur Informationsveranstaltung im Forum Brixen und stelle mich zunächst zu einem Grüppchen, wo eine Frau aus Hellers Büro es nicht schafft, die Anwesenden von der Aufenthaltsqualität der militärisch angeordneten Bäumen zu überzeugen. Ich versuche mit den Gemeinderäten Siller und Leitner ins Gespräch zu kommen, klappt aber leider nicht, weil sie vor mir weglaufen. Also wörtlich: Sie laufen aus dem Raum. Tja, für 14 Millionen kann man halt nicht alles verlangen, also zum Beispiel, dass die Verantwortlichen Rede und Antwort stehen. Zuvor erwische ich aber noch die Architektin der Gemeinde (Heller ist auch kein Architekt und muss deshalb nach italienischem Gesetz hiesige finden, die seine Dinge umsetzen und unterschreiben). Als ich ihr sage „Ich würde gern meine Mittagsbowl im Garten essen“, antwortet sie: „Sie können Ihre Bowl auch woanders essen.“ Kann ich, muss ich dann aber trotzdem für den Wunschbrunnen zahlen? Ja. Die Südtiroler Neuauflage von Marie Antoinettes „Dann sollen sie doch Kuchen essen“ in der Variante „dann sollen sie ihre Bowls halt woanders essen“ fasst treffsicher zusammen, wofür der Hofburggarten und die zugehörige Politik des Prunks und der Überheblichkeit stehen: Das größte Stück vom Kuchen bekommen in unserem Land die zahlenden Gäste und die lobbystarken Wirtschaftseliten, während die, die die Zeche mit ihrem Steuergeld und Lebensraum dafür zahlen müssen, ihre Suppe woanders auslöffeln dürfen.
-
Link zum Video der Gemeinderatssitzung (Aufzeichnung des Livestreams):
https://www.youtube.com/live/r2EKNVJ4NQQ
( Leider ist das Video nach dem Veröffentlichen des Artikels auf privat gestellt worden )
Der Vortrag von André Heller beginnt bei Minute 54:40.
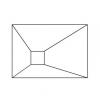


Guter Artikel, weiß nicht ob…
Guter Artikel, weiß nicht ob ihr da was machen könnt aber das verlinkte Video der Gemeinderatssitzung ist leider auf privat gestellt und somit nicht zum nachschauen verfügbar.
Vielen Dank, Barbara Plagg,…
Vielen Dank, Barbara Plagg, für diesen informativen und zeitgleich sprachlich erfrischenden Artikel. Vielen Dank für Ihr Engagement.
@Salto:
Ungern erwähnt man zusätzlich die orthografische Korrektheit des längeren Textes. Aber in Anbetracht dessen, dass Salto in der kurzen Anmerkung zum Video im Textkästchen am Ende des Artikels gleich mehrere Fehler wieder unterbringt, fällt sowas besonders auf.
südtirol hat einfach zuviel…
südtirol hat einfach zuviel geld! und kann somit seine minderwertigkeitskomplexe durch absurde mega.projekte kompensieren. schade.