Wozu Deutsch lernen...

-
Die Forderung nach einer Immersionsschule in mehrsprachigen Regionen ist unter den aktuellen Gegebenheiten wenig zielführend. Eine ernsthafte Förderung des Zweit- und Drittsprachenerwerbs an den Schulen wäre dagegen machbar.
In klassischen Einwanderungsländern wie den USA gilt der Immersionsunterricht als Erfolgsmodell für einen raschen und sicheren Spracherwerb. Doch in Regionen wie Aosta oder Südtirol, wo seit langer Zeit verschiedene Sprachgruppen mit- sowie nebeneinanderkoexistieren, ist dies ein kontroverses Thema. Hier wird Immersionsunterricht nämlich als bilingualer Sachunterricht interpretiert. Diese Forderung stößt in Südtirol mit drei Sprachgruppen und geschützten Sprachminderheiten nicht auf ungeteilte Zustimmung. Im Schulhof und in den Klassenzimmern herrscht in Zeiten kultureller Begegnungen zwar Mehrsprachigkeit, doch bleibt die Frage ungelöst, wie der Sprachunterricht effektiver gestaltet werden könnte. Betrachten wir einige empirische linguistische Erkenntnisse zur Theorie des Sprachenerwerbs.
In Regionen mit zwei oder mehreren anerkannten Sprachgruppen (Südtirol, Korsika, Baskenland u.a.) trifft das Modell des Immersionsunterrichts auf unerwartete Hindernisse, die bereits beim Zweitsprachenerwerb beginnen. Der Hauptgrund liegt darin begründet, dass Immersionsunterricht hier als bi- oder trilingualer Fachunterricht verstanden wird. In den meisten mehrsprachigen Regionen gibt es bisher keine solche Schulen. Selbst Staaten wie Luxemburg oder die Schweiz kennen keinen regulären synchronen Immersionsunterricht.
In Aosta und Südtirol gibt es hierzu jahrzehntelange Erfahrungswerte. An den deutschsprachigen Schulen Südtirols wird während der gesamten Dauer der Schulzeit, meist bis zur allgemeinen Hochschulreife, die italienische Sprache als Zweitsprache unterrichtet, während der Fachunterricht auf Deutsch stattfindet. Vice versa wird auch an italienischsprachigen Schulen die deutsche Sprache nur als Sprache unterrichtet. Die Ergebnisse sind durchwachsen, die Zweitsprachenkenntnisse durchaus geringer, als es 13 Schuljahre vermuten lassen. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig.
Zum einen leben in Südtirol drei anerkannte Sprachgruppen, die untereinander relativ homogen sind und häufig nebeneinander koexistieren, nicht aber miteinander. Es herrscht – mit Ausnahme der Ladiner – ein gewisser Grad an kultureller Segregation. Der Erwerb einer Zweitsprache in der Schule gestaltet sich jedoch komplexer, wenn es sich um homogene Sprachgruppen handelt, die keine Vorkenntnisse der anderen Sprache haben. Die Schüler*innen verspüren darüber hinaus oft keine Notwendigkeit, die andere Sprache auch im Alltag oder unter Freunden zu verwenden.
Eine Ausnahme bilden Individuen und Gruppen, die aus eigenem Antrieb heraus eine Fremdsprache lernen wollen. Diese Idealsituation, die Notwendigkeit des Fremdsprachenerwerbs anzuerkennen, ist im Regelschulbetrieb selten der Fall und lässt sich häufiger bei Einwandererkindern beobachten als bei den angestammten Sprachgruppen. Im Alltag der beiden Sprachgruppen wären hingegen unterstützende Maßnahmen – sowohl in Theorie als auch in Praxis – notwendig, etwa: den vorschulischen Spracherwerb oder den regelmäßigen Kontakt zur anderen Sprachgruppe zu fördern. -
Empirische Erfahrungswerte
Im Südtiroler Modell sind sprachgruppenspezifische Unterschiede festzustellen. Die Erfahrungswerte belegen, dass die deutschsprachigen Schüler*innen, vor allem in den Städten, nach ihrer Schulzeit die italienische Sprache grundlegend beherrschen, das Niveau schwankt dabei zwischen elementarer und relativ selbständiger bis kompetenter Sprachanwendung. Dagegen beherrschen viele der italienischsprachigen Schüler*innen, welche ausschließlich italienische Schulen besucht haben, die deutsche Sprache nach 13 Unterrichtsjahren auf mehrheitlich elementarem Niveau oder gar nicht.
Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen. Da wären erstens die systeminhärenten Unterschiede: Wiewohl Italienisch ab B1-Niveau eine zunehmend komplexe Morphologie und Semantik, präzise Zeitformapplikationen usw. aufweist, ist die Einstiegsschwelle niedriger. So erscheint Italienisch gerade zu Beginn einfacher zu erlernen als das Deutsche, welches als synthetisch fusionale Sprache von Anfang an eine komplexe morphologische Struktur mit drei Genera, zahlreichen Komposita, Deklinationen und Ausnahmen aufweist.
Zweitens gibt es geospezifische Unterschiede; diese betreffen die Praxis: Im Alltag der deutschsprachigen Schüler*innen, vor allem in den Städten, ist die regelmäßige Verwendung des Italienischen nicht unüblich. Umgekehrt ist dies nur bedingt der Fall. Zudem wird das Deutsche im Alltag in seiner dialektalen Form gebraucht, auch dies kann sich demotivierend auf Lernende auswirken. In einem monologischen Umfeld lernen homogene Gruppen ohne weiteres die Landessprache als Zweitsprache, etwa die türkische Bevölkerung in Wien, weil sie die Landessprache Deutsch im Alltag beherrschen müssen oder sollten. In mehrsprachigen Regionen wie Südtirol ist dies jedoch weder für die eine noch für die andere Sprachgruppe zwingend notwendig.
Der Immersionsunterricht kann also unter bestimmten Bedingungen sehr erfolgreich sein. Dagegen bräuchte es in einer mehrsprachigen Region mit relativ in sich geschlossenen Sprachgruppen viel eher gezielte Maßnahmen zum Spracherwerb. Ein aufoktroyierter Immersionsunterricht dagegen könnte eine erstrebenswerte schulische Wissensvermittlung nicht gewährleisten, sondern würde Nachteile für beide Sprachgruppen mit sich bringen. Es hieße, Schüler*innen ohne Vorkenntnisse der anderen Sprache in einer bilingualen Schule zusammenzuführen. Das Unterrichtsniveau würde zunächst für alle merklich sinken und kann auch nicht so schnell wieder aufgeholt werden. Ein sinnvoller Fachunterricht kann in dieser Situation ohne nachweisliche Grundkenntnisse aller unterrichteten Sprachen nicht stattfinden; vor allem dann nicht, wenn seitens der Lernenden keine bewusste Entscheidung, ja nicht einmal ein Bewusstsein über die Notwendigkeit des Erlernens der Zweitsprache vorliegt. Ein geflügeltes Wort unter Schüler*innen und Eltern ist: „Wozu Deutsch lernen, wenn ich später nur Englisch brauche?“ So wird seit kurzem auch die noch unrealistischere Forderung nach einer trilingualen Schule laut, die Englisch in den Fachunterricht miteinschließt. Eine weitere, politisch brisante Forderung lautet, Englisch miteinzuschließen und dafür die jeweils andere Zweitsprache fallenzulassen. -
Linguistische Theorien des Spracherwerbs
Die offensichtlichste Maßnahme für eine bessere Mehrsprachigkeit in der Region wäre die Förderung des frühkindlichen Aufbaus von Sprachgrundlagen der Zweitsprache, die sich letztlich auch positiv auf den Erwerb aller weiteren Sprachen auswirkt, ohne die Erstsprache bzw. muttersprachliche Kompetenz zu verwässern (siehe im Folgenden Chomsky). Der Spracherwerb würde dabei bereits im Kindergarten oder noch früher erfolgen. In diesem frühen Alter können Kinder spielerisch an eine zweite Sprache herangeführt werden und sie gewissermaßen wie eine Erstsprache aufnehmen (daher C2, nicht L2 wie bei Erwachsenen genannt).
-
Critical Period Hypothesis
Die 1959 von Penfield und Roberts aus der Biologie abgeleitete und 1967 von Lenneberg ergänzte Critical Period Hypothesis besagt, dass die Fähigkeit zum Spracherwerb mit dem biologischen Alter des Lernenden zusammenhängt. Das Erlernen einer zweiten Sprache in vollumfänglicher muttersprachlicher Kompetenz ist dieser Hypothese zufolge ausschließlich in der Wachstumsphase von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter möglich. Sie stützt sich dabei auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass zum Beispiel Menschen, die ihre sprachlichen Fähigkeiten durch einen Unfall verloren haben, diese nur vor der Pubertät, bis ins Alter von etwa zwölf Jahren, vollständig wiedererlangen können. Der Unterschied zwischen Kindern (C2) und Erwachsenen (L2) in ihren Sprachlernprozessen („Language Acquisition Device“ – LAD) sind bemerkenswert. Der kindliche Spracherwerb ist in der Lage, muttersprachliche Kompetenzen zu erreichen.
Die Critical Period Hypothese ist heute umstritten. Studien belegen, dass Erwachsene beim Erlernen einer anderen Sprache gute Erfolge erzielen können. Dennoch sind Erwachsene empirischen Studien zufolge äußerst selten in der Lage, grammatikalische – oder gar in der Aussprache – muttersprachliche Kompetenz zu erreichen. Sie erlernen komplexe Sprachstrukturen und große Wortschätze, in der Aussprache erreichen sie aber dennoch oft keine Fluidität oder muttersprachliche Aussprache; sie übersetzen oft hin und her und können Fehler auf diese Weise nicht ausmerzen. Erwachsene stützen sich auf ihre bereits entwickelten kognitiven und analytischen Fähigkeiten, um eine neue Sprache zu lernen – auch dies eindrucksvoll dargelegt in den betreffenden Theorien des Sprachwissenschaftlers Noam Chomsky. -
Von Prinzipien und Parametern
Chomsky ging – als Koryphäe der generativen Transformationsgrammatik – zunächst davon aus, dass ein angeborenes Vorwissen Grundlage des Spracherwerbs sein muss, weil ein Spracherwerb allein durch das Hören und die Einflüsse seiner Umwelt nicht möglich wäre. Nehmen wir den alten Disput: Wir werden geboren als tabula rasa, jedoch im Sinne Leibniz' mit Betonung auf der Existenz einer tabula, darin sich das Wissen einprägen kann. Chomsky spricht dagegen von einer Plattform. Demzufolge kann ein Kind eine zweite Sprache ebenso gut erlernen wie die erste. Es ist dazu in der Lage, eine Universalgrammatik aufzunehmen, unabhängig von der spezifischen Sprache seiner Sprachgruppe. Später spricht Chomsky in der Prinzipien-und Parameter-Theorie von universellen Strukturprinzipien, die sich in jeder Sprache auf andere Weise manifestieren können. Sie werden Chomsky zufolge durch eine Anzahl von Parametern ergänzt, Optionen, die dem Kind im Verlauf der kontinuierlichen sprachlichen Eingaben aus seiner Umgebung zum Spracherwerb zur Verfügung stehen. Man könnte sich dies als einen vielteiligen Bausatz aus sprachenunabhängigen Grammatikmodulen als Spielsteine vorstellen, aus dem das Kind auswählen kann.
Doch irgendwann steht – wie beim Spiel – ein Gerüst. Dieser Teil ist nun belegt und das Bauen wird substanzieller. Der Fremdsprachenerwerb im Erwachsenenalter stößt hier also auf ein substanzielles Hindernis, nämlich das Gerüst, das bereits dasteht. Man könnte auch sagen: Alte Gewohnheiten stehen dem Erlernen neuer Gewohnheiten im Weg. So wehren sich besonders ältere Menschen gegen Rechtschreibreformen. Chomskys Theorieansatz ist heute Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung, etwa vonseiten der Gebrauchsbasierten Linguistik (Usage-based Linguistics), doch selbst neue Ansätze bleiben dabei, dass vor allem Kinder muttersprachliche Kompetenz in Ausdruck und Grammatik erreichen. -
Resümee
Der erfolgversprechendste Spracherwerb findet also zwischen dem zweiten Lebensjahr und dem Ende der Pubertät statt, wobei gilt: je früher, desto größer die grammatikalische Kompetenz. Die kognitive Prägung bedeutet nun nicht, dass man im Erwachsenenalter keine Fremdsprachen lernen kann, jedoch bedarf es eines wesentlich größeren Aufwandes bei geringerem Erfolg. Die Entwicklung der Sprache ist zuallererst ein neuroanatomischer Prozess: Im frühkindlichen Stadium ist noch alles offen, danach wird Sprache – mit all ihren intellektuellen, logischen und analytischen Ausformungen – zunehmend verortet und fixiert. Empirischen sprachwissenschaftlichen Studien zufolge macht es bereits einen Unterschied, ob ein Kind die zweite (auch dritte und vierte) Sprache in den ersten Lebensjahren erwirbt, oder erst im Verlauf des Grundschulalters oder noch später damit beginnt. Hinzu kommt, dass das Grundschulkind in unserem Bildungssystem mit seinem linearen und oft forcierten Frontalunterricht einen inneren Widerstand gegen die Zweitsprache aufbaut.
Dies alles sollte zu konkreten bildungspolitischen Maßnahmen führen, welche den frühkindlichen Zweitsprachenerwerb fördern, um so zu einer kompetenteren C2-Sprachanwendung zu gelangen. Dies würde garantieren, dass Schüler*innen in Bezug auf die C2-Sprache sowie weitere Fremdsprachen nach 13 Schuljahren auf einem höheren Niveau als jenem der elementaren Sprachanwendung stehen. Ein übereilt implementierter Immersionsunterricht ohne vorhergehende Maßnahmen hätte hier – wie oben dargelegt – keinerlei positive Effekte, er würde das Bildungsniveau insgesamt nach unten ziehen und allein dazu dienen, eine der Sprachgruppen zu dezimieren, wie in Aosta geschehen.
Einen „Vorteil“ in dem bisherigen System haben Angehörige dritter Gruppen, etwa Einwandererkinder und Ladiner*innen, die den Zweit- und Fremdspracherwerb für notwendig erachten und oftmals nach Abschluss der 13 Schuljahre eine höhere Sprachkompetenz in anderen Sprachen aufweisen als so manche Angehörige der zwei anerkannten Sprachgruppen. -
Mehr zu Kulturelemente
-
Articoli correlati
Kultur | Kleider machen LeuteNennt sie nicht „Lumpen“!
Kultur | SALTO WeekendDaten und Forschung
Bücher | Salto booksNonturismo



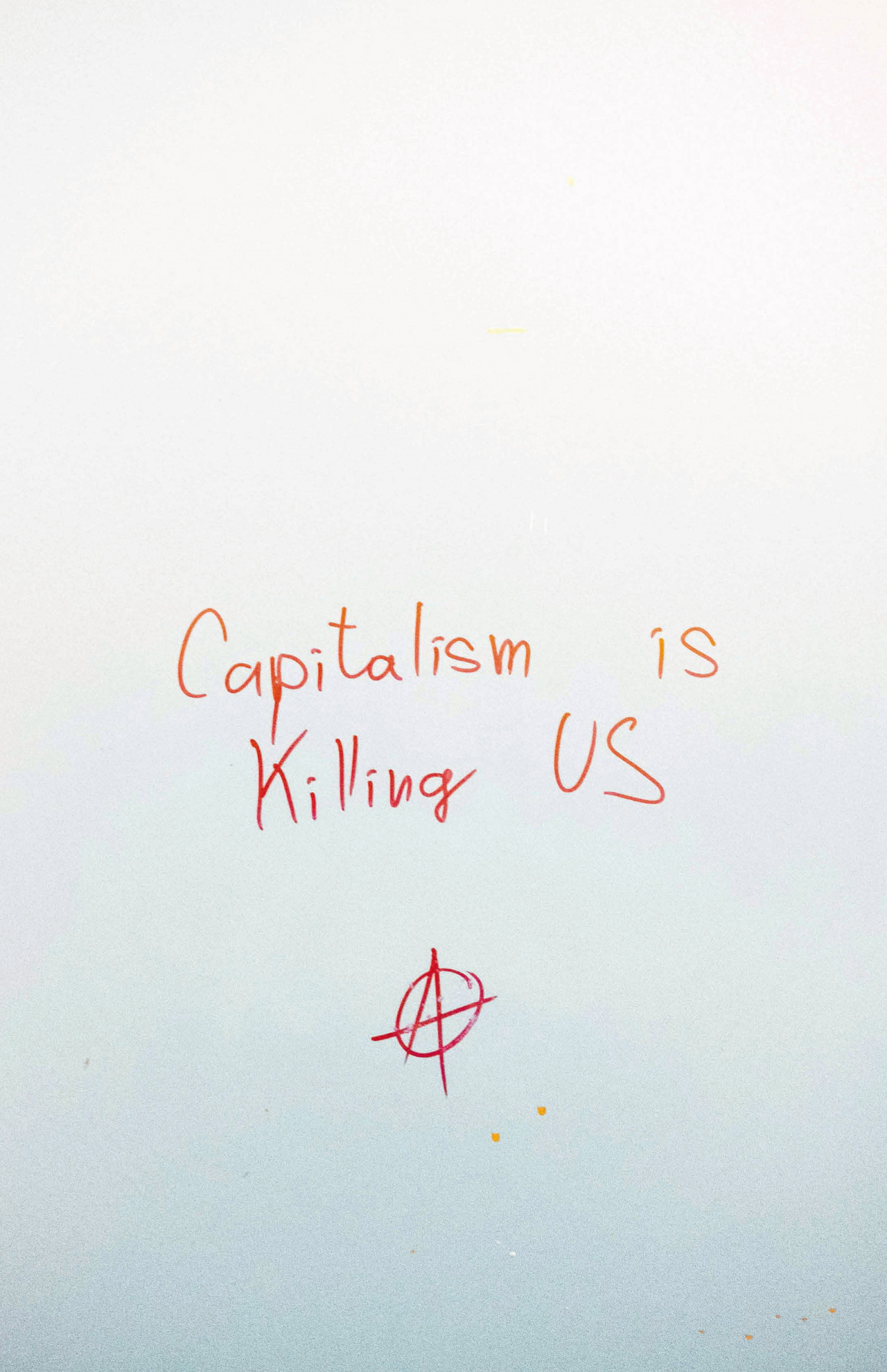




Ein Minimum der beiden…
Ein Minimum der beiden Landessprachen (das Ladinische bleibt außen vor) sollte jeder beherrschen, der hier lebt und arbeitet. Wer mit Englisch auskommen will, wird es in ganz Italien nicht leicht haben. Da wäre Malta oder der Commonwealth angesagt.
In risposta a Ein Minimum der beiden… di nobody
… und warum bleibt das…
… und warum bleibt das Ladinische außen vor?
Es gilt zu unterscheiden…
Es gilt zu unterscheiden. Das Thema ist eh schon ziemlich komplex.
Kurz. Als Anmerkung zum Eingangssatz: „In klassischen Einwanderungsländern wie den USA gilt der Immersionsunterricht als Erfolgsmodell für einen raschen und sicheren Spracherwerb.“
Angenommen, diese Aussage stimmt in den USA heute genauso uneingeschränkt wie früher (Stichwort „Hispanics“), dann stellt sich doch die Frage: Wieso klappt dieses Erfolgsmodell in einem postkolonialen Grenzraum, wie Südtirol, dann aber am ehesten noch im ländlichen Raum?
In den urbanen Zentren gibt es längst eine Drift: Italienisch und Englisch.
„Il tedesco mi fa schifo“, sagte man uns unlängst, als wir eine kleine Umfrage unter Jugendlichen in Bozen machten.
Es gilt hier offenbar auch die Rolle des (fiktiven) Status, die Rolle des Prestige im Sprachkontakt zu sehen.
Im Sprachkontakt ist Deutsch im Südtirol auch institutionell eher lästige Hilfssprache bzw. bisweilen eine wirre/schlechte Übersetzung. Nicht mal die seit 1945 offiziell anerkannte ethnoregionale politische Vertretung der angestammten Bevölkerung Südtirols protestiert gegen die Ungleichwertigkeit der Bürger-innen beim Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache — trotz völkerrechtichem Schutzübereinkommen im Rahmen des Pariser Friedensvertrages von 1946, das die „völlige Gleichstellung des Deutschen mit dem Italienischen“ vorsieht.
In risposta a Es gilt zu unterscheiden… di △rtim post
Für die Ablehnung der…
Für die Ablehnung der deutschen Sprache seitens eines Teils der italienischen Sprachgruppe, ist nicht die Sprache als solche verantwortlich, sondern die Politik, die man damit verbindet. Und die Zelger-Doktrin „Je mehr wir uns trennen, desto besser verstehen wir uns“ ist daran nicht ganz unschuldig.
Das siamo in Italia ist…
Das siamo in Italia ist allgegenwärtig. Auf der anderen Seite darf man die zunehmend größer werdende Gruppe der Italiener nicht übersehen, die ihre Kinder auf deutsche Schulen schicken. Die werden im Regen stehen gelassen (und die Lehrerinnen), obwohl es vernünftiger wäre, Strukturen und Hilfen zu schaffen, damit diesen Kindern ein erfolgreicher Schulbesuch emöglicht wird. Kostet sicher mehr, aber das Geld wäre allemal gut angelegt, auch im Sinne eines guten Zusammenlebens. Die Zuständigen schnarchen aber weiterhin friedlich vor sich hin.
Ein Beispiel: In der Schweiz…
Ein Beispiel: In der Schweiz, nach mehreren Jahrhunderten des Zusammenlebens, passiert es oft, dass, wenn jemand aus Chur auf jemanden aus Genf trifft, meistens Englisch gesprochen wird. Leider..
Sie sprechen Deutsch als Zweitsprache an, aber sind Sie sich bewusst über die schwachen Kenntnisse der italienischen Sprache bei den deutschsprachigen Jugendlichen außerhalb der Ballungszentren? Das Problem liegt politisch. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung fehlt und somit fehlt der Raum. Natürlich ist das anders bei den Neueinwanderern. Diese sprechen 3-4 Sprachen und sind auch offener gegenüber dem anderen
Ein Beispiel: In der Schweiz…
Ein Beispiel: In der Schweiz, nach mehreren Jahrhunderten des Zusammenlebens, passiert es oft, dass, wenn jemand aus Chur auf jemanden aus Genf trifft, meistens Englisch gesprochen wird. Leider..
Sie sprechen Deutsch als Zweitsprache an, aber sind Sie sich bewusst über die schwachen Kenntnisse der italienischen Sprache bei den deutschsprachigen Jugendlichen außerhalb der Ballungszentren? Das Problem liegt politisch. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung fehlt und somit fehlt der Raum. Natürlich ist das anders bei den Neueinwanderern. Diese sprechen 3-4 Sprachen und sind auch offener gegenüber dem anderen