Die Bürger haben den Alarmknopf gedrückt
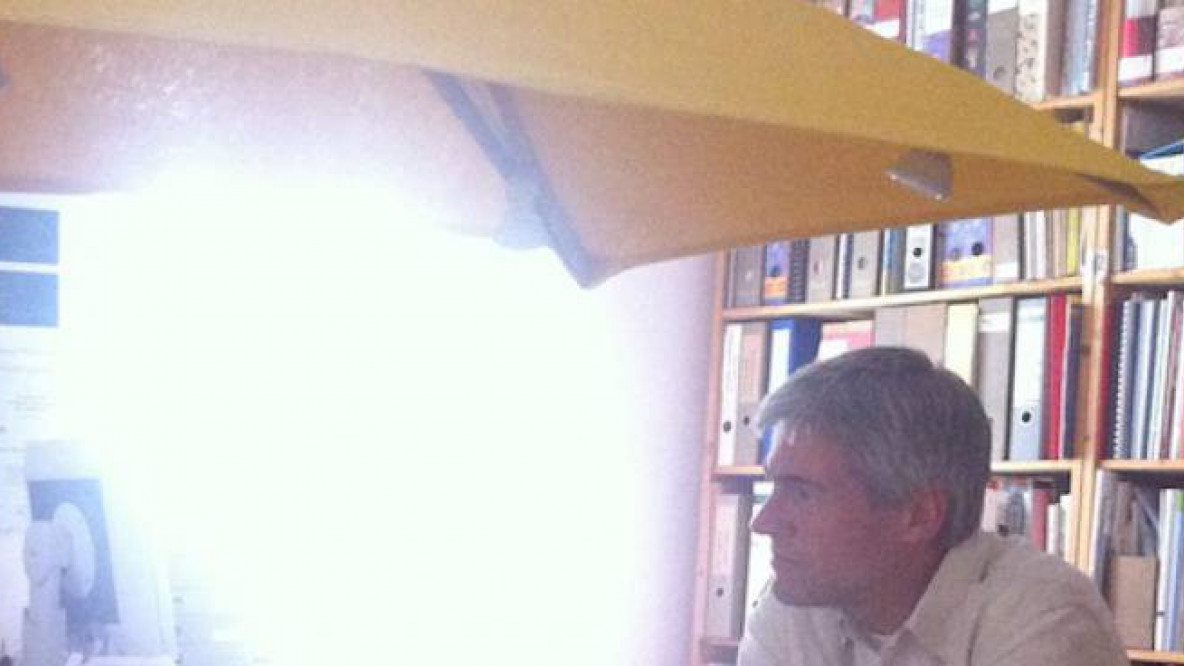
In der Schweiz wird am nächsten 30. November auf nationaler Ebene abgestimmt. Schon wieder. Über eine weitere Verschärfung der Einwanderungsregelungen. Schon wieder. Die Initiative "Stopp der Überbevölkerung" ist von einer Umweltschutzorganisation ausgegangen, die die natürlichen Lebensgrundlagen der Schweiz durch stetes Bevölkerungswachstum bedroht sieht. Im Vorfeld als rassistisch kritisiert, hat der Nationalrat schließlich grünes Licht für die Durchführung der Abstimmung gegeben. salto.bz hat mit Stephan Lausch, Koordinator der Initiative für mehr Demokratie, und Erwin Demichiel, Vorstandsvorsitzender, über Risiken und Nebenwirkungen basisdemokratischer Instrumente gesprochen.
Welche Beweggründe wird eine solche Initiative wie "Stopp der Überbevölkerung" gehabt haben?
Stephan Lausch: Sicher ist, dass die Schweiz ein attraktives Land ist und in der Tat schon überlaufen. Es hat mit ca. 25 % den höchsten Ausländeranteil in Europa. Dass in der Schweizer Bevölkerung der Gedanke auftaucht, "das Boot ist bald voll", ist nachvollziehbar. Dabei wird wahrscheinlich nicht bedacht, dass die Lebensbedingungen anderswo doch um einiges schlechter sind. Die Menschen fühlen sich unmittelbar in ihrer Lebensqualität eingeschränkt und reagieren dementsprechend. Die Problematik ist da, welche Antworten darauf gefunden werden, darüber entscheidet die Bevölkerung.
Gefährdet die Basisdemokratie dabei nicht gewisse Grundprinzipien wie Solidarität, Hilfsbereitschaft u.ä.?
Lausch: Ich sehe humane Werte nicht wirklich bedroht durch die Direkte Demokratie. Wenn die herrschende Entwicklung, der Zustrom von außen in der Schweiz einfach so weiter ginge, dann würde sie schließlich unerträglich und in der Tat bedrohlich. Schauen wir doch nach Italien, wo die Menschen nicht die Möglichkeit haben, Politik mitzugestalten. Der Prozentanteil der Ausländer ist hier viel geringer als in der Schweiz, und dennoch ist die Ausländerproblematik für die Menschen hier viel größer. Weil es die italienische Politik – die fast rein parlamentarische – nicht schafft, die Zuwanderung so zu regeln, dass die Entwicklung in geordneten Bahnen verläuft und die Situation erträglich wäre.
Eliten umgeben sich gerne mit einer Aura der Abgehobenheit – wir, die Elite sind rational, die Masse hingegen emotional und daher nicht entscheidungsfähig.
Am 9. Februar dieses Jahres ist in der Schweiz schon einmal über eine strengere Regelung der Einwanderung abgestimmt worden.
Lausch: In den vergangenen zwanzig Jahren ist in der Schweiz immer wieder über das Thema "Überfremdung" und "Freizügigkeit" diskutiert worden. Vier Mal wurden Initiativen zu schärferen Einwanderungsbestimmungen im Laufe der Zeit abgelehnt. Im Februar wurde die fünfte in der Reihe ganz knapp angenommen. Und das, weil sich die Bedingungen inzwischen einfach zugespitzt haben.
In Mals haben sich sowohl politische Vertreter als auch Verwaltung stets für die Einführung basisdemokratischer Instrumente engagiert und sorgen jetzt auch dafür, dass die Abstimmung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. In Brixen wird vonseiten der politischen Vertretung mit allen möglichen Tricks versucht, die Volksabstimmung für die eigenen Zwecke zu missbrauchen.
Verhindern solche Initiativen wie in der Schweiz eine sachlich geführte Diskussion zu dem Thema?
Lausch: In der Schweiz hat es immer Volksinitiativen und Referenden gegeben, die von Außenstehenden als "radikal" verschrieen wurden. Jedoch wird im Land stets relativ sachlich über die Angelegenheiten diskutiert.
Erwin Demichiel: Es ist ja nicht so, dass die Menschen in der Schweiz einen leichtfertigen Umgang hätten mit der Direkten Demokratie oder "irrational" wären. Die Menschen, die ja direkt von der Situation betroffen sind und sie anders wahrnehmen als die Politiker, reagieren auf sich verschlechternde Bedingungen. Und haben angefangen, sich mehr und mehr zu rühren. Wie Atome: Wenn es warm wird, bewegen sie sich mehr.
Eliten sind nicht wie die Mehrheit der Menschen von sich ändernden Lebensbedingungen so direkt betroffen. Sie haben eine begrenzte Wahrnehmung der Realität. Und das ist immer problematisch für die Mehrheit.
Ist die Angst vor irrationalen Entscheidungen der Masse unberechtigt?
Demichiel: Versuchen wir uns doch einmal vorzustellen, wo sich die Unzufriedenheit der Menschen anstauen würde, wenn sie nicht zum Ausdruck gebracht werden könnte. Im Untergrund, in der braunen Szene. Dort lauert die wirkliche Gefahr der Irrationalität, die dann ausarten und zu Gewaltbereitschaft führen kann. In der Schweiz gibt es im Vorfeld von Abstimmungen stets offene und öffentliche Diskussionen sowie präzise Regeln. Ist das Irrationalität? Wohl eher nicht.
Warum wird die Angst vor irrational getroffenen Entscheidungen dann oft als Argument gegen mehr Bürgerbeteiligung verwendet?
Demichiel: Vernunft wird oft als Gegenpol zu Emotionen dargestellt, dem ist aber nicht so. Jeder Gedanke ist mit Emotionen verbunden, es gibt keine Entscheidungen, die zu hundert Prozent rational getroffen werden. Politiker spielen gerne das eine gegen das andere aus.
In der Schweiz haben die Initiativen – im Gegensatz zu den Referenden – in den letzten zwanzig Jahren gehörig zugenommen. Andreas Müller vom Schweizer Think Tank avenir suisse schreibt diese Entwicklung der steigenden Skepsis der Menschen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Elite zu.
Demichiel: Eliten umgeben sich gerne mit einer Aura der Abgehobenheit – wir, die Elite sind rational, die Masse hingegen emotional und daher nicht entscheidungsfähig. Diese Abgehobenheit existiert effektiv, aber in dem Sinn, dass die Eliten nicht wie die Mehrheit der Menschen von sich ändernden Lebensbedingungen so direkt betroffen sind. Sie haben eine begrenzte Wahrnehmung der Realität. Und das ist immer problematisch für die Mehrheit.
Lausch: Die Direkte Demokratie wirkt in solchen Fällen wie eine Alarmanlage.
Es ist ja nicht so, dass die Menschen in der Schweiz einen leichtfertigen Umgang hätten mit der Direkten Demokratie oder "irrational" wären. Die Menschen, die ja direkt von der Situation betroffen sind und sie anders wahrnehmen als die Politiker, reagieren auf sich verschlechternde Bedingungen.
Ein Alarmmechanismus wie im Falle der Initiative in Mals?
Lausch: Genau. Die betroffenen Menschen hatten bisher nicht die Möglichkeit, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen und nach Jahren einer schleichenden Entwicklung in der Landwirtschaft und der damit verbundenen Zunahme der Pestizidbelastung jetzt die Möglichkeit, auf den Alarmknopf zu drücken.
Es war Zeit dafür?
Lausch: Im Laufe der Geschichte wurde den Menschen von den Mächtigen stets vermittelt, dass gewisse Entwicklungen einfach naturgegeben und nicht aufzuhalten seien. Auch im Fall von Mals wurde die Situation so dargestellt, als könnte man nichts daran ändern, als sei der vermehrte Einsatz von Pestiziden notwendig, unter anderem um den jungen Menschen in Zukunft eine Einkommensquelle zu sichern. Doch ist die Entwicklung von den Menschen gemacht und nun wird klar, dass sie ihr keineswegs schicksalhaft ausgeliefert sein müssen. Sie können jetzt eigenmächtig darüber entscheiden, ob in Zukunft Pestizide eingesetzt werden sollen oder nicht.
Versuchen wir uns doch einmal vorzustellen, wo sich die Unzufriedenheit der Menschen anstauen würde, wenn sie nicht zum Ausdruck gebracht werden könnte. Im Untergrund, in der braunen Szene. Dort lauert die wirkliche Gefahr der Irrationalität, die dann ausarten und zu Gewaltbereitschaft führen kann.
Ist die Abstimmung in Mals ein Weckruf für das Land?
Lausch: Mals ist in dieser Hinsicht sicherlich eine Pioniergemeinde. Über Jahre hinweg hat man sich dort engagiert, um basisdemokratische Instrumente - Voraussetzungen, um die eigene Stimme geltend zu machen - zu schaffen. Mals ist außerdem Südtirols einzige Gemeinde mit der Möglichkeit, ein Referendum abzuhalten. Die politischen Vertreter und die Verwaltung sorgen jetzt auch dafür, dass die Abstimmung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Im Vorfeld wurden Informationsmaterialien zugestellt und nun haben die Bürger und Bürgerinnen von Mals zwei Wochen Zeit, per Briefwahl abzustimmen.
In Brixen hingegen...
Lausch: In Brixen wird vonseiten der politischen Vertretung mit allen möglichen Tricks versucht, die Volksabstimmung für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Wenn die Leute aber nun am Beispiel Mals erleben, was mit Direkter Demokratie alles in Gang gesetzt werden kann, dann ist das hoffentlich ein Ansporn, sich mehr um Mitbestimmungsrechte zu kümmern.
Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.