„Hinter die Fassaden schauen“

-
Text: Nathan Merlo Ragginer
Anlässlich der morgigen Eröffnung der 19. Internationalen Architekturbiennale Venedig 2025 moderiert Maik Novotny ein Podiumsgespräch zum Thema „... ein Zuhause schaffen“ – im Rahmen des österreichischen Beitrags in den Giardini.
„AGENCY FOR BETTER LIVING“ lautet der Titel der Ausstellung im österreichischen Pavillon. Ausgehend von den Städten Wien und Rom stellen die Kurator:innen das Top-down-Modell des sozialen Wohnbaus in Wien den Bottom-up-Praktiken der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation in Rom gegenüber.
Deshalb haben wir mit ihm vorab darüber gesprochen, welche Bedeutung Architektur heute in der Gesellschaft hat – und warum es entscheidend ist, sie verständlich und aktiv zu vermitteln. Genau das ist schließlich auch das Ziel der Biennale und unseres Blogs.
-
SALTO: Herr Novotny, wie sind Sie zum Architekturjournalismus gekommen?
Maik Novotny: Ich habe Architektur studiert und auch angefangen in der Praxis in verschiedenen Büros zu arbeiten, wobei mich das Schreiben immer schon sehr interessiert hat. Angefangen hat es mit einem Buchprojekt über Architektur in der Slowakei in den 60ern und 70ern, welches ich mit befreundeten Architekten und der Fotografin Hertha Hurnaus gemacht habe. Das war ein Herzensprojekt. Dann hat es sich im „richtigen“ Journalismus ergeben, dass in Wien beim Falter und dann beim Standard kurz hintereinander zwei Architekturjournalisten aufgehört haben und eine Lücke entstand. Da bin ich hineingerutscht bin und alles andere ergab sich daraus.
-
Zur Person
Maik Novotny ist ein Architekturjournalist, Autor und Moderator mit Schwerpunkt auf Stadtplanung und Baukultur. Geboren in Stuttgart, lebt er seit 2000 in Wien. Nach dem Architekturstudium in Stuttgart und Delft arbeitete er in verschiedenen Planungsbüros. Heute schreibt er regelmäßig für „Der Standard“ und „Falter“ und ist seit 2019 Vorstandsmitglied (seit 2022 Vorstandsvorsitzender) der Österreichischen Gesellschaft für Architektur (ÖGFA). Er ist zudem als Herausgeber und Vortragender aktiv.
-
Was kann man sich grob unter Architekturjournalismus vorstellen?
Da wird jeder eine andere Antwort geben. Manche haben etwa Schwierigkeiten mit dem Begriff Architekturkritiker, ich selbst auch ein wenig. Es gab große Architekturkritiker wie Friedrich Achleitner so wie etwa Marcel Reich-Ranicki in der Literatur. Solche Figuren gibt es nicht mehr. Das hat sich alles diversifiziert und pluralisiert.
-
Was sind die relevanten Themen für Architekturjournalismus?
Es gibt Themen, die gerade jetzt sehr stark sind, über alle Personen hinaus.
Einmal ist da die Bauwende, vom Abriss und Neubau hin zum Umbau. Zum anderen die ganze Problematik der CO2-Emissionen aus der Bauwirtschaft, die 40 Prozent des globalen Ausstoßes ausmacht. Diese Zahl - 40 Prozent – hat man in den letzten Jahren zigtausende Male gehört. Das ist aber auch richtig so, dass man immer wieder wiederholt, für wie viele Emissionen die Bauwirtschaft verantwortlich ist. Weiters sind auch die kulturellen Aspekte der Architektur Thema. Leidend formuliert, ist das ein Kampf gegen Windmühlen, aber man muss es immer so bringen, dass Architektur ein Teil der Kultur, ein Teil der Baukultur ist, ohne sich in die Diskussion zu stürzen, ob Architektur Kunst ist oder nicht. Das zu vermitteln, ist eine permanente Aufgabe.
Welchen Stellenwert nimmt diese Art von Journalismus in der Gesellschaft ein?
Keinen sehr großen. Wir haben in Österreich den Luxus, dass wir mit dem Standard und der Presse zumindest zwei Tageszeitungen haben, die jedes Wochenende Platz für Architektur reservieren. In Deutschland gibt es so was nicht mehr. Das heißt, da müssen die Kolleginnen und Kollegen kämpfen, um sich im Feuilleton bemerkbar zu machen. In der medialen Landschaft gibt es das Problem des Architekturjournalismus, dass er immer zwischen den Immobilienteilen und dem Feuilleton oszilliert und nirgendwo richtig hingehört. Mal landet er da, mal landet er dort.
Dementsprechend wird er auch rezipiert. Das ist ein strukturelles Problem. In Österreich haben wir das Privileg, dass wir etwas mehr Reichweite haben und eine Frequenz, mit der wir mit Themen spielen können und sie besetzen können. Wir können Varianz hineinbringen, mal ein Interview, mal eine klassische Besprechung eines Gebäudes, mal geht es um Zersiedelung und Bodenversiegelung, Raumordnung oder internationale Beispiele. Es ist aber nicht so, dass so etwas ein Straßengespräch wird. Immerhin erreicht es aber auch mal einen kleinen Prozentsatz.
„Die gebaute Umwelt ist immer da, immer präsent.“
-
Würden Sie sagen, dass diese Relevanz, dieser Stellenwert von früher auf heute gesunken ist?
Würde ich so nicht sagen. Früher war die mediale Landschaft viel überschaubarer, als es noch keine Social Media gab. Das heißt auch nicht, dass die Leute in der Trafik über die Architekturkritik von Friedrich Achleitner geredet haben. Im Fernsehen gab es manche Formate, die wöchentlich eingespielt wurden und auch sehr kritisch waren.
Warum ist Architektur ein Thema, das die Öffentlichkeit angeht?
Es betrifft uns alle jeden Tag. Die gebaute Umwelt ist immer da, immer präsent. Es ist mir wichtig, mich in meiner Arbeit nicht nur am konkreten Gebäude „entlangzuschreiben“, zu beschreiben, wie dick die Fensterrahmen sind und wie schön das Gebäude ist, sondern auch die Umstände des Zustandekommens von Architektur zu verdeutlichen, weil es da immer viele Missverständnisse in der Öffentlichkeit gibt. Etwa was die Rolle und den Einfluss von Architekten betrifft: Man kennt ein paar Star-Architekten und denkt, das ist die Normalität. Architekten hätten die komplette Freiheit, sich selbst zu verwirklichen mit den Gebäuden und das ist nicht unbedingt der Fall. Da spielen viele Faktoren rein. Zudem ist ein sehr großer Prozentsatz des Gebauten ohne Architekten zustande gekommen. Es ist nicht so, dass Architekten jedes Gebäude designen. Wie die gebaute Umwelt aussieht, ist eine Frage der Zivilgesellschaft und eine politische Frage.
„Wie die gebaute Umwelt aussieht, ist eine Frage der Zivilgesellschaft und eine politische Frage.“
Inwiefern?
In Österreich geht es zum Beispiel darum, wie funktioniert der Föderalismus? Ist die Wohnbauförderung Ländersache oder Bundessache und wer hat die Raumordnung? Ich merke es immer, wenn ich von Österreich nach Bayern oder nach Südtirol fahre, man kommt über die Grenze und man denkt, warum ist plötzlich alles so viel schöner und aufgeräumter? Das sind kulturelle, politische Fragen der Raumordnung.
In Bayern oder in Südtirol kann nicht jeder Bürgermeister ein großes Gewerbegebiet veranlassen, obwohl die Nachbargemeinde direkt daneben auch eins hat. Da ist die Entscheidungsgewalt ein Stück höher. Zu vermitteln, warum Sachen so aussehen, wie sie aussehen, das nichts so aus dem Bauch heraus passiert, sondern gesellschaftlich-politische Entscheidungen dahinter stehen, finde ich wichtig.
-
Wie schwer ist es, dieses Thema zu vermitteln?
Man müsste evaluieren, was wo wirklich ankommt. Man schreibt natürlich etwas in ein schwarzes Loch hinein und hofft, dass es irgendwo ankommt. Aber es gibt auch weitere Formate der Architekturvermittlung wie Führungen oder Vorträge.
Am besten ist es, hinzugehen und sich tatsächlich die Sachen anschauen mit jemanden, der sich damit auskennt. In der österreichischen Architektur machen wir das oft. Die Leute verstehen es, weil der Architekt, die Bewohnerin. jemand im Thema das erklärt.
Es geht um eine Schulung der Wahrnehmung, wie ich Architektur, Gebäude und die Umwelt wahrnehme. Manchmal hilft es schon, wenn man genauer hinschaut. Da ist die Folge der Wahrnehmung, dass man, ohne zu didaktisch oder paternalistisch zu sein, auch den Spaß weckt, sich damit auseinanderzusetzen und sich mal genauer anzuschauen, ohne in der Dichotomie von schön oder hässlich steckenzubleiben. Aber man braucht verschiedene Formate.
„Es geht um eine Schulung der Wahrnehmung, wie ich Architektur, Gebäude und die Umwelt wahrnehme.“
Also Bildung für ein Thema, das zwischen Lebensraum, Kultur und Politik überall ein wenig Einfluss hat?
Absolut, ja. Es geht nicht darum, nur über Fassaden zu reden und was schön oder was hässlich ist, sondern auch hinter die Fassaden zu schauen. Dabei muss man sich manchen anderen Strömungen erwehren: In den letzten Jahren zum Beispiel wird Architektur oder Baukultur, gerade über Social Media, von rechtskonservativen Seiten instrumentalisiert, die oft traditionalistische Architektur in einem dubiosen Sinngehalt platzieren. Vor allem in den USA. Dabei wird oft mit Bildpaaren argumentiert. Das heißt, links die schöne, alte gotische Kathedrale rechts Tadao Andō [japanischer Architekt, Anm. d. Red.] mit dem Sichtbeton und da spricht man von Kulturverlust im Sinne von: „Früher war das noch so schön, jetzt ist es so hässlich.“ Leider funktioniert das sehr gut. Was man im Journalismus nun mal immer hat, ist, dass das Bild stärker und viel emotionaler ist als der Text.
-
Was könnte Architekturjournalismus in der öffentlichen Wahrnehmung bewegen?
Den Blick hinrichten auf etwas, was überall da ist, aber man ein bisschen übersieht, und man merkt, da gibt es ein Problem oder etwas hat diesen Grund, also einfach eine Erkenntnis gewinnen. Das passiert nur sehr selten, aber einmal in fünf Jahren hat man so einen Text.
Wie beispielsweise?
Ich schrieb vor rund fünf Jahren einen Artikel, der einfach nur aus einer Frage, die ich mir selbst gestellt habe, entstanden ist, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Einfamilienhäuser in Österreich in extrem knalligen Farben angemalt sind, meistens in schreienden Gelbfarben. Wenn man über das Land fährt, sieht man überall Gelb. Warum eigentlich? Warum Gelb und warum so? Dann habe ich verschiedene Leute gefragt, Architekten und Leute aus dem Baumarkt, die Farben verkaufen, Farbhersteller wie Farbexpertinnen. Das war in wie ein Bienennest zu stechen. Man merkte, das ist wirklich ein Riesenthema. Alle hatten sofort sehr viel zu sagen.
Innerhalb von 24 Stunden hatte ich 16 Seiten Mitschrift von Interviews. Eine solche Goldmine zu finden, passiert sehr selten. Ich habe selber viel gelernt und das hatte auch eine große Resonanz. Da freut man sich dann drüber. Das sind die schönen Momente in denen man merkt, man hat was aufgetan und die Resonanz kommt nicht nur von der Fachöffentlichkeit, sondern generell. Es ist eine Story, die nicht akademisch ist, sondern in der es um die gebaute Umwelt geht, die überall ist, um den gebauten Alltag.
Würden Sie sich persönlich als Kulturjournalisten sehen oder anderweitig?
Ich glaube als Kulturjournalisten. Nicht in der Politik oder Wirtschaft, da fehlt mir die Kompetenz und nur Immobilien wäre zu eingeschränkt. Aber es ist auch meine Erfahrung, auch bei den Medien für die ich schreibe, im Kulturbereich, im Feuilletonbereich merkt man, da sind wirklich sehr gebildete Leute, die da arbeiten, die sich mit Bildender Kunst auskennen, mit dem Theater, aber wenn man sie nach Architektur fragt, ist das ein Abgrund des Wissens.
Architektur wird nicht immer unter Kultur eingeordnet und die Leute kennen gerade mal drei Architekten. Ich komme aus der Praxis und erwarte vielleicht etwas zu viel Wissen, aber manchmal ist es erschreckend, dass das Wissen bei gebildeten Leuten so gering ist. Da muss man früh ansetzen. In der Schweiz etwa passiert es schon in der Schulbildung, dass man Architektur - auch spielerisch - herüberbringt, sonst ist es irgendwann auch zu spät. Dann stößt man auf diese Lücken.
„Schaut euch das mal an, was seht ihr und was ist es wirklich?“
-
Was glauben Sie, in welche Richtung sich der Architekturjournalismus in Zukunft entwickeln könnte?
Es gibt noch Potenzial in den sozialen Medien, was noch nicht gehoben ist, was man alles machen kann, wie man mit Storys agiert oder mit kleinen Formaten arbeitet. Was mich beim klassischen Journalismus erstaunt, ist dass relativ wenig an jungen Kolleginnen und Kollegen nachkommt. Alle Kollegen, die ich kenne, sind eher in meinem Alter, 40 plus. Ich hätte nichts dagegen, wenn jüngere Leute in diesen Beruf einsteigen, gerne auch mehr Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, die einen anderen Blick haben, andere Sachen erzählen, aber da kommt wenig nach.
Der Journalismus hat nicht die besten Berufsaussichten. Viele sind Quereinsteiger aus der Architekturpraxis. Ich fände es schön, wenn es sich verjüngt und weiter pluralisiert.
Was für eine Aufgabe sollte der Architekturjournalismus in Zukunft erfüllen können?
Er sollte Lust darauf machen, sich damit zu beschäftigen, den kulturellen Reichtum zu vermitteln, der drin liegt und auch zu vermitteln, dass es alle angeht, dass jeder was zu sagen hat und sich beteiligen kann. Architektur ist kein elitärer Elfenbeinturm, keine schöne Kunst, die irgendwo in einer Wolke passiert. Ohne dabei populistisch zu werden und zu vermitteln, jeder kann ein Haus bauen und jeder kann Architekt sein. Man muss herüberbringen, dass es einen Grund gibt, warum man das so viele Jahre studiert und so viel in der Praxis ist und wie kompliziert das alles ist.
Eine Überwindung dieser Abwehrhaltung, dieser Klage, dass alles hässlicher wird, wäre auch mein Wunsch. Zu sagen, schaut euch das mal an, was seht ihr und was ist es wirklich? Geht unvoreingenommen dahin und überlegt.
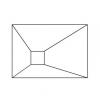



Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.