Terradipassaggio-Durchgangsland
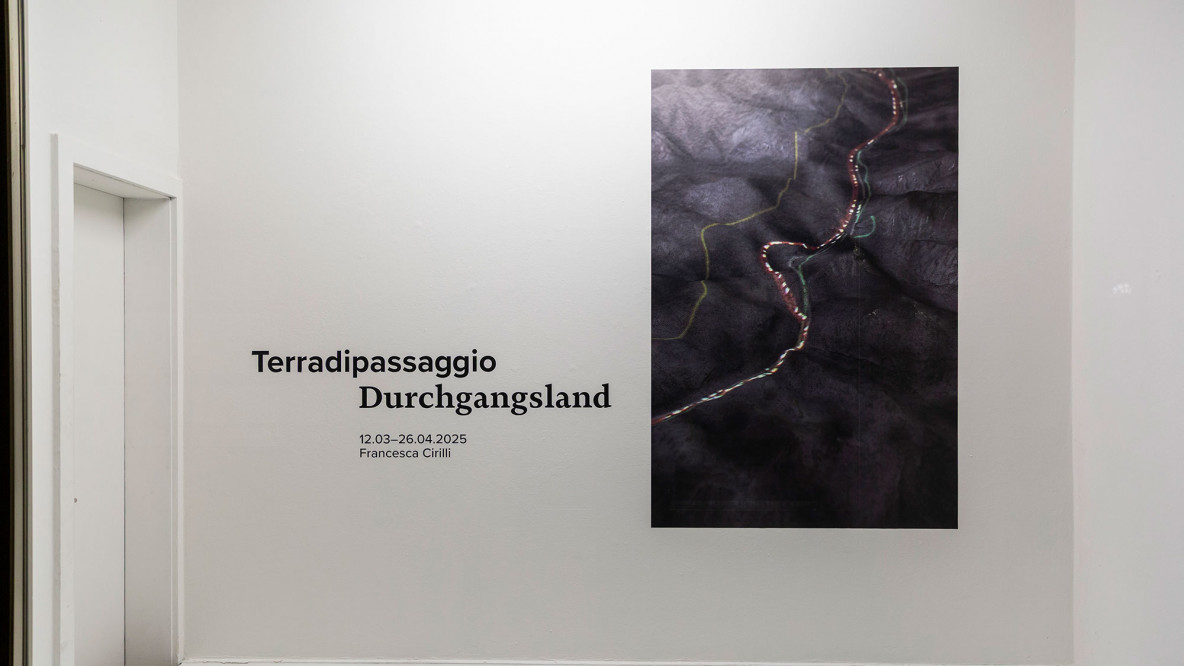
-
Im März 2024 wurden die Container in der Sachsenklemme teilweise abgebaut, auf Lastwagen verladen und an die Grenze zwischen Kampanien und Apulien gebracht. Dort wurden sie für das neue Arbeiterdorf im Orsara-Tunnel an der Hochgeschwindigkeitsstrecke Neapel-Bari wieder aufgebaut. Viele, die jahrelang am Brenner-Basistunnel gearbeitet hatten, sind nun dort oder an der Strecke Palermo-Catania-Messina. In der Nähe der Heimat zu arbeiten, war für die meisten ein völlig neues Erlebnis.
-
Wie ich bereits erwähnt habe, hatten auch mein Großvater und mein Vater körperlich anstrengende Berufe. Der eine war Heizer am Kessel einer Papierfabrik, der andere arbeitete in derselben Fabrik an den riesigen Maschinen, die Papier (in 8 Tonnen Rollen) herstellen. Beide verbrachten ihre Schichten an lauten, heißen, dunklen und manchmal gefährlichen Orten, um etwas Leichtes und Makelloses zu produzieren: Papier. Schon als Kind blätterte ich mit einer gewissen Ehrfurcht in Büchern und Zeitschriften oder zeichnete auf Blätter. Ich wusste, dass dieses scheinbar banale Material (trotz der zunehmend automatisierten Arbeit) nicht von einem einzigen Menschen, sondern von vielen hergestellt worden war. Seitdem versuche ich mir vorzustellen, wer hinter jedem Gegenstand, den ich benutze, jeden Raum, den ich besuche oder durch den ich gehe, steckt. Ich habe Respekt und Dankbarkeit für die Arbeit anderer. Als der Kellner mir von dem Tunnelbau erzählte, war die zweite Frage, die ich mir stellte (die erste war: Warum weiß ich praktisch nichts darüber?): Wer weiß, wie viele Menschen daran arbeiten? Das war leicht zu beantworten. Aber eine andere Frage folgte sofort: Wenn die Basislager vollständig abgebaut sind, wenn man im bequemen Waggon eines Hochgeschwindigkeitszuges durch den Tunnel fährt, wie viele Menschen werden dann an diejenigen denken, die diese Infrastruktur ermöglicht hatten?
Auf den Bildern von Cirilli fehlen die Gesichter derjenigen, die auf der Baustelle arbeiten, in den Basislagern leben oder dauerhaft in Franzensfeste wohnen.
Die Ausstellung im Foto-Forum und die begleitende Publikation versuchen, Licht auf diese Großbaustelle zu werfen und die letzte Frage zu beantworten. Sie tun dies, indem sie eine partielle Erzählung anbieten (in ihrer Nicht-Festlegung und Subjektivität), die durch die ausgestellten Bilder und diesen Text die Orte und Menschen von BBT und Franzensfeste präsentiert. Auch diese Erzählungen beginnen mit einer Lücke. Auf den Bildern von Cirilli fehlen die Gesichter derjenigen, die auf der Baustelle arbeiten, in den Basislagern leben oder dauerhaft in Franzensfeste wohnen. Vielmehr erscheint die menschliche Präsenz - auf eine geisterhafte Weise: Hände, Körperfragmente, Silhouetten in der Ferne, aufgesprühte Namen, Familienbilder, Notizen, Zeichnungen. Die Geschichten dieser Menschen fehlen in den Aufzeichnungen. Nicht dass die Fotografin keine Porträts gemacht hätte oder dass nicht dutzende von Menschen interviewt worden wären. Wir haben jedoch beschlossen, dieses Material nicht einzubeziehen, weil die Auswahl einiger weniger Gesichter und Geschichten bedeutet hätte, viele andere auszuschließen. Die Biografien, auf die wir gestoßen sind, haben zudem alle einen gemeinsamen Werdegang und sind denen des Dokumentarfilms „Brennero - Link", der auf der Website von Raiplay kostenlos zu sehen ist, sehr ähnlich oder sogar identisch. Die Reduzierung der Arbeiter auf ein geisterhaftes Element ermöglicht es uns also, die Dramatisierung und Instrumentalisierung des Lebens und der Arbeit der am Bau des Tunnels Beteiligten zu moralisierenden Zwecken zu vermeiden.Dies ist meiner Meinung nach das größte Manko des Films von Catia Barone, der 50 Minuten erzwungene Qualen den wenigen Minuten der Ehrung der Protagonisten gegenüberstellt. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass die Menschen, die hier arbeiten, in der Tat Opfer bringen und täglich mit Entbehrungen und Gefahren konfrontiert sind, aber dies geschieht unter Bedingungen der freien Wahl, hoher Sicherheitsstandards und fairer Bezahlung und Verträge. Ganz zu schweigen davon, dass viele Menschen Spaß an ihrer Arbeit haben und stolz darauf sind, am Bau einer der größten Eisenbahninfrastrukturen der Welt mitzuwirken. Das hat nichts mit denen zu tun, die in illegalen afrikanischen und südamerikanischen Minen, in Fast-Fashion-Fabriken oder in vielen anderen Kontexten arbeiten, die uns ebenfalls sehr nahe sind, wie die von illegalen Arbeitern oder Schwarzarbeitern. Den Arbeiterinnen und Arbeitern des BBT-Projekts (und generell allen, die unter legalen und würdigen Bedingungen beschäftigt sind) schulden wir Dankbarkeit, nicht Mitleid. Vielleicht ist das, was wir hier bieten, weniger eine Erzählung als vielmehr eine Hommage an diejenigen, die unsichtbar aber unerlässlich, durch persönliche und kollektive Anstrengung dazu beitragen, die Luftqualität in diesen Tälern zu verbessern und schnelle, komfortable Verkehrsverbindungen zu schaffen.
Die Festung Franzensfeste hat nämlich für den Sommer 2025 eine temporäre Ausstellung von Gregor Sailer und für 2027 eine Dauerausstellung über die zeitgenössische Geschichte Südtirols geplant.
Noch bedeutsamer wird die Ehrung dadurch, dass die Ausstellung an einem Ort der Kultur stattfindet, einem Symbol für geistige Arbeit, die als das Gegenteil von körperlicher Arbeit angesehen wird, und in einem Ausstellungsraum im Stadtzentrum, weit entfernt von den Industriegebieten und Arbeiter Vororten. Im Übrigen wird die Galerie Foto Forum nicht die einzige Einrichtung in der Provinz sein, die sich eingehend mit dem Bau des Tunnels befasst. Die Festung Franzensfeste hat nämlich für den Sommer 2025 eine temporäre Ausstellung von Gregor Sailer und für 2027 eine Dauerausstellung über die zeitgenössische Geschichte Südtirols geplant. In beiden Ausstellungen wird auf die aktuelle Baustelle und ihre zahlreichen Parallelen zur Errichtung der Festung verwiesen. Denn die Geschichte wiederholt sich: Vor fast 200 Jahren, als Kaiser Franz I. von Österreich den Bau der Verteidigungsanlage anordnete, kamen zwischen 1833 und 1838 sechstausend Arbeiter aus allen Teilen des Habsburger Reiches. Es waren Fuhrleute aus Tirol, Steinmetze und Maurer aus Norditalien, Handwerker aus Böhmen, Mähren und slawischen Gebieten - Wirtschaftsmigranten von vor zwei Jahrhunderten, die, wenig überraschend, in temporären Siedlungen lebten. Die größte von ihnen beherbergte 3.300 Menschen - mehr als die gesamte damalige Bevölkerung von Brixen. Als die Festung schließlich eingeweiht wurde - mit 200 Todesfällen während des Baus (zum Vergleich: beim BBT gab es bisher einen tödlichen Unfall) -, war sie bereits veraltet. In jenen Jahren war der Wettlauf um den Bau von Eisenbahninfrastrukturen, die Städte und industrielle Produktionszentren miteinander verbanden, regelrecht explodiert. Grenzen wurden durchlässig. 1863 wurde mit dem Bau der Strecke Bozen-Brenner-Innsbruck begonnen, an der 20.000 Menschen arbeiteten und der 1867 abgeschlossen wurde. 1868 folgte der Bau der Pustertalbahn, die 1871 eröffnet wurde und in Franzensfeste an die Brennerstrecke anbindet.
Doch dann kommt die Epiphanie.
"Das Dorf Franzensfeste entsteht 'unter unnatürlichen Umständen'. In einer solchen Schlucht baut man eine städtische Siedlung nur aus verschiedenen Notwendigkeiten. Diese Notwendigkeit war der Bau des Eisenbahnknotens Pustertal, den die Brixner in ihrer Stadt nicht haben wollten. So entwickelte sich ein Dorf von Eisenbahnern, später von Zollbeamten und Spediteuren". So schrieb 1965 der damalige Bürgermeister Oddo Bronzo in einem wunderschönen Brief, der in der Zeitung Alto Adige veröffentlicht wurde (und auf der Website des Projekts „Open Archive Franzensfeste" von Brave New Alps wiedergegeben ist). Er fährt fort: „Dies ist kein schöner Ort, dem Berg entrissen, wo man den Himmel nur bewundern kann, wenn man den Blick weit nach oben richtet, und wo das einzige flache Stück Land vom Wasser des Stausees überflutet wird." Damals fehlten auf der Liste der Künstlichkeiten noch die Autobahn und der BBT.
Franzensfeste kann also tatsächlich als das „Drecksloch" erscheinen, als das es ein Einwohner des Ortes bezeichnet - ein Beiname, den Nachbarn und Fremde dem Dorf angeblich zu schreiben. Doch dann kommt die Epiphanie. Sie kommt in Form weiterer aufschlussreicher Zufälle, neuer Punkte, die in einer abschließenden, kathartischen Geschichte zusammengefügt werden, die dieses Mal die Gabe der Synthese besitzt.In der Nähe des Basislagers von Mauls wurde vor fast 500 Jahren die römische Mithras-Stele gefunden, die heute im Archäologiemuseum von Südtirol aufbewahrt wird und in einer Nachbildung im Innenhof der Gemeinde Sterzing. Mithras ist ein wandernder Gott. Sein Kult hat seinen Ursprung im Hinduismus und in der persischen Religion, durchläuft den Zoroastrismus und gliedert sich schließlich in das Pantheon der Griechen und Römer ein. Mit jeder Epoche wird sein Mythos synkretistisch an die Überzeugungen (und Interessen) der verschiedenen Völker angepasst, die ihn übernehmen. Für die Römer wurde Mithras in einer Höhle geboren und in unterirdischen Räumen verehrt - sowohl in natürlichen als auch in künstlichen. Er ist mit der Dunkelheit, der Nacht, aber auch mit dem Sonnenlicht und der Bewegung der Gestirne verbunden. Er könnte durchaus die heilige Barbara als Schutzpatronin derjenigen ersetzen, die unter der Erde arbeiten. Die Stele kam vor etwa zweitausend Jahren aus denselben Gründen hierher, aus denen heute Hunderte von Arbeitern in Süditalien Peperoncini, Heiligenkarten und Familienfotos mit sich führen: um die Entfernung von ihren Orten und geliebten Menschen durch das Mitführen von Ritualen, Gegenständen und Erinnerungen zu überbrücken. Das Flachrelief gelangte über die Römerstraße (deren Überreste in Franzensfeste in der Nähe des Flusses in einem kurzen Museumsrundgang besichtigt werden können) nach Mauls und fand in einem kleinen Tempel in der Nähe einer Zollstation Platz. Hier hielten diejenigen an, die Waren aus der regio X (der letzten der italischen Provinzen des Reiches) nach Noricum (mit Raetia die erste der ausländischen Provinzen) transportierten, um den Ausfuhrzoll zu entrichten.
Die Steuer wurde von Beamten des Römischen Reiches eingezogen, die aus Karrieregründen und aus der Not heraus überall dort eingesetzt wurden, wie die zentrale Verwaltung es entschied. Mithras kam im Gefolge der Leute, die in der Zollstation von Mauls arbeiteten und zweifellos von weit her kamen. Es sind Jahrtausende, dass Franzensfeste ein Durchgangsort, ein Ort harter Arbeit, der Zerstörung und des Wiederaufbaus, der Einwanderung, und der Resilienz ist. Hier kreuzen viele Grenzen, Gegensätze fordern sich heraus und vermischen sich: Dies ist die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Südtirol (doch nur wenige von ihnen haben Wahlrecht). Auch heute noch versammeln sich hier alle drei Jahre Tausende von Schützen, um die Schlacht von 1809 und die Heimat Tirol zu feiern. Die Grenze zu Österreich ist 40 Kilometer entfernt - doch nur 5 Kilometer südlich verläuft eine andere, unsichtbare, aber natürliche Grenze: die Periadriatische Naht, jene tektonische Linie, die die Alpen durchzieht und die Schnittstelle zwischen der europäischen und der afrikanischen Platte markiert (von Mauls abwärts stehen wir auf Letzterer). Der Hochgeschwindigkeitstunnel wird nicht nur zwei Städte, sondern auch zwei Kontinente verbinden. Die Arbeiter, die den Tunnel graben, müssen mindestens 12 Stunden reisen, um von den Containern, in denen sie wohnen, nach Hause zu gelangen - Container, hinter denen (ebenfalls in Mauls) der private Flugplatz des Unternehmers Edmund Griesser liegt. Sein Tecnam P-92 könnte Rom in zweieinhalb Stunden erreichen. Mit einer größeren Treibstoffkapazität wäre er in weniger als vier Stunden in Kalabrien. Das Dorf entstand rund um die Eisenbahn, aber die neue Infrastruktur (BBT, aber auch die neue Strecke ins Pustertal) sieht eine Zukunft vor, in der kaum noch jemand in Franzensfeste halten wird.
Deshalb ist das Leben in Franzensfeste interessant und uns lieb.
Es scheint ein hoffnungsloses Gebiet zu sein, aber Franzensfeste ist an Schwierigkeiten und Veränderungen gewöhnt. Oddo Bronzo schließt seinen Brief mit einem Wunsch, der auch heute noch gilt, und zwar nicht nur auf lokaler Ebene. Die Epiphanie, von der ich sprach, überlasse ich seinen Worten: „Es stimmt, dass die bittersten Zeiten des Lebens einen romantischen Reiz haben. Es stimmt, dass eine traurige Erinnerung der Seele hartnäckiger anhaftet als eine süße. Aber es ist ebenso wahr, dass man hier in Franzensfeste in einer Gemeinschaft und Brüderlichkeit der Geister lebt, die umso liebenswerter ist, je seltener sie zu finden ist. Oft entspringen Gelassenheit und Freude nicht dem Wohlstand, der Ermüdung und Monotonie bringen kann, sondern jenen menschlichen Beziehungen, die - trotz aller Unterschiede - auch durch die Unbarmher- zigkeit der Natur eng zusammengeschweißt und durch ernsthafte Arbeit gefestigt werden. Deshalb ist das Leben in Franzensfeste interessant und uns lieb. Wenn hier einmal alles perfekt sein wird, wenn das Dorf das schöne, geordnete und monotone Erscheinungsbild aller anderen Dörfer annimmt, wenn alle Wünsche verschwinden, wenn Reichtum herrscht - dann wird vielleicht jenes besondere Etwas fehlen, jene Poesie, typisch für die latine Originalität des Unbehagens, die man erst dann versteht, wenn sie verloren gegangen ist."Francesca Cirilli – Durchgangsland-Terradipassaggio
Kuratiert von Stefano Riba
Foto Forum Bozen
Bis 26.04.2025More articles on this topic
Society | Podcast | Ep 42Terra di passaggio
Culture | Intervista/MostraInvisibile agli occhi degli altoatesini
Culture | Gastbeitrag Teil 1Durchgangsland-Terradipassaggio
ACHTUNG!
Meinungsvielfalt in Gefahr!
Wenn wir die Anforderungen der Medienförderung akzeptieren würden, könntest du die Kommentare ohne
Registrierung nicht sehen.







