Erfahrungsräume fürs Leben

-
Spielzeiten
Spielzeiten ist der Name unserer kleinen Reihe, die das Spielen von Kindern in den Mittelpunkt stellt.
-
Wer an Spielplätze denkt, sieht meist Schaukeln, Rutschen und Wippen. Für Landschaftsarchitekt Günter Dichgans ist das zu kurz gegriffen: „Ein Spielplatz besteht nicht nur aus ein paar Geräten, er ist ein komplexer Erfahrungsraum.“ Dieser Gedanke zieht sich durch seine Arbeit und auch durch die Haltung des Vereins für Kinderspielplätze und Erholung (VKE), den Dichgans seit den 1980er-Jahren begleitet.
Sicherheit alleine macht noch keinen Spielplatz.
Über Jahrzehnte hinweg setzte er sich mit der Gestaltung von Spielplätzen auseinander, beräiet Gemeinden, Schulen und Kindergärten in Südtirol und war als „Experte“ der italienischen Delegation an der Entwicklung der europäischen Sicherheitsstandards beteiligt. Doch Sicherheit alleine macht noch keinen Spielplatz aus, Naturerlebnis und -erfahrungen stehen gleichberechtigt nebeneinander.
-
Sicherheitsnormen und Instandhaltung:
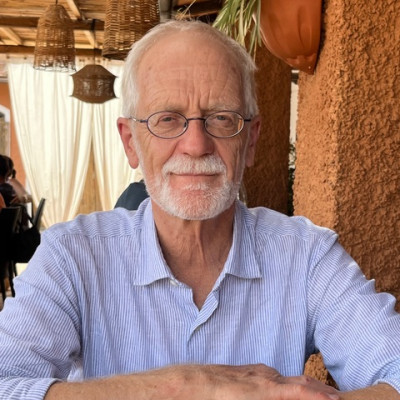 Günter Dichgans: „Bei komplexeren Anlagen ist es für den Auftraggeber ratsam, eine Endabnahme von fachlich kompetenten Institutionen, wie beispielsweise dem TÜV, zu beauftragen.“ Foto: privat
Günter Dichgans: „Bei komplexeren Anlagen ist es für den Auftraggeber ratsam, eine Endabnahme von fachlich kompetenten Institutionen, wie beispielsweise dem TÜV, zu beauftragen.“ Foto: privatDichgans begann seine Laufbahn mit der Planung von Gärten und Parkanlagen. Mitte der Achtziger lernte er den VKE kennen. „Der VKE suchte einen Landschaftsarchitekten, weil man der Meinung war, dass ein Spielplatz mehr braucht als Schaukel, Rutsche und Wippe. Kinder sollen Bäume, Wasser, Steine und Sand erleben und damit spielen können.“ Aus diesem Ansatz heraus entwickelte er Konzepte, die weit über die Anlage von standardisierten Geräteparks hinausgingen.
Über den VKE brachte er italienische Hersteller mit dem deutschen TÜV zusammen und wirkte an der Harmonisierung der europäischen Sicherheitsnormen mit. Seit 1999 gilt europaweit die Norm EN 1176, die Geräte und Konstruktionen auf einen gemeinsamen Standard verpflichtet.
„Wie beim Auto braucht es regelmäßige Wartung.“
Zur Sicherheit gehört nicht nur die Planung und die bauliche Umsetzung nach Norm, sondern auch diekontinuierliche Kontrolle und Instandhaltung im Alltag. So können normgerechte Geräte entwickelt und ordnungsgemäß eingebaut werden, hier reicht eine Konformitätserklärung des Herstellers.
Bei komplexeren Anlagen, die speziell für einen Themenspielplatz neu entwickelt werden, sei es allerdings für den Auftraggeber ratsam, eine Endabnahme von fachlich kompetenten Institutionen, wie beispielsweise dem TÜV, zu beauftragen. Danach liegt die Verantwortung bei den Betreibern, bei öffentlichen Spielplätzen also bei den Gemeindeverwaltungen.
Am Anfang sei jeder Spielplatz sicher, wenn er fachgerecht gebaut wurde, erklärt Dichgans, aber: „Wie beim Auto braucht es regelmäßige Wartung. Wenn diese nicht erfolgt und dokumentiert ist, entscheidet ein Richter im Falle eines Unfalls schnell auf fahrlässige Verletzung“.
In Bozen etwa übernehme die Dienststelle Gärtnerei mittels externer Prüfer die regelmäßige Kontrolle, bei der notwendige Wartungsmaßnahmen ein bis zweimal im Jahr dokumentiert und anschließend von Fachfirmen durchgeführt werden. So können verborgene Gefahren rechtzeitig beseitigt werden.
In vielen Dörfern kommen die Gemeinden ihrer Verantwortung nach, indem sie Mitarbeiter des Bauhofes dafür abstellen, zum Teil auch durch Fortbildung in ihrer Kompetenz stärken, oder sie beauftragen externe Fachleute und Firmen für die notwendigen Kontroll- und Reparaturarbeiten.
Auch bei den Materialien spielen Überlegungen zu Sicherheit und Nachhaltigkeit zusammen. Dichgans plädiert für natürliche Lösungen. „Sand, Rinde oder Kies sind oftmals nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger als Gummiplatten.“ Diese würden durch UV-Strahlung schnell hart, wodurch sie ihre dämpfende Wirkung verlieren und nach wenigen Jahren ersetzt werden müssten. In Städten setze man dennoch oft auf synthetische Beläge, da sie weniger Wartung benötigen würden und Barrierefreiheit ermöglichen.
„Alle Spielplätze barrierefrei zu machen, vor allem in Berggemeinden, ist kaum zu schaffen.“
Womit wir beim Stichwort Inklusion wären. Diese sei ein sehr wichtiges Ziel und großes Anliegen, allerdings auch eine Herausforderung, da eine vollständige barrierefreie Gestaltung schwer realisierbar sei: „Alle Spielplätze barrierefrei zu machen, vor allem in Berggemeinden, ist kaum zu schaffen“. Aber in Gebieten mit vielen Kindern mit Behinderung - zum Beispiel in Nähe von Betreuungseinrichtungen - sei der zusätzliche Aufwand gerechtfertigt. Aber auch „normale“ Geräte wie Nestschaukeln könnten Begegnung ermöglichen, oder wenigstens die Möglichkeiten des unterstützten gemeinsamen Spiels bieten.
Natur und Spiel:Besonders deutlich beschreibt Dichgans, warum Naturerfahrungen auf Spielplätzen wichtig sind. Für ihn gehe es nicht nur um Bewegung, sondern um die ganzheitliche Entwicklung. Kinder sollen lernen, sich auf unebenem Gelände zu bewegen, auf Hügel zu klettern oder an Hängen hinunterzurutschen. Solche Erfahrungen seien entscheidend für die psychomotorische Entwicklung und könnten durch standardisierte Geräteparks allein nicht ersetzt werden.
„Es ist ungemein wichtig, dass Kinder Erfahrungen in der Natur machen können.“
„Es ist ungemein wichtig, dass Kinder nicht nur auf glatten Pflaster- oder Asphaltflächen aufwachsen, sondern diese Erfahrungen in der Natur machen können“, sagt Dichgans. Südtirol habe hier zwar einen Vorteil, weil Natur vielerorts vor der Haustür beginne, doch sei diese „Natur“ oft intensiv landwirtschaftlich genutzt und somit für das Spiel nicht verfügbar. Die „bespielbare“ Natur sei zwar auch nicht allzuweit entfernt, jedoch nur in Begleitung Erwachsener zu erreichen und somit oft auf das Wochenende beschränkt, wenn Eltern Zeit haben.
„Ein Spielplatz für Drei- bis Zehnjährige sollte in fünf Minuten zu Fuß erreichbar sein.“
Gerade deshalb brauche es Spielplätze in der Nähe, die Kindern den Alltag mit Naturerfahrungen ermöglichen. „Ein Spielplatz für Drei- bis Zehnjährige sollte in fünf Minuten zu Fuß erreichbar sein, ein Spielplatz für Kinder bis zum Mittelschulalter in höchstens fünfzehn Minuten - dieser sollte auch die Möglichkeit zum Ballspielen geben.“
Wie solche Anlagen aussehen können, zeigen Spielplätze, die der VKE in Zusammenarbeit mit Dichgans und Gemeinden umgesetzt hat. In Bozen-Gries etwa gibt es einen Platz mit Wasserlauf, Sandflächen, Kletterelementen und Schattenzonen, der sowohl Kinder als auch Begleitpersonen anspricht. In kleinen Gemeinden wurden naturnahe Spielplätze mit Hügeln, Bäumen und Steinen realisiert, die es Kindern ermöglichen, aktives Spiel mit und in der Natur zu erleben.
Spielplatz ganzheitlich gedacht:Auch der VKE selbst betont, dass Spielplätze keine Nebensache seien, sondern wichtige Lebensräume und soziale Treffpunkte. Sie sollen Bewegungsmöglichkeiten, Rückzugsräume und ein Miteinander ermöglichen und durch die Raumplanung rechtzeitig gesichert werden. Gemeinden sollen Kinder und Jugendliche aktiv in die Planung einbeziehen und bei der Ausführung möglichst auf nachhaltige Materialien setzen. Wichtig sei auch die gute Erreichbarkeit: Spielplätze müssen fußläufig erreichbar sein und in ein Netz von Grünflächen, Geh- und Radwegen eingebettet werden. In einer Broschüre wurden solche Forderungen aufgelistet.
„Nicht nur Kinder, auch Großeltern sollen sich dort wohlfühlen.“
Ein Spielplatz, wie ihn sich Dichgans und der VKE vorstellen, verbindet klassische Bewegungsgeräte mit natürlichen Elementen: Hügel, Sträucher, Steine, Sand- und Kiesflächen, Wasserstellen, künstliche Beschattung oder natürlicher Baumschatten, Ruhebereiche und Angebote für Rollenspiele. Dazu kommen Sitzgelegenheiten für Begleitpersonen und barrierefreie Wege. „Nicht nur Kinder, auch Großeltern sollen sich dort wohlfühlen.“ So werden Spielplätze zu Orten, die Generationen verbinden und soziale Treffpunkte anbieten.
Auch Schulhöfe sehen Dichgans und der VKE als zentrale Räume mit großem Potential, vor allem in den kleineren Gemeinden, da der Schulhof oft die einzige Möglichkeit zum Ballspielen bietet. „Gerade auf Schulhöfen passieren viele Unfälle, wenn Kinder keine sinnvollen Angebote haben und wild durcheinander laufen.“
Pausenhöfe sollten vielfältiger gestaltet werden und auch außerhalb der Unterrichtszeiten geöffnet bleiben. Damit würden sie zu zentralen Plätzen zum Spielen und Sich-Treffen, die für Kinder und Jugendliche gleichermaßen wichtig sind.
„Wenn da bereits Bäume und Sträucher stehen, sollte man sie nicht gedankenlos beseitigen.“
Für die Zukunft wünscht sich Dichgans, dass Gemeinden Spielplätze und Freiflächen stärker als Teil der Naherholung begreifen. Dabei gehe es nicht nur um Kinder, sondern auch darum die Bedürfnisse Jugendlicher einzubeziehen, die Treffpunkte und Bewegungsmöglichkeiten brauchen, etwa mit Ballspielplätzen, Fitness- und Calisthenics-Anlagen.
So gäbe es für alle die Möglichkeit, sich auch außerhalb eines Vereins sportlich zu betätigen, Ball zu spielen und Gruppensport zu betreiben. Entscheidend sei, Natur zu integrieren, statt sie zu verdrängen: „Wenn da bereits Bäume und Sträucher stehen, sollte man sie nicht gedankenlos beseitigen, sondern in die Planung einbeziehen und als Spiel- und Schattenelemente integrieren.“
Spielplätze sind nach Dichgans „sichere“ Orte, insofern das Spielangebot mit einem kontrollierten Risiko verbunden ist, ohne das ein Spiel oder eine Bewegungserfahrung langweilig sind. Zudem sind sie Orte der Erfahrung, Kreativität und Begegnung. Räume, in denen Kinder ihre Umwelt begreifen, Generationen einander begegnen und Gemeinschaft wachsen kann. Damit sie diese Rolle erfüllen können, brauche es neben engagierten Planern vor allem Gemeinden, die den Wert von Spiel und Freiflächen anerkennen und in die Zukunft investieren.
Es brauche Mut zu neuen Projekten und kreativer Umsetzung und die Überzeugung, dass Spielplätze mehr sind als eine Ansammlung von Geräten: Sie sind Erfahrungsräume fürs Leben.
Articoli correlati
Gesellschaft | SpielzeitenRecht auf Spiel und Freizeit
Politik | TeilhabeDer Handwerker-Effekt
Umwelt | Öffentlicher ZugangDie Seesorge










Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.