Eins, zwei, Polizei...

-
Seit dem Sonntag vor zwei Wochen ist am Peršmanhof in Eisenkappel/Železna Kapla (Kärnten) nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. Rund 30 Polizeikräfte rückten mit Munition, Hunden, Hubschraubern und Drohnen an und stürmten nicht nur eine Gedenkstätte, sondern vor allem einen denkwürdigen Ort des faschistischen Widerstands. Das Warum ist zwei Wochen später immer noch nicht geklärt. Das große Schweigen dazu aus Südtirol ebenfalls nicht.
Dieser Einsatz am Peršmanhof, der Gedenkstätte eines der größten Traumata der Kärntner Sloweninnen, hätte nie so passieren dürfen.
-
 Unnötig und unerklärlich: Der Polizeieinsatz am Peršmanhof in Bad Eisenkappel wirft viele Fragen auf. Foto: Zdravko Haderlap
Unnötig und unerklärlich: Der Polizeieinsatz am Peršmanhof in Bad Eisenkappel wirft viele Fragen auf. Foto: Zdravko HaderlapDer Bergbauernhof Peršmanhof war ab 1942 ein wichtiger Stützpunkt der Widerstandsbewegung gegen den Nazifaschismus. Kurz vor Ende des Krieges, am 25. April 1945, erschossen SS und Polizei am Peršmanhof Angehörige der Familien Sadovnik und Kogoj – insgesamt elf Personen. 2012 wurde der Hof zu einem modernen, zweisprachigen Museum ausgebaut. Es bietet interaktive Ausstellungen zu Verfolgung und Widerstand, insbesondere zur Kärntner slowenischen Minderheit.
„Slowenische Partisanen in Südkärnten leisteten während des Zweiten Weltkriegs den stärksten militanten Widerstand gegen das Nazi-Regime und trugen entscheidend zur Wiederherstellung eines unabhängigen österreichischen Nationalstaates bei“, weiß der Minderheitenbeauftragte der Eurac in Bozen, Günther Rautz. Er selbst stammt aus Eisenkappel/Železna Kapla, kennt die Situation vor Ort genau und berichtete nur einen Tag nach der Razzia auf dem Blog der Eurac. „Vor diesem historischen Hintergrund hat die Störung dieser Stätte durch einen gewaltsamen Polizeieinsatz viele verunsichert und über die Region hinaus auf europäischer Ebene Besorgnis ausgelöst“, schreibt er. Der Vorfall unterstreiche „die Notwendigkeit eines respektvollen und kulturbewussten Umgangs mit Gedenkstätten, insbesondere mit solchen, die mit den Erfahrungen von Minderheiten und historischen Traumata verbunden sind.“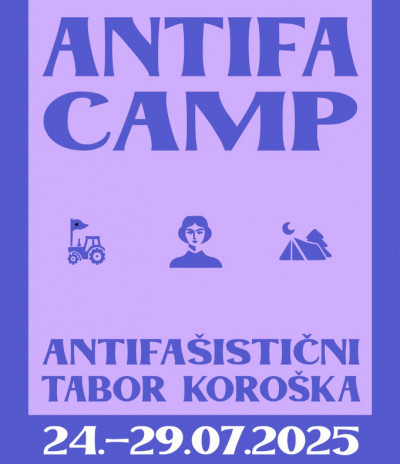 Unerwünschtes Camp?: Das von den Einsatzkräften gestürmte Camp widmete sich den Themen Erinnerungskultur, der aktuellen politischen Lage, dem Rechtsruck in Europa und der Frage, wie eine soziale und ökologische Zukunft aussehen kann. Foto: Antifa Camp Kärnten/Koroška - Antifašistični Tabor na Koroškem
Unerwünschtes Camp?: Das von den Einsatzkräften gestürmte Camp widmete sich den Themen Erinnerungskultur, der aktuellen politischen Lage, dem Rechtsruck in Europa und der Frage, wie eine soziale und ökologische Zukunft aussehen kann. Foto: Antifa Camp Kärnten/Koroška - Antifašistični Tabor na KoroškemZum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes befanden sich am Hof rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines mehrtägigen antifaschistischen Jugendcamps. Sie waren aus mehreren Teilen Österreichs, aber auch aus Italien und der Schweiz angereist. „Es ist noch immer unklar, wie die Befehlskette war, von wem die Anzeigen oder Hinweise wegen angeblicher Verwaltungsübertretungen kamen und warum dieses Großaufgebot an Einsatzkräften hinzugezogen wurde“, berichtet die Autorin Ana Grilc, die 2023 den Literaturpreis des Landes Kärnten für Kurzgeschichten erhielt und als engagierte Kennerin der Geschichte sowie dem aktuellen Befinden der Kärntner Sloweninnen und Slowenen gilt. „Es scheint, dass die Beteiligten hier einen Schlag gegen ,links' und gegen die Volksgruppe vollziehen wollten. Einsatzkräfte, die am Villacher Kirchtag aufgrund des erhöhten Terrorrisikos stationiert waren, wurden hinzugezogen und trafen in Rekordgeschwindigkeit ein. Auch der Völkermarkter Bezirkshauptmann, der über lange Zeit das Ustaša-Treffen in Bleiburg/Pliberk ermöglichte, war vor Ort.“
Ustaša-Treffen? Jedes Jahr Mitte Mai wird das Loibacher Feld in Kärnten – eine knappe halbe Autostunde von Bad Eisenkappel – zur Pilgerstätte kroatischer Rechtsextremer. Aber nicht nur. Die Veranstaltung auf einem Privatgrundstück hat sich inzwischen zu einem der größten Treffen von Faschistinnen und Faschisten in Europa entwickelt. Doch während die Polizei dort auf dem rechten Auge blind zu sein scheint, ist ihr Vorgehen bei den Antifaschisten und Antifaschistinnen umso härter. „Es scheint bei den offiziellen Stellen an Wissen und Sensibilisierung zu fehlen“, vermutet Grilc. „Dieser Einsatz am Peršmanhof, der Gedenkstätte eines der größten Traumata der Kärntner Sloweninnen, hätte nie so passieren dürfen.“ Große Protest- und Solidaritätswelle: Der Peršmanhof, sowohl Tatort eines NS-Kriegsverbrechens als auch ein Ort der Aufarbeitung und des Gedenkens, wird oft in einem Atemzug mit anderen Erinnerungsorten wie dem KZ Mauthausen genannt – allerdings mit besonderem Fokus auf lokalen Widerstand und Minderheitengeschichte. Der Vorfall löste eine breitere Debatte über Erinnerungskultur, Minderheitenrechte und die Rolle der Staatsgewalt in Österreich aus. Foto: Zdravko Haderlap
Große Protest- und Solidaritätswelle: Der Peršmanhof, sowohl Tatort eines NS-Kriegsverbrechens als auch ein Ort der Aufarbeitung und des Gedenkens, wird oft in einem Atemzug mit anderen Erinnerungsorten wie dem KZ Mauthausen genannt – allerdings mit besonderem Fokus auf lokalen Widerstand und Minderheitengeschichte. Der Vorfall löste eine breitere Debatte über Erinnerungskultur, Minderheitenrechte und die Rolle der Staatsgewalt in Österreich aus. Foto: Zdravko HaderlapUnd was macht die Politik? Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser versuchte sich nach dem Vorfall sofort als Schlichter, scheint aber nach zwei Wochen eher auf eine altbewährte Strategie zu setzen: Totschweigen. Innenminister Gerhard Karner von der Volkspartei verteidigt den Einsatz von Polizei, von Staatsschutz sowie Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen. Belege dafür liefert er nicht. Sloweniens Präsidentin Nataša Pirc Musar – sie bezeichnete den Gewalteinsatz als unverhältnismäßig – schloss sich ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen an und rief zur Zurückhaltung auf. In Wien und Celovec/Klagenfurt versammelten sich nach dem Vorfall zahlreiche Menschen zu Protestkundgebungen.
Und in Südtirol? Die Politik hält sich zu dieser überzogenen Aggression auf eine Minderheit und deren Geschichte vornehm zurück. Dabei wäre es mehr als löblich, wenn sich lokale politische Gruppierungen, die den Antifaschismus nicht nur als Fassade vor sich hertragen, zum Vorfall in Kärnten äußern würden – wie einst der bekannte Journalist aus Sexten, Claus Gatterer.
Die Politik hält sich zu dieser überzogenen Aggression auf eine Minderheit und deren Geschichte vornehm zurück.
 Vor 50 Jahren: Nach der TV-Dokumentation „Fremde in der Heimat“ (ORF, 1975) von Trautl Brandstaller über das Minderheitenproblem in Kärnten, wird Claus Gatterer in einer anschließenden Diskussionsrunde (ORF, 18. 6. 1975) hart angegriffen. Foto: Gatterer9030
Vor 50 Jahren: Nach der TV-Dokumentation „Fremde in der Heimat“ (ORF, 1975) von Trautl Brandstaller über das Minderheitenproblem in Kärnten, wird Claus Gatterer in einer anschließenden Diskussionsrunde (ORF, 18. 6. 1975) hart angegriffen. Foto: Gatterer9030Das Schweigen aus Südtirol ist einfach erklärt: Im Falle von Kärnten spricht die Minderheit nämlich Slowenisch und nicht Deutsch. Dementsprechend fehlt es an Stellungnahmen. Vielleicht organisiert ja die Südtiroler Landesregierung einen überparteilichen spätsommerlichen „Autonomie“-Ausflug zur Gedenkstätte Peršmanhof. In Sachen Minderheiten und Antifaschismus hat man ja nie ausgelernt – in Südtirol, Kärnten und anderswo.
Das quasi verschobene Verhältnis der beiden Minderheiten in Südtirol und Kärnten belegt auch eine weitere Tatsache, die Jahrzehnte zurückliegt, als das noch arme Südtirol auf Kulturgelder aus Österreich angewiesen war. Damals kamen die Gelder aus allen österreichischen Bundesländern – nur nicht aus Kärnten. Zwar hätten die Kärntner Politiker damals gerne die deutschsprachige Minderheit in Südtirol finanziell bezuschusst, wie aber hätten sie dann ihr Nichtstun in Minderheitenfragen im eigenen Land erklärt?
„Der Antislowenismus in Kärntens Strukturen und Gesellschaft ist wieder sichtbar geworden“, meint Ana Grilc, „es wird versucht, antifaschistische Arbeit zu kriminalisieren und die Volksgruppe wurde wieder Ziel polizeilicher Willkür. Bei vielen Kärntner Sloweninnen und Slowenen ist das Vertrauen in das Land und seine Organe erschüttert.“
Nun geht es um vollständige Aufklärung. Und um Konsequenzen.Articoli correlati
Kultur | Salto Weekend"Sturm im Wasserglas"
Kultur | Salto AfternoonBlaue Vorurteile
Kultur | GedenktagAntifaschistische Nudeln



»Das Schweigen aus Südtirol…
„Das Schweigen aus Südtirol ist einfach erklärt: Im Falle von Kärnten spricht die Minderheit nämlich Slowenisch und nicht Deutsch. Dementsprechend fehlt es an Stellungnahmen.“
Ich halte das für ziemlich großen Blödsinn. Die Südtiroler Solidarität mit den Kärntner Sloweninnen war immer groß — und das schätzen sie auch sehr, wie ich aus erster Hand erfahren durfte.
Es ist faszinierend und…
Es ist faszinierend und traurig wie NS-Gedenkstätten sowohl linke als auch rechte Extremisten anziehen - auf Kosten der Opfer denen eigentlich gedacht werden sollte.
Was die Solidarität angeht: ich als Angehöriger einer deutschsprachige Minderheit in Südtirol solidarisiere mich logisch auch mit anderen Minderheiten, auch wenn sie nicht deutsch sprechen oder nicht christlich sind.
Es ist sehr tendenziös, „den Südtirolern“ zu unterstellen, andere Minderheiten seien ihnen egal.
In risposta a Es ist faszinierend und… di Oliver Hopfgartner
Ich verstehe es eher so,…
Ich verstehe es eher so, dass dieser Vorwurf an die Politik adressiert ist, nicht an die Südtiroler allgemein.
Ich bin vor einigen Jahren…
Ich bin vor einigen Jahren eingeladen worden, in Bled in Slowenien einen Vortrag über die historischen Beziehungen zwischen Bled und Brixen und zwischen Slowenien und Tirol zu halten. Das Interesse war riesengroß und die folgende Diskussion hat manche Missverständnisse und Fragen geklärt, aber auch viele neue Fragen aufgeworfen. Vor allem ein Vergleich zwischen den großen Umvolkungsaktionen hat das Verständnis für die jeweiligen Minderheitensituation gestärkt. Mit der Option wollten Nazis und Faschisten die Südtiroler aus Südtirol vertreiben. Die gleichen Beamten, die das dafür zuständige ADEuRSt-Büro in Brixen betrieben haben, waren dann in Bled dafür zuständig, Slowenen zu vertreiben und dafür Deutsche anzusiedeln. Pikant ist auch, dass Josip Broz, genannt Tito, der als Partisanenführer für die Vertreibung tausender Deutscher und für zahlreiche Massaker zuständig war, seine Wurzeln in der zimbrischen Minderheit im Welschtiroler Brandtal hatte. Je besser man die Geschichte kennt und sich der Fehler und der Verbrechen, die mehr oder weniger von allen Seiten begangen wurden, bewusst ist, um so eher kann man in einem friedlichen Dialog zueinander finden. Veranstaltungen wie die italienischen Foibe-Gedenken, bei denen nur slowenische Untaten erwähnt und die faschistischen Verbrechen in Slowenien verschwiegen werden, sind ein Musterbeispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Polizeiaktionen wie in Eisenkappel ebenso.
In Südtirol "groaß redn" In…
In Südtirol „groaß redn“
In ROM „brav kuschn“
Die SLOVENEN „tratzn“
https://www.diepresse.com…
https://www.diepresse.com/19658298/verein-will-ustascha-treffen-wiederb…
Ich, als Kärntner Slovenin,…
Ich, als Kärntner Slovenin, seit vielen Jahren in Südtirol lebend weiss, dass es Solidarität der Südtiroler Bevölkerung für die Anliegen der slovenischen Volksgruppe in Kärnten gibt. Claus Gatter war ein Vorreiter und setzte sich immens für die Rechte der Kärntner Slovenen welche im Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrag festgehalten und nach 70 Jahren nach wie vor nicht umgesetzt sind, ein.
Was den skandalösen Vorfall am Persmanhof betrifft, wäre es schlicht und einfach gut wenn sich das offizielle Südtirol dazu äussern würde.
Das offizielle Südtirol wird…
Das offizielle Südtirol wird wegen einer Hand voll Slowenen doch nicht der „Schutzmacht“ ans Bein pinkeln, wäre ja noch schöner.
In risposta a Das offizielle Südtirol wird… di Dominikus Ande…
🤣
🤣
In risposta a Das offizielle Südtirol wird… di Dominikus Ande…
Man hütet sich ja auch,…
Man hütet sich ja auch, Italien wegen der unsäglichen Foibe-Legende, die auf rassistischen Hass gegen die Slowenen beruht, ans Bein zu pinkeln. Da macht man sich lieber in die Hosen.
In risposta a Man hütet sich ja auch,… di Hartmuth Staffler
Bezüglich der Foibe: in…
Bezüglich der Foibe: in Italien bzw. in der italienischen Politik sind sehr sehr Viele mehr als glücklich darüber, das niemand Niemanden ans Bein pinkelt. Stellen Sie sich mal vor, wie anstrengend es wäre neue Feindbilder aus dem Hut zu zaubern.
In risposta a Bezüglich der Foibe: in… di sommeregger tatjana
Es braucht keine neuen…
Es braucht keine neuen Feindbilder. In Italien wird das alte Feindbild von den bösen Slowenen, die angeblich die guten Italiener ermordet haben, sorgsam gepflegt.
Eigentlich wäre man geneigt…
Eigentlich wäre man geneigt zu sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, in Wirklichkeit tut Sie dies auch nicht aber die Dummheit der Menschen bringt und diese gefühlte Wiederholung. Da ist die letzte Kriegsgeneration noch nicht ganz unter der Erde und es kehren die ganzen dumpfen Nationalisten auf die Bühne zurück. Früher hiesen die Protagtonisten Hitler und Stalin und heute Putin und Trump.
SCHUTZ-MACHT ... für was?
SCHUTZ-MACHT ... für was?
Danke für diesen wichtigen…
Danke für diesen wichtigen Artikel. Einfach vollkommen unnötig, schrecklich und absurd dieser Einsatz. Die Polizei scheint hier ihre Macht politisch missbraucht zu haben - leider nicht zum ersten Mal. Dies sollte eine Warnung für uns Südtiroler:innen sein und auch ein Anlass, unsere Solidarität zu zeigen!