Corona ist ein Outlier, aber...
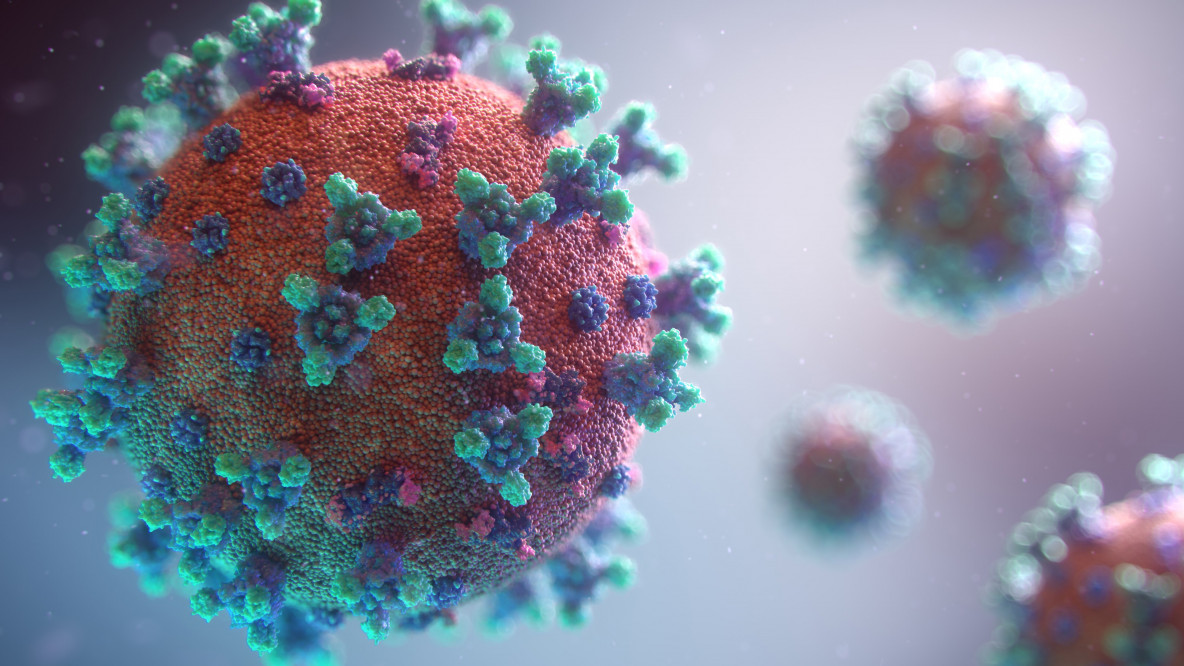
Taiwan, Südkorea, oder Hongkong. Ihnen allen ist im Umgang mit dem Coronavirus eines gemein: Sie reagierten schnell, nutzten ihnen zur Verfügung stehendes Datenmaterial und kommunizierten Transparent mit der Bevölkerung. Vielfach funktioniert diese Information auch direkt auf das Handy der einzelnen Bürger. Taipeh etwa informierte über eine zentrale Notfall-SMS, welche Orte eine mit dem Coronavirus infizierte chinesische Touristin aus Wuhan besucht hatte. Jede und jeder, der sich dort aufgehalten hatte wusste es sofort und konnte sich entsprechend verhalten. Im Unterschied zu vielen europäischen Ländern gelang es diesen Ländern, die Pandemie schneller in den Griff zu bekommen. Warum? Weil sie darauf vorbereitet waren. Die Sars-Epidemie 2003 und die Mers-Epidemie 2015 hatten die Länder schwer erwischt. Daraus haben sie Lehren gezogen und Krisenpläne erarbeitet. „Auch Europa wird sich auf ähnliche Ereignisse wie das Coronavirus einstellen müssen,“ so Prof. Christian Lechner, Wirtschaftsprofessor an der Freien Universität Bozen, „Die Corona-Pandemie ist zwar ein Outlier-Event, aber keine absolute Ausnahmeerscheinung, die nur alle 100 Jahre wieder auftritt.“
Was sind Outlier?
Außergewöhnliche Ereignisse oder Persönlichkeiten, die sich grundlegend von der allgemeinen Masse unterscheiden, werden als Outlier (dt. Ausreißer) bezeichnet. Dabei können diese positiv oder auch negativ sein. Ein Outlier ist ein statistischer Ausreißer, der von der regulären Erwartungen abweicht. „Auf den ersten Blick,“ so Prof. Lechner, „mag das Coronavirus mit seinen extremen Folgen für die Gesundheitssysteme und die Wirtschaft, als etwas vollkommen Außergewöhnliches und Seltenes betrachtet werden“. Doch bei genauerer Betrachtung fällt auf: „Betrachten wir die vergangenen 35 Jahre so gab es zahlreiche ‚außergewöhnliche Ereignisse‘ mit einem erheblichen Einfluss auf unser Gesundheits- und Wirtschaftssystem. In den 1980er Jahren grassierte AIDS, 1999 der Rinderwahnsinn, 2002 die Internet-Bubble, 2003 Sars 1, 2008 die Finanzkrise, 2015 Mers, 2017 Ebola und eben jetzt das Coronavirus. Was diese Ereignisse gemeinsam haben, ist, dass sie einen überproportionalen Effekt hatten und öfter vorkommen, als es herkömmliche Modelle voraussagen würden.“
Bei Ausbrüchen von Pandemien ist es meist nicht eine Frage des Ob, sondern meist des Wann.
Mehrfach wurde in den vergangenen Jahren vor einer Pandemie gewarnt, legendär ist Bill Gates TEDTalk von 2015, als er warnte "„Wir sind nicht bereit für eine Epidemie“. Unser Wirtschafts- und unser Gesundheitssystem müsse aus der aktuellen Situation lernen, so Lechner. Insgesamt müsse das System resilienter werden. „Es braucht mehr Investitionen ins Gesundheitssystem und mehr Innovation in der Wirtschaft. Mehr Geld muss in die Unis fließen, weil dort Grundlagenforschung betrieben wird als langfristiger Hebel für Innovationen. In Italien wurde in den vergangenen 30 Jahren sowohl bei den Unis als auch im Gesundheitswesen massiv eingespart.“
Vorbereitet sein
Viele Staaten weltweit haben mit einem Lockdown Schlimmeres verhindert. Weil Corona aber ein Outlier-Event ist, der bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, müssen wir schon heute damit beginnen, kostengünstigere und praktikable Lösungen für eine neue Pandemie zu entwickeln, da ein nächster Outlier innerhalb der nächsten Dekade zumindest wahrscheinlich ist, so Prof. Lechner. „Wir können nicht zur Normalität zurückkehren und so tun, als ob es keine Outlier mehr geben wird. In unserer hoch vernetzten Welt werden Outlier zunehmende wahrscheinlicher“. Neben den Investitionen ins Gesundheitssystem spielen hier Apps für die Früherkennung eine wichtige Rolle, das haben nicht zuletzt Länder wie Taiwan bewiesen. Auch die Weltgesundheitsorganisation sah in den Apps eine wichtige Unterstützung bei der Eindämmung der Pandemie, der deutsche Virologe Christian Drosten sieht das Tracking als „wissenschaftlich vielversprechend. Vor allem wenn es darum geht, das Virus in einem Frühstadium zu bekämpfen.“ Seit wenigen Wochen ist in Italien die App „Immuni“ aktiv. 60 Prozent der Bevölkerung müssten die App installieren, damit sie eine Wirkkraft hat, das wären alle Handybenutzer Italiens. Doch die Zustimmung in der Bevölkerung ist verhalten. „Dabei,“ so Claus Pahl, Professor für Computer Science an der Freien Universität Bozen, „benötigt die App keine Berechtigungen und greift auch nicht auf Kontakte zu. Personendaten werden also nicht gesammelt. Die Daten, welche die App sammelt, können also kaum gegen uns verwendet werden.“
Viele stehen der App skeptisch gegenüber, haben Angst vor totaler Überwachung. „In Italien, wie etwa auch in Deutschland wurde die App so wenig invasiv wie möglich entwickelt,“ so Prof. Pahl, „nur eine minimale Zahl an Daten wird ausgetauscht. Und solange ich gesund bin, wird mit meinen Daten nichts geschehen. Im Bluetooth-Protokoll wird gespeichert, wenn es einen längeren Kontakt gegeben hat. Erst wenn eine der beiden Personen infiziert wird, dann wird die Info an einen zentralen Server weitergegeben.“
Für das Gesundheitswesen ist diese Information wichtig, weil man vor allem schnell an jene Kontakte kommt, die ansonsten schwierig nachzuvollziehen sind, etwa, wenn man an der Supermarktkasse in der Schlange steht oder im Restaurant neben einer infizierten Person gesessen hat.
Auf die Frage, wie viel wir als Individuen bereit sind dem Staat zu geben, hat vielleicht Cicero in seinem „De re publica“ eine passende Antwort: Aber nicht unter der Bedingung hat uns das Vaterland in die Welt gesetzt und aufgezogen, dass es gewissermaßen keinen Erzieherlohn von uns zu erwarten hätte und eben nur unserem Vorteil diente und uns einen sicheren Zufluchtsort für unser Privatleben und einen störungsfreien Raum für unsere Ruhe verschaffte, sondern dass es die meisten und größten Teile unseres Mutes, unserer Begabung und unseres Denkens zu seinem Nutzen in Anspruch nähme und uns nur das zu seiner privaten Verwendung überließe, worauf es selbst verzichten könnte."

Die Verweigerung der App ist
Die Verweigerung der App ist zu einer Gesinnung geworden, die leider immun gegen jede Argumentation ist.
In risposta a Die Verweigerung der App ist di Andreas Mozzelin
Es gibt aber auch Argumente
Es gibt aber auch Argumente die App nicht zu benutzen und zwar der persönliche Nutzen/Kosten. Solange jemand keine Symtome zeigt ist es für ihn persönlich besser nicht herauszufinden ob er nun infiziert ist oder nicht, da im Falle eines positiven Test ist er dann dazu verpflichtet in Quarantäne zu gehen. Wie man sehen kann, werden aktuell Gelder sehr verzögerlicht ausgezahlt. Es gibt genug abhängig Angestellte, die im Krankheitsfall kein oder sehr spät ihr Geld erhalten. Diese werden es sich zweimal überlegen ob sie sich selbst melden solange es ihnen gesundheitlich gut geht.
In risposta a Es gibt aber auch Argumente di gorgias
Es wird so sein wie sie sagen
Es wird so sein wie sie sagen.
Das ist die viel verlangte Eigenverantwortung und Hausverstand....
Wenn’s dann ernst wird, denkt jeder nur an sich.
In risposta a Es gibt aber auch Argumente di gorgias
“Solange jemand keine Symtome
„Solange jemand keine Symtome zeigt ist es für ihn persönlich besser nicht herauszufinden ob er nun infiziert ist oder nicht, da im Falle eines positiven Test ist er dann dazu verpflichtet in Quarantäne zu gehen“:
ja, das ist dann der beste Weg, dass die Pandemie wieder Fahrt auf nimmt; es ist also nichts mit der „Verantwortung des Bürgers“.
Cicero lässt grüßen!
In risposta a Es gibt aber auch Argumente di gorgias
Auf alle Fälle erlaubt mir
Auf alle Fälle erlaubt mir die Warnung eine Risikobewertung der letzten Tage vorzunehmen. Sollte ich Bedenken haben, mich bei der Sanität zu melden, so kann ich doch zum Schutz beitragen, indem ich zumindest die nächsten Tage mehr Abstand halte.
In risposta a Es gibt aber auch Argumente di gorgias
"Solange jemand keine Symtome
„Solange jemand keine Symtome zeigt ist es für ihn persönlich besser nicht herauszufinden ob er nun infiziert ist oder nicht, da im Falle eines positiven Test ist er dann dazu verpflichtet in Quarantäne zu gehen.“
Wie bitte? Das ganze Informationssystem, das der App zugrunde liegt, basiert ja auf dem Verantwortungsbewusstsein der Bürger und Sie kommen mit so einer Aussage?
In risposta a "Solange jemand keine Symtome di Manfred Klotz
Nicht nur auf das
Nicht nur auf das Verantwortungsbewusstsein, sondern auch auf die Aufopferungsbereitschaft. Denn nicht jeder ist in der selben ökonomischen Situation. Es gibt Menschen die können es sich wortwörtlich nicht leisten krank zu sein. Menschen die darauf verzichten sich krank zu melden, weil sie Angst haben den Arbeitsplatz zu verlieren. Es gibt andere die verlieren zwar nicht die Arbeitsstelle aber haben nicht genügend Liquidität um 3 Monate zu überbrücken bis die Ausgleichskasse ihnen das Geld gibt.
Es ist nicht zufällig dass in Deutschland ausgerechnet in der Fleischverwertung und beim Spargelstechen die Epidemie aufgetreten ist, wo man Billiglöhner aus dem Osten rekrutiert und in Österreich bei den Postsortierern die kein Geld im Krankheitsfall bekommen. Und dass in den USA wo die Sozialsysteme desaströs sind die Epidemie sich bestens entfalten kann ist auch kein Zufall.
Ich finde es erstaunlich, dass Sie diesen sozioökonomischen Aspekt auszublenden, um sich zu echauffieren. Es müsste doch möglich sein, dass Sie den Kontext eines fünf Sätze langen Absatz erfassen können.
In risposta a Nicht nur auf das di gorgias
“Ich finde es erstaunlich,
„Ich finde es erstaunlich, dass Sie diesen sozioökonomischen Aspekt auszublenden, um sich zu echauffieren. Es müsste doch möglich sein, dass Sie den Kontext eines fünf Sätze langen Absatz erfassen können“:
Auch ich „finde es erstaunlich“, dass man bei nahezu jeder Diskussion dieselbe Oberhandtechnik verwendet wird, stets weg von sachlicher Argumentation und ad personam (ab)urteilend zum Schreiber hin.
Das ist absolut bemerkenswert, siehe dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsstile_nach_Schulz_von_Thun
(„der aggressiv entwertende Stil“).
In risposta a “Ich finde es erstaunlich, di Peter Gasser
Das selbe gilt auch für Sie
Das Selbe gilt auch für Sie Herr Gasser. Und wieder das alte Geplärre mit dem Sie nicht aufhören können, anstatt auf die Sachaspekte einzugehen. Aber Sie picken sich ja gerne einzelne Sätze heraus, um Sie dann falsch zu verstehen. Das ist Ihre Oberhandtechnik.
Es ist auch lustig dass Sie öfters Schulz von Thun nennen, aber selbst einen der disfunktionalsten Kommunikationsstile besitzen.
In risposta a Das selbe gilt auch für Sie di gorgias
Nein, in Ihrem Topf sitze ich
Nein, in Ihrem Topf sitze ich nicht.
Ich habe nichts „falsch verstanden“, ich verstehe Sie eher zu gut.
„der aggressiv entwertende Stil“ zeigt siche erneut im: „... wieder das alte Geplärre“.
Aber das schaffen wir *gemeinsam* schon noch, da bin ich zuversichtlich, Sie sind ja ein aufgeschlossener Mensch, nur Mut.
Ihr Beitrag vom 02.07.2020, 09:10 Uhr, ist ja sachlich, wenn man den dritten und letzten Absatz entfernt: das schaffen wir (Sie) in Zukunft locker -> darauf zu verzichten.
Und nun zurück zum Thema.
Ich kenne niemanden, der es sich bei uns „nicht leisten kann, krank zu werden“. Zudem liegt „Krank-Werden“ nicht im Willensakt des Menschen, sondern „geschieht“. Sonst wäre ja nie jemand krank. Und dafür haben wir ein funktionierendes Gesundheitssystem und Arbeitnehmer-Rechte -> sofern diese nicht von der Politik ausgehebelt werden.
In risposta a Nein, in Ihrem Topf sitze ich di Peter Gasser
Zumindest haben Sie aus
Zumindest haben Sie aus gorgias 23.06.2020, 21:23 einen Satz herausgenommen und Ihn falsch interpretiert, da nicht das berücksichtigt wurde, was der gesammte Absatz aussagt. Dass das nicht sein muss, da es etweder absichtlich ohne fehlende Sorgfalt darstellt bleibe ich dabei.
Da dies aber einer der wenigen Diskussionsverläufe ist, in denen Sie wieder zur Sachebene zurück wollen werde ich natürlich darauf eingehen und hoffe dass dieser metakommunikative Exkurs abgeschlossen ist:
>Ich kenne niemanden, der es sich bei uns „nicht leisten kann, krank zu werden“. Zudem liegt „Krank-Werden“ nicht im Willensakt des Menschen, sondern „geschieht“. Sonst wäre ja nie jemand krank.<
„Es sich nicht leisten zu können krank werden zu können“ ist eine verbreitete Redensart. Ich hoffe Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich leicht verdutzt bin, dass Sie Ihnen diese nicht geläufig ist.
Zufälligerweise habe ich in einer Kurzrecherche sogar eines zum Thema passendes Anwendungsbeispiel gefunden: https://www.ksta.de/region/fleisch-skandal--im-schlachthof-gibt-es-kein…
>Und dafür haben wir ein funktionierendes Gesundheitssystem<
davon habe ich nicht gesprochen
>und Arbeitnehmer-Rechte<
Erstens haben nicht alle eine unbefristete Arbeitsverträge. Zweitens gibt es auch einen unterschiedlichen Arbeitsdruck und rechtliche Absicherung je nachdem ob jemand im privaten oder öffentlichen Sektor arbeitet.
Natürlich sind eines die Rechte auf dem Papier, aber dass jemand auch „gegangen werden kann“ oder dass Leistungsprämien nicht ausgezahlt werden, mit denen man fix rechnet ist eine Realität auch in Südtirol.
Ich möchte zwei Beispiele nennen in denen ich mir vorstellen kann, dass die sozioökonomische Situation zweimal überlegen lässt ob man bei Symptomlosigkeit daran interessiert ist herauszufinden ob man infiziert ist:
In gewissen Filalien von Supermarktketten gibt es eine hohe Fluktuation von Mitarbeitern, da diese relativ schlecht bezahlt werden. Man kann davon ausgehen, dass diese befristete Arbeitsverträge haben.
Dass die Paketzusteller jeden Tag sich hetzen und sich nicht einfach mehr Zeit lassen und einfach der Arbeitgeber sagen, das schaff ich nicht oder das müsste auch gemütlicher gehen, können Sie nicht noch jemand einstellen, wird es schon einen Grund geben.
> -> sofern diese nicht von der Politik ausgehebelt werden.<
hier realitivieren Sie ihr eigenes Argument
In risposta a Nicht nur auf das di gorgias
Dem kann man nur zustimmen.
Dem kann man nur zustimmen. Nicht jeder kann sich Corona Massnahmen wirtschaftlich leisten....das ist Fakt.
In risposta a Dem kann man nur zustimmen. di simon tinkhauser
Das klingt, als seinen
Das klingt, als seinen „Corona-Massnahmen“ etwas Eigenständiges, das man tun kann oder nicht tun kann.
Das Problem ist die Seuche, also Covid-19 - das kann man doch nicht ausblenden, Maßnahmen sind eine Folge davon, Prävention.
Dabei wird zudem augenscheinlich vergessen (aber vielleicht interpretiere ich dies falsch), dass es zu Seuchen und Pandemien eine verpflichtende Gesetzeslage gibt, welche die politischen Akteure schnell hinter Gitter bringt, im Falle von Unterlassung und nachfolgenden Seuchenausbrüchen - mit zudem noch viel größeren wirtschaftlichen Schäden.
Haben wir nicht und kritisieren wir nicht noch immer, dass China zu spät und zu lax mit Maßnahmen begonnen hat? Glauben Sie, den Menschen dort fallen die Maßnahmen leicht, oder leichter als uns?
Sehen Sie, was zur Zeit in den Südstaaten der USA und in Brasilien geschieht, 2 Orten, an denen man wenig von Maßnahmen hielt?
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1105052/umfrage/taeglich…
Wollen wir auch wieder dort hin?
In risposta a Das klingt, als seinen di Peter Gasser
Welche Optionen hat denn
Welche Optionen hat denn Brasilien, mit Millionen Taglöhnern, die jeden Tag von der Hand im Mund Leben...sollen die daheim bleiben und verhungern?????
Wer glaubt, im 21ten
Wer glaubt, im 21ten Jahrhundert könne man eine Seuche auf Dauer mit denselben Methoden bekämpfen wie im letzten Jahrhundert, ist m.Meinung n. unrealistisch.
In risposta a Wer glaubt, im 21ten di Elisabeth Garber
Wirklich? Was hat sich
Wirklich? Was hat sich denn wesentliches verändert? Informationskampagnen, Masken, Hygienevorschriften, Kontaktvermeidung, Contact Tracing und Impfungen hat es schon vorher gegeben.
Hongkonk?
Hongkonk?
In risposta a Hongkonk? di Klaus Delueg
NY?
NY?