In die Sonne schauen

-
Die Prämisse von In die Sonne schauen wirkt auf den ersten Blick interessant, wenngleich nicht automatisch originell. Als Schauplatz dient ein Vierseithof in Sachsen-Anhalt. Dargestellt werden gleich vier Epochen, in denen jeweils eine Frau im Mittelpunkt steht. Alle vier sind irgendwie miteinander verbunden, spüren die Präsenz der anderen über die Zeit hinweg und teilen die Last des Frau-seins. Da wäre etwa das kleine Mädchen Alma, das kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs früh mit der Sterblichkeit konfrontiert wird, bald glaubt, selbst sterben müssen. Oder Erika, die während des Zweiten Weltkriegs erotische Anziehung zu ihrem Onkel Fritz verspürt – Almas Bruder. Angelika in den 1980ern lebt in einem geteilten Deutschland, ihre Mutter ist Erikas Schwester, und Angelika selbst irrt durch die Wirrungen erwachter Sexualität, was zur Ausbeutung ihres Körpers führt. In der Gegenwart wird der Hof schließlich von einer Berliner Familie bevölkert, deren kleine Tochter Nelly die schwere Vergangenheit des Ortes spürt und dieses Vergangene bis in ihre Träume vordringt. All das von den Frauen Erlebte wird weitergegeben, geteilt, spiegelt sich, wiederholt sich, bis zum Äußerten.
Dabei ist alles aus einem Guss: Die Regie, die Bilder, das Schauspiel, das Szenenbild, die Kostüme, die reduzierte Musik.
-
Ein ungewöhnliches Drehbuch wäre unter einer gewöhnlichen Regie trocken und wenig kunstvoll heruntergefilmt worden. Mascha Schilinski findet jedoch einen Weg, um das spannende Gedankenexperiment in eine experimentelle Form zu gießen. Die vier Epochen folgen nicht streng linear aufeinander, sondern werden assoziativ miteinander verwoben. Ein Bild fließt in das nächste, ein Gedanke nimmt hier seinen Anfang, und mündet dort. In einer mal erschütternden, mal ganz stillen Szene. Die Kamera verhält sich wie ein Geist, der stets an der Seite der Frauen weilt. In manchen Momenten gleicht das Bild einer verschwommenen Erinnerung, es sind jene Augenblicke, in denen sich Alma, Erika, Angelika und Nelly die Last der Vergangenheit und die Präsenz der jeweils anderen besonders bewusstwerden. Ihre Darstellerinnen Hanna Heckt, Lea Drinda, Lena Urzendowsky und Zoë Baier spielen das mit Zurückhaltung. Gleichzeitig verraten ihre Blicke, dass sie mehr wissen, als ausgesprochen wird. Das ist überhaupt eine große Stärke des Films: Das Drehbuch spricht wenig aus, deutet bloß an, und überlässt dem Publikum den Rest. Dabei ist alles aus einem Guss: Die Regie, die Bilder, das Schauspiel, das Szenenbild, die Kostüme, die reduzierte Musik. Besondere Erwähnung soll die Gestaltung der Tonebene finden, die oftmals wabernd, wummernd, desorientierend die Grenzen der Zeit aufbricht, und Blicke in andere Epochen erlaubt.
-
In die Sonne schauen verzichtet auf eine klassische Dramaturgie, das hat der Film auch gar nicht nötig. Er ist in erster Linie eine Erfahrung, die im Kino erlebt werden sollte. Zu Recht hat die Jury der Filmfestspiele in Cannes das Werk mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Im Einheitsbrei des deutschen Kinos der Moderne sticht der Film deutlich hervor und es ist überraschend, dass solch ein Werk durch die Finger der deutschen Filmförderung ging, und letztendlich das Licht der Leinwand erblickte. Es ist ein wichtiger und dringender Film, ein Porträt der Weiblichkeit, das zeigt, das sich trotz aller Progressivität in über 100 Jahren doch wenig getan hat.
-
Articoli correlati
Film | FilmeventAlle Jahre wieder in Venedig
Kultur | HimmelfahrtrezensionTom Cruise fällt vom Himmel
Film | RecensioneCuore batte soldi?



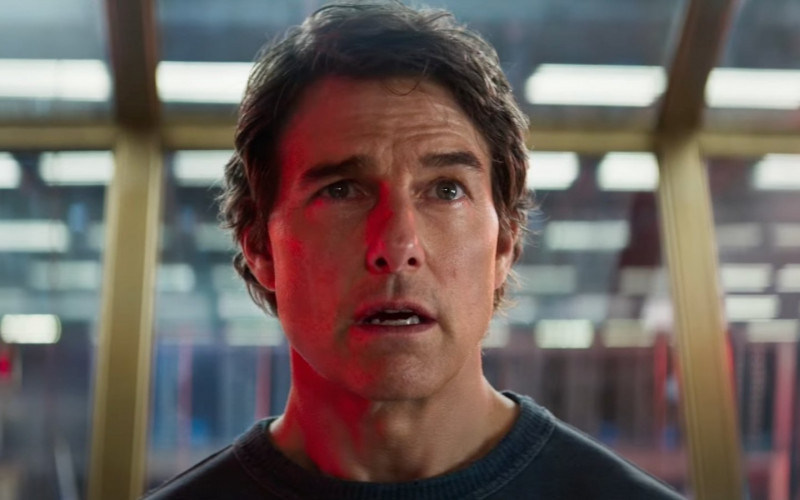

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.