Klima größtes Risiko für Artenvielfalt

-
„Den bislang umfassendsten Blick in die Vergangenheit und Zukunft der globalen Biodiversität wirft eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science: Intensive Landnutzung verringerte die biologische Vielfalt um bis zu rund 10 Prozent im Laufe des 20. Jahrhunderts“, teilt die Universität Innsbruck in einer Mitteilung an die Medien mit. Bis 2050 könnte die Klimakrise neben der Landnutzung zum Hauptfaktor für weitere Einbußen in der Biodiversität werden. Lauren Talluto vom Institut für Ökologie der Uni Innsbruck ist Teil des internationalen Autor*innen-Teams.
Die globale biologische Vielfalt hat im 20. Jahrhundert allein durch veränderte Landnutzung um zwei bis 11 Prozent abgenommen, so das Ergebnis der in Science veröffentlichten Studie. Die umfassenden Modellberechnungen des internationalen Forscher*innen-Teams zeigen zudem vor allem eines: Der Klimawandel könnte bis 2050 zum Hauptgrund für den Rückgang biologischer Vielfalt werden.
„Die Ergebnisse machen einmal mehr sehr deutlich, dass dringend ein global koordiniertes Handeln nötig ist, um die Folgen der Klimakrise einzudämmen."
„Bislang galt die Landnutzung durch die Inanspruchnahme von Böden und Landflächen durch den Menschen als Hauptursache. Erstmals konnte nun in dieser Studie eine globale Perspektive auf die komplexe Entwicklung der Biodiversität geworfen werden. Das ist ein großer Fortschritt für unser Forschungsgebiet und bringt die Auswirkungen der Klimakrise als zentralen Faktor für die Zukunft ins Spiel“, betont Lauren Talluto von der Forschungsgruppe Fließgewässer-Ökosystem-Ökologie am Institut für Ökologie der Uni Innsbruck.
-
Globale Trends
 Artenvielfalt: Die Natur versorgt mit ihrer Artenvielfalft Menschen mit sogenannten Ökosystemleistungen, etwa die Bereitstellung von fruchtbarem Boden. Foto: Margaret Polinder/Unsplash
Artenvielfalt: Die Natur versorgt mit ihrer Artenvielfalft Menschen mit sogenannten Ökosystemleistungen, etwa die Bereitstellung von fruchtbarem Boden. Foto: Margaret Polinder/UnsplashDie Arbeit, geleitet vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), sei die bisher umfangreichste Modellierungsstudie ihrer Art. Das Forscher*innen-Team hat 13 Modelle verglichen, die die Auswirkungen von Landnutzungs- und Klimawandel auf vier verschiedene Messgrößen der Biodiversität sowie auf neun verschiedene Ökosystemleistungen berechnen.
Laut Weltbiodiversitätsrat IPBES ist der Landnutzungswandel, zum Beispiel die Umwandlung von Wald in Weide, der wichtigste Faktor für die Veränderung der biologischen Vielfalt. Zu messen, wie sehr sich die biologische Vielfalt verändert hat, stellt die Wissenschaft aber immer noch vor große Herausforderungen. Das Forscher*innen-Team modellierte daher die Auswirkungen des Landnutzungswandels auf die biologische Vielfalt im 20. Jahrhundert. „Indem wir alle Erdregionen in unser Modell einbezogen haben, konnten wir viele blinde Flecken füllen. Wir konnten auch die Kritik an anderen Berechnungsansätzen angehen, die fragmentierte und möglicherweise nicht repräsentative Daten nutzen“, sagt Erstautor Henrique Pereira, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und an der MLU.
Ausblick in die ZukunftMit fünf verschiedenen Modellen berechnete das Team ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Studie die Auswirkungen des Landnutzungswandels auf Ökosystemleistungen. Für das vergangene 20. Jahrhundert stellten die Forscher*innen fest, dass versorgende Leistungen, wie Nahrungsmittel- und Holzproduktion, sich vervielfacht haben, während regulierende Leistungen – etwa Bestäubung durch Insekten oder die Bindung klimarelevanten Kohlenstoffs – leicht zurückgegangen sind.
Teil der Studie war aber auch ein Blick in die Zukunft bis 2050 und dafür fügten die Autor*innen den Klimawandel als weiteren Faktor in ihre Modelle ein. Diesen Berechnungen zufolge werden die Folgen der klimatischen Veränderungen sowohl die biologische Vielfalt als auch die Ökosystemleistungen zusätzlich beeinträchtigen.
Während der Landnutzungswandel weiterhin eine wichtige Rolle spielt, könnte der Klimawandel bis Mitte des 21. Jahrhunderts zum Hauptgrund für den Rückgang biologischer Vielfalt werden. Das Team bewertete drei aktuell gängige Klima-Szenarien, die von nachhaltiger Entwicklung bis zu sehr hohen Emissionen reichen und resümierte, dass Landnutzungs- und Klimawandel zusammen in allen Weltregionen zu einem Rückgang führen werden, auch wenn sich im Detail naturgemäß unterschiedliche Ausprägungen in den verschiedenen Weltregionen, Modellen und Szenarien zeigen.
„Die Ergebnisse machen einmal mehr sehr deutlich, dass dringend ein global koordiniertes Handeln nötig ist, um die Folgen der Klimakrise einzudämmen, und der Erhalt der Biodiversität allein im Hinblick auf die überlebenswichtigen Ökosystemleistungen von höchster Priorität sein sollte", betont Lauren Talluto.
Articoli correlati
Umwelt | Erderwärmung5,3 Prozent CO2 weniger
Umwelt | Interview„Mehrheit steht hinter dem Klimaland“
Wirtschaft | WintertourismusEin Spiel mit der Zeit


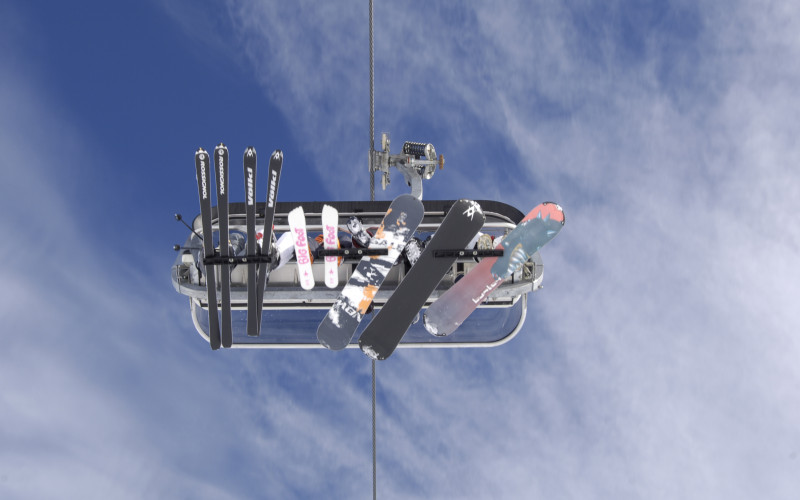
Was die intensive…
Was die intensive Landnutzung anbelangt sehe ich auch ziemlich schwarz für unser Südtirol. Vor allem seit unlängst der ex-Brixner Bürgermeister bzw. der „Betonierer“ Peter Brunner zum Urbanistik Landesrat ernannt wurde. Da hat man ausgerechnet den „Bock zum Gärtner“ gemacht!
Bei seinen zahlreichen Medienauftritten in letzter Zeit war jedenfalls sehr viel „bla bla bla“ zu hören! Mal sehen was Brunner dann auch wirklich umsetzt!
Da nützt auch nichts der sehr oft zitierte Landes-Klimaplan, welcher sowieso nicht bindend ist, bzw. keine rechtliche Grundlage darstellt.
Und mit den Klimawandel leugnenden Rechten in der Landesregierung ist sowieso alles zu spät!
Die BIO-Diversität hat mit…
Die BIO-Diversität hat mit der Landwirtschaftlichen Nutzung der ländlichen Raumes deutlich zugenommen. Sie wurde aber mit der Einführung der Mechanisierung wieder etwas eingeschränkt.
Ohne landwirtschaftliche Nutzung, würde sich der Wald wieder recht schnell ausbreiten.
In der Nähe von Wäldern kann man die sehr zarten + empfindlichen jungen Bäumchen beobachten, die aus mit dem Wind eingeflogenen Samen entstehen.
Wer wissen will, was…
Wer wissen will, was wirklich auf uns zukommt, der mag sich die trockenen Analysen der Versicherungen und Investmentfonds reinziehen (mitsamt errechneter Kosten). Wer dann noch nicht den Klimawandel als Fakt anerkennt, der ist nicht ernstzunehmen.
Wenn weite Bereiche der Erde…
Wenn weite Bereiche der Erde landwirtschaftlich nicht mehr benutzbar + deshalb auch kaum mehr bewohnbar werden, wird den Versicherungen + Investment-Fonds auch das klein-Gedruckte nicht mehr helfen.