Rohstoffe in einer Krisen-und Kriegszeit

-
Seit dem Beginn der Industrialisierung sicherte der Bergbau die Versorgung der Industrie mit Bodenschätzen. Die enge Verflechtung zwischen der industriellen Produktion und dem Bergbau bedingte dabei, dass sich im 20. Jahrhundert Krisen und Kriege auch auf den Bergbau auswirkten. Doch wie verlief die Entwicklung im Detail und inwieweit war Südtirol davon betroffen?
Südtirol zählte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch zu den Bergbauregionen im Alpenraum. Zwar waren die Phasen der Hochkonjunktur des Silber- und Kupferbergbaus seit langer Zeit Geschichte, dennoch waren im ganzen Land noch einige Bergwerke in Betrieb. Um 1900 betrieb der österreichische Staat die Bergwerke am Schneeberg und am Pfundererberg in Villanders und führte in den mittelalterlichen Abbaugebieten bei Gossensaß und im Pflerschtal Erkundungsarbeiten an den Lagerstätten durch. Die privat geführten Bergwerke in Rabenstein im Sarntal und in Prettau waren einige Jahre vorher stillgelegt worden.
Hochkonjunktur hatten seit den 1880er Jahren auch die Marmorbrüche bei Laas im Vinschgau und die Porphyrbrüche in der Gegend von Bozen und im Unterland. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg setzten an vielen Stellen neue Schürfungen und Probebohrungen ein: 1906 nahm man das Bergwerk von Terlan wieder in Betrieb, 1907 begann man mit dem Stollenvortrieb im Eggertal bei Mauls und ab 1908 wurde in Rabenstein wieder abgebaut. Im selben Jahr wurde das Bergwerk in Villanders vorübergehend stillgelegt und die Arbeiter an den Schneeberg versetzt, um dort den Abbau zu forcieren. Während bzw. kurz nach dem Ersten Weltkrieg versuchte man im Ulten- und Martelltal neue Bergwerke zu eröffnen.
-
Weltwirtschaftskrise
Hochkonjunktur hatten seit den 1880er Jahren auch die Marmorbrüche bei Laas im Vinschgau und die Porphyrbrüche in der Gegend von Bozen und im Unterland. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg setzten an vielen Stellen neue Schürfungen und Probebohrungen ein: 1906 nahm man das Bergwerk von Terlan wieder in Betrieb, 1907 begann man mit dem Stollenvortrieb im Eggertal bei Mauls und ab 1908 wurde in Rabenstein wieder abgebaut. Im selben Jahr wurde das Bergwerk in Villanders vorübergehend stillgelegt und die Arbeiter an den Schneeberg versetzt, um dort den Abbau zu forcieren. Während bzw. kurz nach dem Ersten Weltkrieg versuchte man im Ulten- und Martelltal neue Bergwerke zu eröffnen.
-
Wirtschaftssanktionen
Bis 1936 hatte sich Italiens Wirtschaft noch nicht wieder erholt und lag noch immer deutlich unter dem Niveau von 1929, da begann für den Montansektor eine neue Entwicklung. Anfang Oktober 1935 hatte das faschistische Regime das Kaiserreich Abessinien, das heutige Äthiopien, in Ostafrika völkerrechtswidrig überfallen. Bis zum Mai 1936 wurden weite Teile des Landes erobert und das Gebiet dem italienischen Kolonialreich eingegliedert.
Im November 1935 wurden wegen des Krieges Wirtschaftssanktionen gegen Italien erlassen, die die Fortführung des Krieges zwar nicht behinderten, die Versorgung der italienischen Industrie mit Rohstoffen aber dennoch erschwerten. Die italienische Reaktion darauf bestand in Bemühungen um Versorgungssicherheit der Industrie mit Rohstoffen aus Bergwerken, die auf dem Staatsgebiet oder in den Kolonien liegen sollten. Die unmittelbarste Folge dieser Autarkiebestrebungen war die Gründung der Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.). Dieses Staatsunternehmen war als nationale Bergbauholding gedacht, die in Krise geratene Bergwerke unterstützen und notfalls übernehmen sowie neue Lagerstätten im Mutterland und den Kolonien erschließen sollte. Gerade die Besetzung Albaniens im April 1939 mit seinen reichen, aber bisher kaum erschlossenen Erzlagerstätten, bot hier ein reiches Betätigungsfeld.
-
Kriegswirtschaft
In Südtirol wurde das Bergwerk am Schneeberg 1940 durch die A.M.M.I. übernommen und wiedereröffnet. Eine Reihe von Investitionen führten innerhalb von zwei Jahren dazu, dass das Bergwerk wieder Erze fördern und in der Aufbereitungsanlage in Maiern im Ridnauntal zu Erzkonzentraten verarbeiten konnte. 1941 nahm man auch die Erkundungsarbeiten im benachbarten Pflerschtal wieder auf, wo man sich ergiebige Zink- und Bleivorkommen erhoffte.
Während des Krieges wuchs der Bedarf der Kriegsindustrie nach Rohstoffen aller Art beständig und so verwundert es nicht, dass der Staat dem Funktionieren der Bergwerke hohe Priorität einräumte. Auch private Gesellschaften profitierten davon. Seit 1937 beitrieb das Unternehmen Società Anonima Gestione Miniere Atesine (S.A.G.M.A.) mit Sitz in Mailand das Antimon-Bergwerk am Tanzbach nahe der Grenze zwischen den Gemeinden Ritten und Sarntal. Das alte Bergwerk bei Altenburg wurde durch dieselbe Firma in den 1940er Jahren auf verwertbare Fluoritvorkommen untersucht und auch in Kampenn bei Bozen wurde in diesen Jahren Fluorit durch die S.A.G.M.A. abgebaut.
-
Deutsche Besetzung
Die Absetzung des faschistischen Diktators Benito Mussolini am 25. Juli 1943 hatte die Besetzung Italiens durch die deutsche Wehrmacht zur Folge. Da Deutschland kriegsbedingt ebenfalls Mangel an Rohstoffen litt, kam es zum Zugriff auch auf die Bergwerke in Italien, nicht zuletzt in Südtirol. Das von der A.M.M.I. geführte Bergwerk am Schneeberg wurde unter die Verwaltung der deutschen Sachsenerz AG mit Sitz im sächsischen Freiberg gestellt und die gewonnenen Erzkonzentrate ins Reichsgebiet zur Verarbeitung gebracht.
1944 wurde von deutscher Seite auch das Bergwerk in der Masulschlucht bei Schenna wieder angefahren, um Beryllium für die Produktion der V2-Raketen zu gewinnen. Bemerkenswert ist auch die Übernahme des alten Kupferbergwerks in Prettau durch die deutsche Verwaltung während des Krieges. Hier hoffte man durch die Zementkupferanlage das dringend benötigte Metall Kupfer für die deutsche Rüstungsindustrie gewinnen zu können. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition, bemühte sich selbst um die Inbetriebnahme des Prettauer Bergwerks, das nach seinen Vorstellungen ein Wehrmachtsbetrieb hätte werden sollen. Der Mangel an Eisen für den Zementierungsvorgang verhinderte hier allerdings eine Produktion des begehrten Kupfers.
Die Entwicklungen des Bergbaus in Südtirol unmittelbar vor und während des Zweiten Weltkriegs sind insgesamt noch wenig erforscht. Trotzdem zeigt sich, dass die vielfältigen Bemühungen um die Gewinnung wichtiger Bodenschätze gerade in diesen Krisen- und Kriegszeiten auch in unserem Land vorhanden waren.
Armin Torggler, Landesmuseum Bergbau
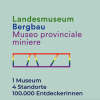

Wäre spannend, auch das…
Wäre spannend, auch das Thema "Zwangsarbeit" in diesem Zusammenhang zu ergänzen. Danke.