KI soll’s richten

-
Wer hat sich nicht schon im Behördendschungel und mit nutzerunfreundlichen Webseiten herumschlagen müssen – unabhängig davon, um welche Behörde es sich handelt? Man sucht eine Information und landet auf einer völlig falschen Seite. Damit soll nun Schluss sein: Wie bei der gestrigen (15. Mai) Pressekonferenz angekündigt, wurde in der öffentlichen Verwaltung ein umfassender Digitalisierungsprozess gestartet. Eines der ersten Ämter, das davon profitiert, ist die Wohnbauförderung. „Wir sind in einigen Bereichen noch relativ rückständig“, räumt Ressortdirektor Luca Critelli, zuständig für die Abteilung für Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention, offen ein. Besonders bei der Antragstellung im Bereich Wohnbau laufe vieles noch analog – komplexe Papierformulare, lange Bearbeitungszeiten und fehleranfällige manuelle Dateneingaben prägten bisher den Alltag. Das soll sich mit der Digitalisierungsoffensive nun ändern.
-
Vom Papier zum digitalen Gesuch
Kernstück der neuen Strategie ist die vollständige Digitalisierung der Antragstellung über das Authentifizierungssystem SPID. Künftig sollen Anträge nicht nur online eingereicht, sondern auch direkt auf Vollständigkeit überprüft werden. „Das System akzeptiert ein Gesuch erst, wenn alle erforderlichen Daten korrekt eingegeben wurden“, erklärt Critelli. Das bedeutet: keine monatelangen Verzögerungen mehr wegen fehlender Dokumente oder Angaben. Auch die Transparenz wird erhöht. Antragstellerinnen und Antragsteller sollen künftig den Status ihres Gesuchs online einsehen können – ein echter Fortschritt, wie Critelli betont: „Heute rufen viele Leute regelmäßig an, um zu fragen, wie weit ihr Antrag ist. Das kostet Zeit auf beiden Seiten. Mit dem neuen System entfällt das.“
„Heute rufen viele Leute regelmäßig an, um zu fragen, wie weit ihr Antrag ist. Das kostet Zeit auf beiden Seiten. Mit dem neuen System entfällt das.“
Neben der Antragstellung soll auch die Beratung digital neu aufgestellt werden. Derzeit werden viele persönliche Gespräche geführt, bei denen es oft um einfache Fragen geht, die längst durch vorhandene Online-Materialien beantwortet wären. „Doch viele Leute lesen ungern umfangreiche Dokumentationen“, sagt Critelli. Die Lösung: ein zweistufiges Beratungssystem, bei dem Künstliche Intelligenz (KI) als erste Anlaufstelle dient. Nutzerinnen und Nutzer können ihr Anliegen in eigenen Worten schildern, woraufhin das System relevante Informationen liefert oder weiterführende Fragen stellt. Erst wenn das Anliegen auf diesem Weg nicht geklärt werden kann, erfolgt ein persönliches Gespräch. Der Ressortdirektor geht davon aus, dass durch diese Maßnahme 50 bis 75 Prozent der Anfragen bereits im ersten Schritt gelöst werden können.
-
Der Mensch wird nicht ersetzt
Die Befürchtung, dass durch die Digitalisierung Arbeitsplätze verloren gehen könnten, hält Critelli für unbegründet. Vielmehr gehe es darum, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert bieten – etwa in der vertieften Beratung oder bei komplexen Einzelfällen. „Daten von Papierformularen in eine Datenbank zu übertragen, ist im Jahr 2025 keine erfüllende Aufgabe mehr“, stellt Critelli fest. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachkräftemangels sieht er in der Digitalisierung auch eine Chance: „Wenn wir es schaffen, einfache Prozesse zu automatisieren, können wir unsere knappen personellen Ressourcen dort einsetzen, wo sie wirklich gebraucht werden.“
-
Externe Expertise als Schlüssel zum Erfolg
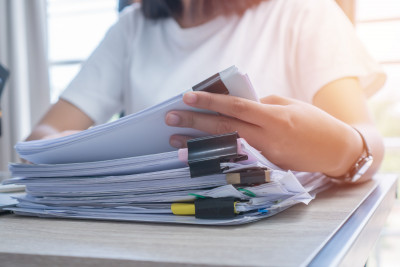 Gesuche in Papierform: Zuerst auf Papier, dann in das System eintippen – im 21. Jh. nicht mehr zeitgemäß. Foto: Handelskammer Bozen
Gesuche in Papierform: Zuerst auf Papier, dann in das System eintippen – im 21. Jh. nicht mehr zeitgemäß. Foto: Handelskammer BozenEin wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsstrategie ist die Zusammenarbeit mit externen Beratungs- und Softwarefirmen. Im Wohnbausektor etwa unterstützt eine international tätige Beratungsgesellschaft die Landesverwaltung. „Die Erfahrung war bislang sehr positiv“, sagt Critelli. Die externen Fachleute brächten nicht nur technisches Know-how mit, sondern stellten auch die richtigen Fragen, um Prozesse effizient zu gestalten. Die Koordination erfolgt über die zentrale Informatikgesellschaft des Landes, die digitale Lösungen für alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung entwickelt. Das führe laut Critelli jedoch auch zu Engpässen: „Wenn alle Ressorts gleichzeitig digitalisieren wollen, kommt es zwangsläufig zu Flaschenhälsen. Die Kapazitäten sind begrenzt, und man muss Prioritäten setzen.“ Im Bereich Wohnbau habe sich das Zusammenspiel mit laufenden Gesetzesreformen jedoch als Vorteil erwiesen: „Wir können die digitale Umsetzung direkt mit den neuen Verfahrensregeln abstimmen.“
Digitalisierungsschub durch CoronaDie Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Digitalisierung auch kurzfristig funktionieren kann: Innerhalb weniger Monate wurden Plattformen zur Beantragung und Auszahlung von Covid-Hilfen aufgesetzt – inklusive SPID-Zugang und digitaler Verwaltung. Der Unterschied zum Wohnbau? Die Verfahren waren einfacher, die Zielgruppen klarer. Doch die Erfahrung zeigt: Es geht. „Besonders bei der Wohnbauförderung haben wir es mit vielen Varianten und Faktoren zu tun“, erklärt Ressortdirektor Critelli. „Aber die Logik bleibt dieselbe: ein strukturiertes, digitales Verfahren, das auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Benutzerfreundlichkeit setzt.“
„Es ist ein großer Schritt – vielleicht sogar ein Quantensprung.“
Mit dem Fokus auf junge Familien – der Hauptzielgruppe im Wohnbau – sei auch die Akzeptanz für digitale Verfahren hoch. Immer mehr Menschen seien mit SPID, digitalen Formularen und Uploads vertraut. Zusätzlich kommen KI-gestützte Programme zum Einsatz, die bereits beim Hochladen von Dokumenten deren Qualität und Vollständigkeit prüfen – ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Prozesssicherheit. Die Digitalisierung der Südtiroler Wohnbauverwaltung sei dabei kein Selbstzweck, sondern eine notwendige Antwort auf steigende Anforderungen, den Fachkräftemangel und das Bedürfnis der Bevölkerung nach effizienten, transparenten Verfahren. „Es ist ein großer Schritt – vielleicht sogar ein Quantensprung“, sagt Luca Critelli. Doch der Weg sei noch nicht zu Ende: „Es geht voran. Schritt für Schritt.“
Weitere Artikel zum Thema
Politics | VerwaltungVertrauen, Vereinfachen, Weglassen
Chronicle | TechnologieKünstliche Intelligenz und Arbeit


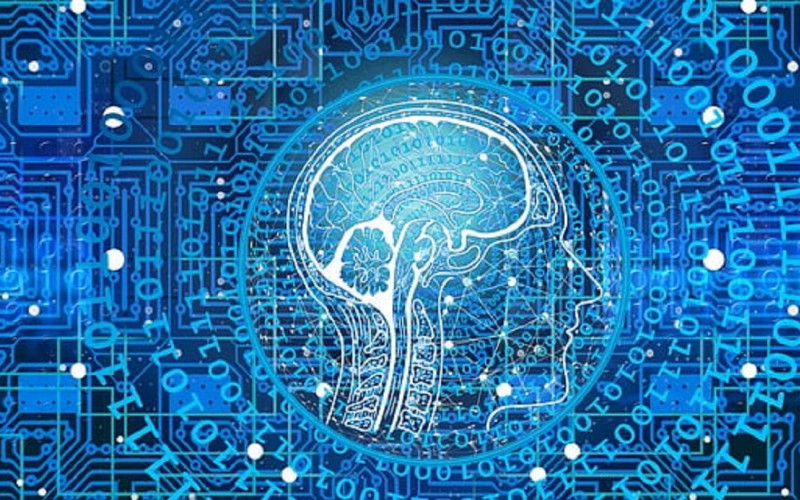
Frage an ChatGPT: Ist die…
Frage an ChatGPT: Ist die Technologie der KI überhaupt nachhaltig?
Antwort: Das ist eine interessante Frage! Die Nachhaltigkeit der KI-Technologie hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits kann die Entwicklung und der Einsatz von KI dazu beitragen, Ressourcen effizienter zu nutzen, beispielsweise durch Optimierung von Energieverbrauch oder Verbesserung von Produktionsprozessen. Andererseits erfordert die Entwicklung, das Training und der Betrieb von KI-Systemen oft erhebliche Mengen an Energie und Rechenleistung, was ökologische Auswirkungen haben kann.
Es gibt Bestrebungen, KI nachhaltiger zu gestalten, etwa durch den Einsatz umweltfreundlicherer Rechenzentren oder effizienterer Algorithmen. Insgesamt ist die Nachhaltigkeit der KI also ein komplexes Thema, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Es ist wichtig, bei der Weiterentwicklung dieser Technologie auf umweltverträgliche Lösungen zu achten.