Wem steht das Selbstbestimmungsrecht zu?

-
Chagos-Island – eine Inselgruppe im indischen Ozean – hat auf den ersten Blick nichts mit Südtirol zu tun. Wenige in Südtirol werden diese Inselgruppe überhaupt vom Namen her kennen. Doch was sich um den Selbstbestimmungsprozess dieser Inseln abgespielt hat, das wirft Fragen auf, die auch für Südtirol relevant sind. Peter Hilpold, Professor für Völker- und Europarecht an der Universität Innsbruck, beobachtet den Fall seit Jahren, wie er im Gespräch mit SALTO erklärt. Im Jahr 2022 hat er im „Nordic Journal of International Law“ einen eigenen Beitrag dazu veröffentlicht.
Im Zuge der geplanten Übergabe der Inseln an Mauritius am vergangenen Donnerstag (22. Mai) hat sich ein wahrer Krimi abgespielt, wie Professor Hilpold erzählt.
-
Die vergessenen Chagossians
Die Chagos-Inseln waren bis in die 1960er-Jahre Teil der britischen Kolonie Mauritius. Kurz vor deren Unabhängigkeit wurden sie abgetrennt, und zwar aus einem bestimmten Grund, bei welchem die Rechte der Bevölkerung dieser Inseln nicht die geringste Rolle spielten: Die Briten wollten die Inseln nämlich als Militärstützpunkt nutzen, erklärt Hilpold. „Die USA erhielten Zugang, und die Bevölkerung wurde kurzerhand ausgesiedelt. Diego Garcia, so der Name der Militärbasis, wurde zum wichtigsten Stützpunkt der US-Amerikaner im Pazifik.“ Viele der sogenannten Chagossians leben seither in Armut – auf Mauritius, in Großbritannien oder verstreut in der Diaspora. Ihre Geschichte blieb weitgehend unbekannt. Erst 2019 kam Bewegung in die Sache. Die UN-Generalversammlung hatte ein Gutachten beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag erwirkt. Die Entscheidung war eindeutig: Die Abspaltung der Inseln sei völkerrechtswidrig, Großbritannien habe gegen das Dekolonisierungsgebot verstoßen. „Doch das Gutachten hat wichtige Fragen unberücksichtigt gelassen“, erklärt der Völkerrechtler. „Es stellte zwar fest, dass die Inseln Mauritius zustehen, aber es ignorierte weitestgehend das Los der Bevölkerung der Inseln.“
-
Der Formalakt der Übergabe von Großbritannien an Mauritius durch den britischen Premier Sir Keir Starmer war für Donnerstagvormittag geplant, doch ein britischer Höchstrichter untersagte diese Maßnahme, und zwar auf Antrag von zwei Klägerinnen, die ursprünglich von den Chagos-Inseln stammten. Begründung: Die Rechte der Chagossians seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, die vertriebenen Bewohner seien nicht befragt worden. Obwohl diese Verfügung nach wenigen Stunden wieder aufgehoben wurde, ist für den Völkerrechtler damit einmal mehr die problematische Natur des Selbstbestimmungsrechts, in seinem traditionellen Verständnis, deutlich geworden. Laut Hilpold wird immer häufiger, in der Literatur, aber auch vor Gerichten, die zentrale Frage thematisiert: Wem steht das Selbstbestimmungsrecht eigentlich zu? Dem Staat – oder dem betroffenen Volk?
„Wem steht das Selbstbestimmungsrecht eigentlich zu? Dem Staat – oder dem betroffenen Volk?“
Zwar wurde diese Maßnahme vom britischen Höchstgericht wieder aufgehoben, doch diese ganze Diskussion hat laut Hilpold einmal mehr aufgezeigt, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker dringend einer Neuinterpretation bedarf, die den Menschen in den Vordergrund rückt und nicht Staatsinteressen.
-
Ein wegweisendes Beispiel?
Dass die Chagos-Frage weit über den Pazifik hinausreicht, wird beim Blick nach Südtirol deutlich. „Bislang wurde das Selbstbestimmungsrecht oft als rein staatsrechtliches Konzept verstanden“, so der Professor für Völkerrecht. „Man sprach zwar vom ‚Recht der Völker‘, meinte aber meist: Staaten streiten um Grenzen, um territoriale Ansprüche.“ Mit der aktuellen Diskussion könnte sich das ändern. Denn immer deutlicher drängt sich eine neue Auslegung des Selbstbestimmungsrechts in den Vordergrund: Die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker soll nicht der Mehrung staatlicher Macht dienen, sondern den Menschen, die auf dem betreffenden Territorium leben oder – im Falle einer Vertreibung wie auf den Chagos-Inseln – dort gelebt haben.
„Es geht nicht darum, dass Grenzen neu gezogen werden. Aber man kann das Thema jetzt mit einem anderen Blick diskutieren – menschenrechtsorientiert, weniger dogmatisch.“
In Südtirol ist die Selbstbestimmungsfrage regelmäßig Gegenstand politischer Debatten, selten jedoch frei von Emotionen. Für Hilpold bietet der Fall Chagos eine neue Grundlage, das Selbstbestimmungsrecht weltweit neu zu definieren: „Es geht nicht darum, dass Grenzen neu gezogen werden. Aber man kann das Thema jetzt mit einem anderen Blick diskutieren – menschenrechtsorientiert, weniger dogmatisch.“
-
Globale Fragen, konkrete Folgen
Auch international könnte dieser Perspektivenwechsel weitreichende Folgen haben. Indigene Völker in Australien, Kanada oder Lateinamerika könnten mit neuer Argumentation auf ihre Rechte pochen. Historische Ungerechtigkeiten würden nicht verschwinden – aber anders verhandelt werden. „Man wird in Zukunft nicht mehr nur nach den Interessen des Staates, sondern auch nach jenen des Volkes fragen müssen“, sagt Hilpold. Der Kern: Die Stimme der Betroffenen soll stärker gehört werden.
-
Und Südtirol?
Für Südtirol bedeute das nicht automatisch neue politische Optionen. „Aber“, so Hilpold, „die Diskussion wird offener, sie orientiert sich verstärkt an den Interessen der Menschen. Es ist nicht mehr abwegig, überhaupt über Selbstbestimmung zu sprechen.“ In einer Region, die historisch geprägt ist von Minderheitenschutz, Autonomie und politischer Sensibilität, ist das nicht wenig. Es gehe nicht um kurzfristige Forderungen, sondern um langfristige Denkansätze. Um das Verständnis von Rechten, Zugehörigkeit und Verantwortung. Und darum, ob das Selbstbestimmungsrecht – eines der zentralen Prinzipien des Völkerrechts – in Zukunft stärker in einen menschenrechtlichen Kontext gerückt wird. Der Fall Chagos liefert dazu einen neuen Impuls.
-
Die Klägerinnen
Die Klägerinnen wollen ihren Anspruch nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. Die vertriebenen Chagossians selbst sind untereinander zutiefst gespalten. Ein ins Leere gelaufener Selbstbestimmungsprozess hat Chaos und tiefe Wunden hinterlassen. Laut Hilpold zeigen die Vorfälle auf dem kleinen Archipel der Weltöffentlichkeit, dass Menschenrechtsanliegen bei der Anwendung aller Völkerrechtsprinzipien und auch bei der Anwendung des Selbstbestimmungsrechts der Völker zentrale Aufmerksamkeit erlangen müssen.

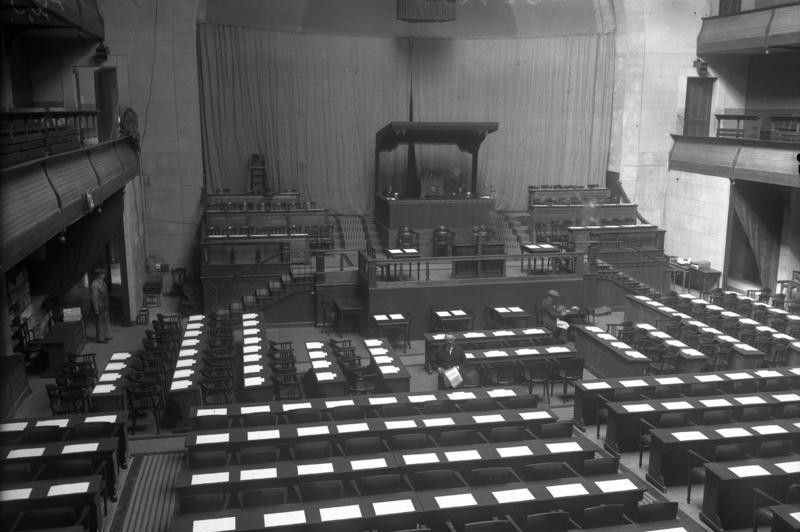
Im Artikel steht dreimal,…
Im Artikel steht dreimal, dass die Inselgruppe im Pazifik liegt. Die Chagos-Inseln sind aber, genauso wie Mauritius, im Indischen Ozean.
Antwort auf Im Artikel steht dreimal,… von Oskar Vallazza
Sehr geehrter Vallazza,…
Sehr geehrter Vallazza, vielen Dank fürs aufmerksame Durchlesen. Wird ausgebessert. Liebe Grüße
Ein interessanter Beitrag zu…
Ein interessanter Beitrag zu diesem Thema könnte der Artikel "Il problema del Sud-Tirolo" des italienischen Philosophen Mario Albertini aus dem Jahr 1961, online einsehbar unter thefederalist.eu sein.