Ein Geiger ist ein Musiker
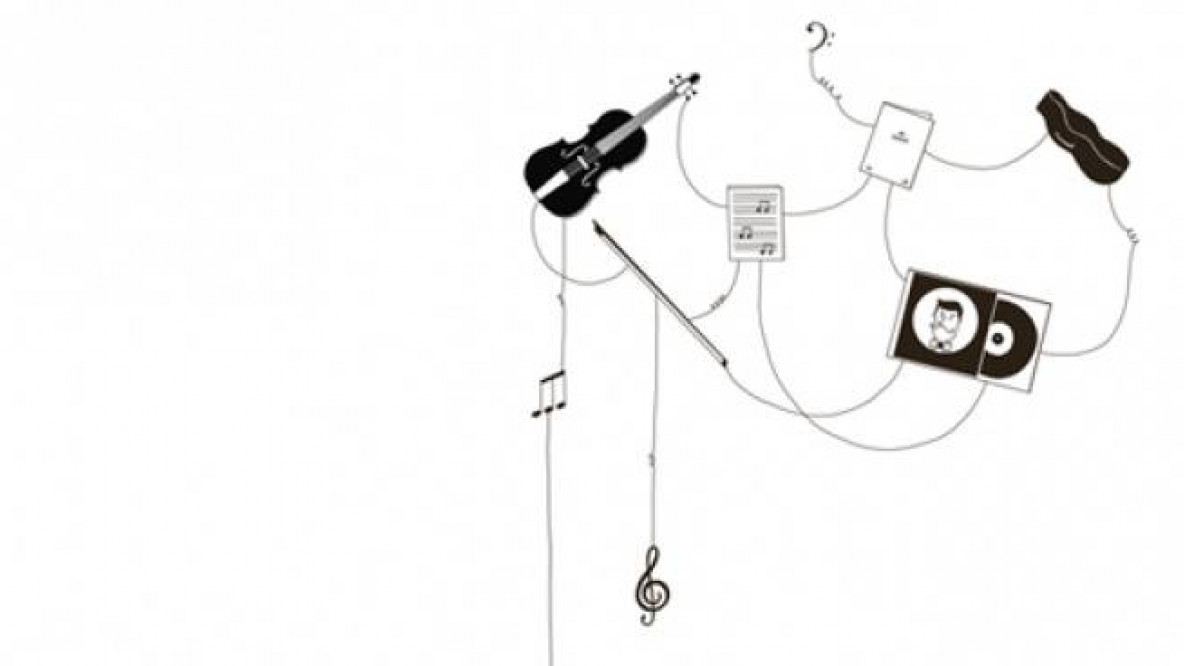
Kein Hirn kann so viel Wissen sammeln wie ein Computer. Und doch sind wir den Maschinen überlegen, weil wir in der Lage sind unser verhältnismäßig kleines Wissen in einem Kontext logisch zu vernetzen. An der unibz entwickelt ein Team von Forschern Computersprachen, um den Maschinen vernetztes Denken beizubringen.
von Vicky Rabensteiner
Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben wir verschiedene Formen entwickelt, um Wissen zu speichern, weiterzugeben und vor allem zu nutzen. Dies geschah jahrtausendelang in mündlicher Form, später in bildlicher, etwas der Höhlenmalerei, schließlich niedergeschrieben in Enzyklopädien und in den letzten 20 Jahren eingespeist in Datenbanken oder in grafischen Darstellungen. Die Wiedergabe dieses verwahrten Wissens ist oft schwer verständlich, oder noch schlimmer, führt zu falschen Interpretationen, vor allem, wenn es um das online Wissen geht. „Zur Erläuterung dieser Schwierigkeit führe ich gerne das Beispiel von Niccolò Paganini an“, erzählt Forscher Rafael Penaloza. „Wenn Sie seinen Namen in Wikipedia suchen, finden Sie den Hinweis, dass Paganini ein berühmter Geigenvirtuose und Komponist war. Das menschliche Hirn kombiniert automatisch ‚aha, ein Musiker‘. Computer haben diese implizite Art zu denken jedoch nicht, da sie Information nicht automatisch im Kontext verarbeiten. Ein Geiger ist für den Computer noch kein Musiker.“
Rafael Penaloza war in den vergangenen Jahren im Bereich der Beschreibungslogiken an der Universität in Dresden tätig, bevor er für das Forschungsgebiet der Wissensdarstellung in das Team der Professoren Enrico Franconi und Diego Calvanese an die Fakultät für Informatik nach Bozen gewechselt ist. Penaloza untersucht nun seit April an der unibz verschiedene Computersprachen, die für Wissensdarlegung verwendet werden können. Dabei ist das Ziel nicht nur, unser Wissen in geeigneter Weise transkribieren zu können, sondern auch automatisch neues Wissen, das daraus folgt, zu erarbeiten. „Man darf sich diese einheitliche Computersprache aber nicht als eine Sprache im Muster von Spanisch, Deutsch oder Englisch vorstellen“, erläutert der 34-jährige Mexikaner. Vielmehr gehe es um eine konzeptuelle Darstellung. Ein Beispiel: Ein Arzt im Krankenhaus schreibt bei der Beschreibung des Gesundheitszustandes nicht „heart-cuore oder Herz“ in die Krankendatei. Er verwendet vielmehr eine dem Computer verständliche und sprachunabhängige Darstellung, welche die relevanten Eigenschaften des zugrundeliegenden Konzepts erfasst. Es ist dies keine „natürliche“, sondern eine „formale“ Sprache. In unserem Fall wäre es das Konzept des Muskels, der aus vier Kammern besteht und Blut in den Körper pumpt. Für Penaloza ein gutes Beispiel, da die Anatomie eine genaue Interpretation der relevanten Eigenschaften erfordert. Oder, um auf Paganini zurückzukommen, ist die Tatsache, dass jeder Geiger auch ein Musiker ist, eine der wichtigen Eigenschaften, die zur Darstellung des Konzepts eines Musikers beitragen. Der Computer muss aber erst mit dieser Information gefüttert werden, um die richtige Verbindung herzustellen.

Der Forscher Rafael Penaloza
Das ursprüngliche Ziel der Forschungsarbeit von Rafael Penaloza war es, eine einzige, formale Computersprache zu entwickeln, die künftig alles menschliche Wissen speichern könnte. Dabei hätte ein Computer alle logischen Folgerungen aus dem Wissen sammeln sollen. Doch bald stellte sich heraus, dass eine solche Sprache zu umständlich sein würde. Sie würde nicht nur Tatsachen ausdrücken können, die wir Menschen nicht mehr erfassen könnten, sondern auch Paradoxe („dieser Satz ist eine Lüge“). Zudem gäbe es keine Garantie, dass eine Maschine jemals sinnvolle Schlüsse und Ableitungen aus dem erfassten Wissen ziehen könnte. Man denke nur an die jahrhundertealte Diskussion der Philosophen über das Leben selbst „Cogito ergo sum – ich denke also bin ich“.
„Emotionale Intelligenz von Seiten des Computers kann man sich nicht erwarten.“
Diego Calvanese
In diesem Zusammenhang bringt Penaloza das Konzept des deutschen Mathematikers Georg Ferdinand Cantor ins Spiel, der den Begriff der Unendlichkeit in der modernen Mathematik revolutionsartig veränderte und in einer philosophisch-mathematischen Herangehensweise von mehreren Unendlichkeiten sprach: „Dies ist bereits für uns Menschen schwer begreifbar, für einen Computer aber derzeit kaum darstellbar.“
In vielen spezifischen Bereichen ist eine solch neue ausdrucksstarke Computersprache nicht notwendig. Wenn man zum Beispiel biologische Wesen beschreibt, genügt es zumeist, einige Beziehungen zwischen diesen zu erfassen. Beispielsweise: Ein Hund ist ein Tier. So sind zum Beispiel Gattungen selten in einer Negativform beschrieben („es ist kein Säugetier“) oder in Beschreibungen die Alternativen zulassen („sie haben rote oder blaue Streifen“). Daher hat sich das Ziel der Wissensdarstellung verschoben. Es wird nun vielmehr an der Entwicklung restriktiver kleiner Computersprachen gearbeitet, die Garantien für die Effizienz der Methoden liefern, die logische Schlussfolgerungen ermöglichen. Diese Sprachen sind sowohl sehr einfach, da sie komplexer Strukturen entbehren, als auch ausdrucksstark, da sie das Arbeiten mit einer schnellen und schlüssigen Argumentationskette ermöglichen.
Praktisch werden viele Wissensdatenbanken mit diesen kleinen Sprachen gebaut; in vielen Fällen decken sie weite Wissensgebiete ab. Ziel des Forschungsteams ist es, die verschiedenen Zugangsweisen zu eruieren, um beim Erfassen eines bestimmten Wissensbereiches die jeweils bestens geeignete Computersprache zu verwenden. „Wir möchten also durch weniger Ausdrucksstärke mehr Wissen darstellen, und in effizienterer Weise möglichst viele neue Schlussfolgerungen ziehen“, resümiert Raffael Penaloza. „Unser Dreijahresprojekt wird zeigen, wie weit diese “less is more„-Strategie in der Wissensdarstellung klappt. Es geht darum, künftig im Netz mit weniger spezifischen Fragen an die Suchmaschinen noch präzisere Antworten zu erhalten. Also wenn ich den Computer nach Musikern des 19. Jahrhunderts befrage, wird er mir künftig – unter vielen anderen – Niccolò Paganini nennen. Derzeit ist dies unmöglich.“
Academia #71 – Weniger ist mehr | Meno è meglio | Less is more


Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.