Wenn die Zahlen sprechen

-
„Wir haben festgestellt, dass die Zahl der Personen mit mehreren Muttersprachen deutlich gestiegen ist. Mittlerweile geben fast 10 Prozent an, mehr als eine Muttersprache zu haben – ein Wert, der klar über jenem der vorherigen Ausgaben des Sprachbarometers liegt“, erklärt ASTAT-Direktor Timon Gärtner gegenüber SALTO. Um 10 Uhr am Vormittag wurde das Südtiroler Sprachbarometer 2025 vorgestellt. Es ist die dritte Ausgabe dieser Erhebung und widmet sich dem Sprachgebrauch, den Sprachkenntnissen sowie der sprachlichen Identität in Südtirol. Die letzte Erhebung liegt zehn Jahre zurück.
Nun muss man sehen, wie die Politik und die Sprach(en)wissenschaft die neuen Zahlen deutet und interpretiert...
-
Was steht im Sprachbarometer
Die Publikation bietet eine Fülle an Daten zu Mutter-, Zweit- und Fremdsprachen, zu den Sprachen der ausländischen Bevölkerung, zum Generationenwechsel sowie zu Sprache und Partnerschaft. Dabei werden auch Befunde zu den im Vorschulalter gesprochenen Sprachen und zur Unterrichtssprache an Schulen und Universitäten präsentiert. Ebenso wurden Meinungen zum schulischen Erwerb der Zweitsprache, zur Teilnahme an außerschulischen Sprachaktivitäten und zu Möglichkeiten der Verbesserung der Sprachkenntnisse erfasst.
-
 Viele Zahlen über Buchstaben: Die Publikation bietet eine Fülle an Daten zu Mutter-, Zweit- und Fremdsprachen, zu den Sprachen der ausländischen Bevölkerung, zum Generationenwechsel sowie zu Sprache und Partnerschaft. Foto: SALTO
Viele Zahlen über Buchstaben: Die Publikation bietet eine Fülle an Daten zu Mutter-, Zweit- und Fremdsprachen, zu den Sprachen der ausländischen Bevölkerung, zum Generationenwechsel sowie zu Sprache und Partnerschaft. Foto: SALTOInsgesamt wurden in neun Kapiteln zentrale Aspekte rund um das Thema Sprache beleuchtet: von den Muttersprachen und schulischen Erfahrungen über Sprachzertifikate und Kompetenzen bis hin zum alltäglichen Sprachgebrauch in unterschiedlichen Lebensbereichen, zur Wahrnehmung der eigenen Identität, zum Zusammenleben der Sprachgruppen und zur Lebensqualität in Südtirol.
Die Ergebnisse zeigen, dass die drei historischen Sprachgruppen zwar weiterhin stabil sind, sich der Blick aber zunehmend auf neue Entwicklungen richtet – insbesondere auf das Entstehen weiterer Sprachgemeinschaften und die tatsächliche Mehrsprachigkeit der Bevölkerung. Unter den „anderen“ Muttersprachen nimmt Albanisch mit rund zwei Prozent den höchsten Anteil ein. Auch Englisch ist mittlerweile sehr etabliert.
Insgesamt nimmt die subjektive Bedeutung des deutschen Dialekts ab: Hielten ihn 2014 noch 64 Prozent für wichtig, sind es 2025 nur noch 51 Prozent.
Aus der knapp 150 Seiten umfassenden, zweisprachig veröffentlichten Studie mit zahlreichen Tabellen und Grafiken wird deutlich, dass Deutsch, Italienisch und Ladinisch nach wie vor die tragenden Säulen der Südtiroler Gesellschaft bilden. Gleichzeitig nimmt durch Migration und mehrsprachige Familien die Präsenz weiterer Sprachen zu. Zwar wird die Muttersprache in vielen Fällen weiterhin von Generation zu Generation weitergegeben, doch zeigen sich bereits im Vorschulalter erste sprachliche Vermischungen. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Bildungssystem wider: Vor allem jüngere, italienischsprachige Generationen schlagen zunehmend eine schulische Laufbahn auf Deutsch ein.
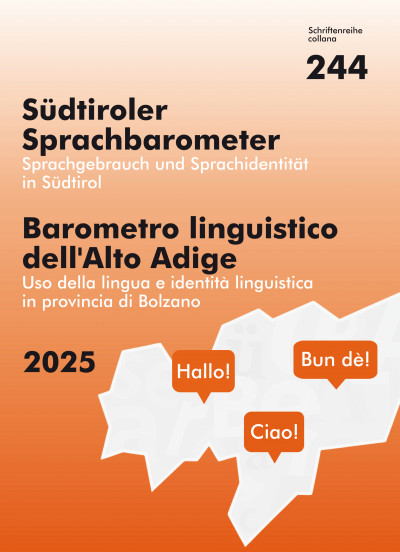 Südtiroler Sprachbarometer: 81 Prozent der Bevölkerung beurteilen das Zusammenleben der Sprachgruppen als zufriedenstellend. Foto: ASTAT
Südtiroler Sprachbarometer: 81 Prozent der Bevölkerung beurteilen das Zusammenleben der Sprachgruppen als zufriedenstellend. Foto: ASTATEin weiterer Schwerpunkt liegt auf dem alltäglichen Sprachgebrauch – in Freundschaften, in Gesprächen außerhalb der eigenen Muttersprache und im Umgang mit Dialekten. Der deutsche Dialekt ist beispielsweise weiterhin stark vertreten: 90 Prozent nutzen ihn im familiären Umfeld, 45 Prozent am Arbeitsplatz – mehr als noch 2014.
Gleichzeitig wird ein übermäßiger Gebrauch von Dialekt von einem Teil der Bevölkerung als störend empfunden, insbesondere wenn er in Anwesenheit von Angehörigen anderer Sprachgruppen verwendet wird. Insgesamt nimmt die subjektive Bedeutung des deutschen Dialekts ab: Hielten ihn 2014 noch 64 Prozent für wichtig, sind es 2025 nur noch 51 Prozent. Ladinisch wiederum wird von lediglich 6 Prozent als bedeutsam für das Zusammenleben eingeschätzt.
Trotz eines allgemeinen Einvernehmens zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Sprachgruppen: 87 Prozent der italienischen und ladinischen Sprachgruppe halten gute Kenntnisse der italienischen Standardsprache für entscheidend oder sehr wichtig, bei der deutschen Sprachgruppe sind es 76 Prozent. Umgekehrt messen Angehörige der deutschen und ladinischen Sprachgruppe der deutschen Standardsprache und besonders dem Südtiroler Dialekt eine größere Bedeutung bei, während 10 Prozent der italienischen Sprachgruppe Deutsch als wenig wichtig oder unwichtig einstufen – ein Wert, der seit 2014 unverändert ist.
Während ältere Menschen Mehrsprachigkeit häufiger als persönliche Bereicherung sehen, betrachten jüngere sie vor allem als praktischen Vorteil.
Mehrsprachigkeit und MedienkonsumBeim Medienkonsum zeigt sich eine ausgeprägte Mehrsprachigkeit. Deutschsprachige konsumieren zu großen Teilen auch italienische Medien – im Fernsehen (68 Prozent), im Radio (64 Prozent) und in Zeitungen bzw. Online-Medien (84 Prozent). Ladinische Inhalte werden hingegen nur selten genutzt. Italienischsprachige greifen ebenfalls häufig auf deutschsprachige Medien zurück (TV 50 Prozent, Radio 54 Prozent, Publikationen 59 Prozent), ladinische Inhalte bleiben auch hier marginal.
Personen mit ladinischer Muttersprache nutzen fast durchgehend sowohl deutsch- als auch italienischsprachige Medien. Englische Inhalte werden unabhängig von der Muttersprache regelmäßig konsumiert: etwa ein Drittel im Fernsehen, ein Viertel im Radio und rund die Hälfte in Print- und Online-Medien.Trotz eines allgemeinen Einvernehmens zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Sprachgruppen: 87 Prozent der italienischen und ladinischen Sprachgruppe halten gute Kenntnisse der italienischen Standardsprache für entscheidend oder sehr wichtig, bei der deutschen Sprachgruppe sind es 76 Prozent. Umgekehrt messen Angehörige der deutschen und ladinischen Sprachgruppe der deutschen Standardsprache und besonders dem Südtiroler Dialekt eine größere Bedeutung bei, während 10 Prozent der italienischen Sprachgruppe Deutsch als wenig wichtig oder unwichtig einstufen – ein Wert, der seit 2014 unverändert ist.
Während ältere Menschen Mehrsprachigkeit häufiger als persönliche Bereicherung sehen, betrachten jüngere sie vor allem als praktischen Vorteil.
SüdtirolerIn, ItalienerIn, EuropäerInWie schon 2014 nennen die meisten Menschen „Südtiroler/in“ als wichtigste Selbstbezeichnung (55 Prozent). Auffällig ist jedoch der deutliche Anstieg der Identifikation als „Italiener/in“ (von 23 auf 36 Prozent) sowie als „Europäer/in“ (von 17 auf 25 Prozent). Andere Identitätszuschreibungen wie „Weltbürger/in“, „Tiroler/in“, „Altoatesino/a“ oder „Deutsche/r“ spielen eine geringere Rolle. Nur eine kleine Minderheit misst Fragen der Identität keine besondere Bedeutung bei.
Auch Themen wie das Empfinden von Benachteiligung, das allgemeine Zusammenleben sowie die Frage der Ortsnamen wurden untersucht. Insgesamt sehen 66 Prozent im Proporz einen positiven Beitrag zum friedlichen Zusammenleben. 81 Prozent der Bevölkerung beurteilen das Zusammenleben der Sprachgruppen als zufriedenstellend. Auffällig ist jedoch, dass gerade die italienische Sprachgruppe zwar mit der aktuellen Situation eher unzufrieden ist, gleichzeitig aber am häufigsten eine positive Entwicklung in den letzten fünf Jahren wahrnimmt (25 Prozent) und auch für die Zukunft am optimistischsten ist (38 Prozent).
Innerhalb der beiden größten Sprachgruppen zeigt sich zudem, dass Frauen, ältere Menschen und – bei den Deutschsprachigen – Personen mit höherem Bildungsgrad der jeweils anderen Sprache mehr Bedeutung für das Zusammenleben zuschreiben.
 Südtiroler/in? Italiener/in? Europäer/in?: Wie schon 2014 nennen die meisten Menschen „Südtiroler/in“ als wichtigste Selbstbezeichnung (55 Prozent). Foto: Ivo Corrà
Südtiroler/in? Italiener/in? Europäer/in?: Wie schon 2014 nennen die meisten Menschen „Südtiroler/in“ als wichtigste Selbstbezeichnung (55 Prozent). Foto: Ivo CorràIn den sozialen Medien zeigt sich eine starke Mehrsprachigkeit. Rund 70 Prozent der deutschsprachigen Nutzerinnen und Nutzer posten zusätzlich auf Italienisch, während Ladinisch kaum verwendet wird. Etwa 40 Prozent der italienischsprachigen nutzen Social Media auch auf Deutsch. Besonders mehrsprachig sind Personen mit ladinischer Muttersprache, die nahezu durchgehend sowohl Deutsch als auch Italienisch verwenden. Zudem greifen viele deutsch- und ladinischsprachige Personen auch auf den Dialekt zurück.
Die Bewertung von Mehrsprachigkeit hängt stark von soziodemografischen Faktoren ab: Während ältere Menschen Mehrsprachigkeit häufiger als persönliche Bereicherung sehen, betrachten jüngere sie vor allem als praktischen Vorteil. Frauen neigen etwas stärker dazu, Mehrsprachigkeit als Bereicherung zu empfinden, Männer hingegen stärker als konkreten Nutzen. Auch der Bildungsgrad beeinflusst die Haltung – Personen mit Hochschulabschluss stehen der Mehrsprachigkeit grundsätzlich positiv, aber eher pragmatisch gegenüber.
Nun muss man sehen, wie die Politik und die Sprach(en)wissenschaft die neuen Zahlen deutet und interpretiert...
Hier geht es zum PDF des Sprachbarometers

Deutsch-Muttersprachliche…
Deutsch-Muttersprachliche-Gesprächs-Teilnehmer, wechseln sehr schnell auf Italienisch, wenn sich EINER in der Runde mit dem Deutsch Schwierigkeiten hat.
Daselbe gilt auch "bei den angeblich un-verständlichen Dialekten," bei denen "die Südtiroler in die Hochsprache wechseln."
Deutsch-Muttersprachliche…
Deutsch-Muttersprachliche-Gesprächs-Teilnehmer, wechseln sehr schnell auf Italienisch, wenn sich EINER in der Runde mit dem Deutsch Schwierigkeiten hat.
Daselbe gilt auch "bei den angeblich un-verständlichen Dialekten," bei denen "die Südtiroler in die Hochsprache wechseln."