Mussolini mit Nebenwirkungen
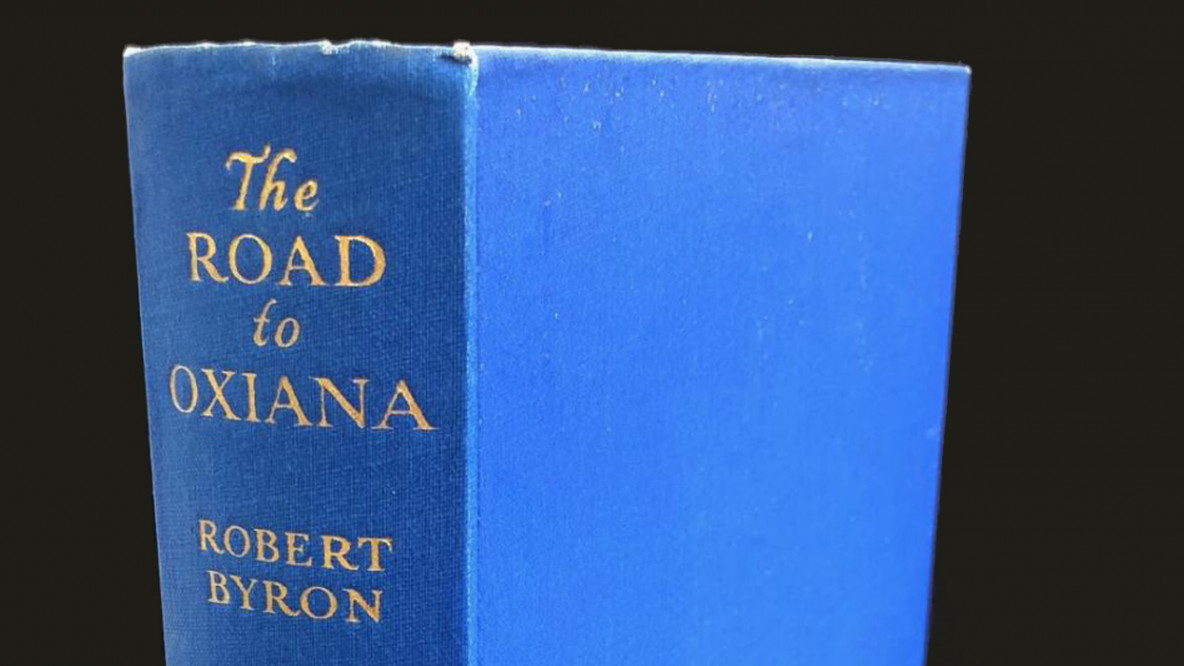
Für Bruce Chatwin war Robert Byrons Road to Oxiana schlicht das beste Buch aller Zeiten. Mit diesem Urteil ist Chatwin nicht allein. Byrons literarische Verarbeitung einer epischen Wanderschaft durch Persien und Afghanistan gilt bis heute als Klassiker der Reiseliteratur. Das lag auch daran, dass sich der Autor acht Jahre Zeit ließ für die Niederschrift.
Wesentlich zügiger kam Byrons erstes Buch zustande. Teilweise auf den Spuren seines großen Ahnen George Gordon (dem sechsten Lord Byron, Robert war der 13.) bereiste der Nachkomme zunächst Italien und anschließend Griechenland. Ergebnis war der Titel Europa 1925.
Die Intention hinter Byrons Erkundungstour könnte auch aktuell jeder Bildungsreise zugrunde liegen: „Europa als Ganzes ist den meisten seiner Bewohner, die in der desaströsen Tradition bewaffneter und isolierter Staaten aufgewachsen sind, eine derart unbekannte Größe“, findet der damals erst 20-jährige Autor, dass sie sich den Erlebnissen eines jungen Briten öffnen und anhand seines Beispiels „den Sinn für ein nach und nach heranwachsendes europäisches Bewusstsein“ entwickeln sollten.
Ein Spiegel der Moderne? Nicht ganz.
Armer Byron! Nicht nur, dass seine Landsleute bis 1973 für den Beitritt zur Staatengemeinschaft brauchten, haben sie die EU schon wieder verlassen. Eine Rückkehr bleibt in den Sternen, Byrons Plädoyer in der Heimatunerhört. Dabei musste ein erklärter Zyniker wie er weit über den eigenen Schatten springen, um sich – in Zeiten einer faschistischen italienischen Regierung, die längst einen neoimperialistischen Fuß auf die ursprünglich griechischen Inseln in der östlichen Ägäis gesetzt hatte – zu Europas Wurzeln und Zukunft zu bekennen. Nach der Lektüre wird sich manch britischer und natürlich auch kontinentaler Leser fragen, ob beim Brexit nicht doch etwas falsch gelaufen ist.
Spätestens wenn sie, wie seinerzeit Byron, auf dem Weg nach Süden eine ähnliche Erfahrung mit dem Hamburger Zoll machen, wo Reisende „drei Stunden lang aufgehalten“ wurde. Ein Spiegel der Moderne? Nicht ganz. Byron ist mit zwei Kumpels, Simon und David, in einem soliden, aber reparaturanfälligen Sunbeam unterwegs, mit einer Viereinhalblitermaschine unter der langgezogenen Motorhaube. Der Spritverbrauch ist hoch, die Tankstellendichte niedrig, das Straßennetz in Italiens Mitte und Süden löchrig und der Pannenbefall chronisch. Wenigstens hapert es dem Trio nicht an finanziellen Mitteln: mit dem Pfund, zumal dem britischen, ließ sich in den 1920er Jahren auf dem Festland prima wuchern.
Italien ist nicht so sehr Opfer einer Diktatur, sondern einer Ochlokratie, der Herrschaft eines bewaffneten Pöbels, eines unreifen zumal.
Was aber ist, diese Frage musste sich jedem Italienreisenden der Zwischenkriegzeit stellen, mit dem Faschismus? Mussolini war seit zweieinhalb Jahren an der Macht und Italien spätestens seit dem Mord an Giacomo Matteotti ein Jahr vor Byrons Besuch eine brutale Diktatur. Hiervon ist im Buch wenig zu spüren. Byron scheint sich eher am Chaos als an der Repression zu stoßen, mit der Arroganz des Snobs, der auch mal ein Auge zudrückt, wenn Ansätze einer gewissen Ordnung erkennbar sind – ganz gleich, auf wessen Kosten diese geht. Nach einer Begegnung mit einem Giovinezzatrupp in Bologna, lärmend, enthusiastisch, ungeschlacht, notiert Byron: „Der Faschismus ist tatsächlich eine Art Boy Scout-Regime, statt Knüppeln gibt es hier allerdings Revolver.“ Ein Grund, sich zu fürchten? Keineswegs: „Italien ist nicht so sehr Opfer einer Diktatur, sondern einer Ochlokratie, der Herrschaft eines bewaffneten Pöbels, eines unreifen zumal.“
Die Augen gehen Byron erst später auf. Über Korinth, Athen und den Hafen Piräus landet er auf dem der Türkei vorgelagerten Dodekanes. Die Inselgruppe, von Italien 1912 im Krieg gegen die Türkei besetzt, erfuhr seitdem einen steten Niedergang: „Der materielle Wohlstand“, lautet Byrons trister Befund, „geht rapide zurück.“ Die Faschisten machten alles noch schlimmer, leiteten eine Italianisierung ein, schikanierten die lokale Bevölkerung und gingen rigoros gegen griechische Autonomiebefürworter vor. Es gab Tote, etwa bei einer Demonstration auf Rhodos kurz vor Byrons Ankunft.
Was für Italien gut sein mag, soll anderen Nationen erspart bleiben
Byron rüffelt vor allem die eigene Regierung, die nicht nur zuschaute, sondern Italien sogar seine Kriegsschulden erließ – nur um der geopolitischen Lage willen, da in London die vermeintliche türkische Gefahr viel höher eingestuft wurde als eine Bedrohung durch eine westliche, wenn auch faschistische Macht. Der Schmusekurs gegenüber Mussolini (und Hitler) sollte sich bis zur Münchner Konferenz ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fortsetzen.
Trotz solcher Kritik reiht sich Byron eher in die Schar internationaler Bewunderer des Faschismus ein. Dessen Herrschaft in Italien bewertet er als „unstrittig erfolgreich“. Zwar weigert sich Byron, das gern bemühte Klischee von der früher nie gekannten Pünktlichkeit der Züge zu übernehmen. Seine Argumente für den Duce entstammen „der Wohlfahrtspflege, der Bildung und des industriellen Wachstums“ und rechtfertigen die „Herrschaft und den Enthusiasmus seiner Gefolgsleute“.
Nur mit der Gewaltanwendung will Byron sich nicht anfreunden. Er erkennt sogar eine „angeborene Vulgarität“. Was für Italien gut sein mag, soll anderen Nationen erspart bleiben, nämlich „ein jämmerliches und unterdrücktes Dasein unter der römischen Knute“, wie es die Bewohner des Dodekanes gerade leidvoll erfahren. Der Antagonismus Faschismus versus Demokratie dient Byron als Katalysator eines neuen Bewusstseins: „das Bewusstsein, nicht nur Engländer zu sein, sondern auch Europäer.“ Als im strengen Sinne letzteren lässt er Mussolini dann doch nicht gelten.
Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.