Bauen, eine olympische Disziplin

-
Kurz vor der Eröffnung der Mailänder Expo im Jahr 2015, dem letzten italienischen Großereignis vor den diesjährigen Olympischen Spielen, schockierte eine Nachricht das Land. Der italienische Länderpavillon, jener des Gastgebers, würde zur Eröffnung nicht fertiggestellt sein – nur um wenige Tage später Entwarnung zu geben und dessen Fertigstellung zu verkünden. Dass dabei große Teile der bereits produzierten Fassade schlicht nicht montiert wurden, kam kaum zur Sprache. Anstelle der vorgesehenen Fortführung der filigranen Außenfassade in den Innenhof zeugten vor Ort lediglich große, ungenutzte Befestigungspunkte und ein dramatischer Schnitt in den weißen, kontinuierlichen Stahlelementen von einer pragmatischen Notentscheidung. Die Eröffnung gelang, das Gesicht blieb gewahrt. Mehr Fassade war nie geplant.
-
Großevents sind und waren schon immer Booster für Bauprojekte jeglicher Art, was zu einem zentralen Nebeneffekt solcher Veranstaltungen geworden ist. Dass diese Projekte oft weniger mit dem Event selbst zu tun haben, sondern lediglich unter dessen Deckmantel schneller realisiert werden können, ist Fluch und Segen zugleich. Auch diesmal beweisen wir das wieder mit Bravour. Knapp 50 % der olympischen Projekte werden erst nach den Spielen fertiggestellt sein. Das wird zu absurden Situationen führen, deren Tragweite uns wohl erst noch bewusst werden muss.
Zwar gibt es in Südtirol Infrastrukturprojekte, die zweifellos stark von diesem Booster profitiert haben und deren Umsetzung bereits lange geplant war. Doch es gibt auch Projekte, bei denen uns erklärt wurde, man brauche sie unbedingt für die Spiele, um das erhöhte Verkehrsaufkommen bewältigen zu können. Nun jedoch befinden sich diese Projekte – wie die Umfahrung von Toblach oder der Eingang ins Antholzertal – noch in der Bauphase, und die effektiven Zufahrten zu den Sportstätten werden über provisorische Baustellenstraßen erfolgen, deren Kapazitäten vermutlich geringer sein dürften als bisher. So oder so wird sich das Pustertal bei den Spielen von seiner ehrlichsten Seite zeigen und eine lange Anreise vorbei an zahlreichen Baustellen garantieren.
... so wird sich das Pustertal bei den Spielen von seiner ehrlichsten Seite zeigen, mit einer langen Anreise vorbei an zahlreichen Baustellen...
Auch andernorts setzte sich die italienische Baupolitik der Spiele stärker durch als der Gedanke internationaler Kooperation. Anstelle einer alpinen Zusammenarbeit mit Innsbruck zur Nutzung des dortigen Eiskanals entschied man sich für einen nationalen Prestigebau in Cortina. Von der grenzüberschreitenden Kooperation, die man einst mit der Alemagna unbedingt anstrebte, scheint heute keine Spur mehr zu sein.
Die größte olympische Enttäuschung liegt jedoch in einer baulichen Tradition der Spiele: dem Olympischen Dorf von Mailand – den gemeinsamen Wohnstätten der Athletinnen und Athleten. Es verdeutlicht nicht nur die derzeitige Visionslosigkeit des Gastlandes im Wohnungsbau generell, sondern auch, wie sehr sich die Spiele offenbar von ihrem einst repräsentativen Charakter entfernt haben – gefangen in einem sich ständig wiederholenden Trott, sodass man sich sogar auf der offiziellen Webseite entschlossen hat, auf Fotos zu verzichten.
Das Olympische Dorf war über gut hundert Jahre hinweg das Aushängeschild der Gastgebernation – Orte, an denen sich die Gäste aufhielten, die eigentlichen Visitenkarten des Ausrichterlandes, an denen Erinnerungen entstanden, lange bevor Kameras und Bilder das Geschehen weltweit zugänglich machten. Bis zum Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972 waren diese Dörfer offene Begegnungsorte. Seither sind sie zu Hochsicherheitszonen geworden, dennoch nutzen viele Städte die Gelegenheit, um langfristig Impulse für den lokalen Wohnungsmarkt zu setzen.
...das Weltereignis nicht bloß für kurzfristige Bauprojekte, sondern als Instrument der Stadtentwicklung...
Von den horizontalen und vertikalen Wohnutopien der 1970er Jahre in München und Montreal über die US-amerikanischen Kooperationen mit Universitäten und Studierendenwohnheimen bis hin zu jüngsten Beispielen wie in Paris, wo nicht nur das Olympische Dorf, sondern die gesamten Spiele zur Stadterneuerung des bisherigen Problemviertels Saint-Denis genutzt wurden – alles eingebettet in die langfristige Planung von Grand Paris. Man nutzte das Weltereignis nicht bloß für kurzfristige Bauprojekte, sondern als Instrument der Stadtentwicklung, um nachhaltige Effekte zu erzielen. So mag die mediale Aufregung um die Reinigung der Seine zuweilen wie eine Farce erscheinen, doch wurde der Fluss nach über hundert Jahren tatsächlich hygienisch aufgewertet – ein Beitrag, der sich in eine Reihe gleichwertiger Projekte großer Metropolen weltweit einreiht und in Paris eben durch die Spiele frühzeitig realisiert werden konnte.
Auch Italien verfolgte einst einen ähnlichen Weg. Bei den Spielen in Rom 1960 widmete man sich einem vernachlässigten Innenstadtviertel und trieb im Norden der Altstadt eine urbane Erneuerung voran. Selbst 2006, bei den Winterspielen in Turin, war das Engagement für nachhaltige Stadtentwicklung spürbar stärker als heute. Es entstanden zeitgemäße Wohnviertel der 2000er-Jahre, die langfristig gedacht waren. Dass beide Projekte später abrutschten und zeitweise zu Problemvierteln wurden, zeigt lediglich, wie rasch das Interesse nach dem großen Event erlischt – und wie wenig von den zuvor hochgelobten Ideen übrigbleibt. Doch immerhin gab es sie einst. Dieses Jahr scheint es sie gar nicht erst gegeben zu haben – oder sie haben nicht einmal bis zu den Spielen selbst überdauert.
...wie wenig von den zuvor hochgelobten Ideen übrigbleibt...
Zeigten die ersten Renderings aus Mailand noch einen Hauch von Konzept und Begeisterung für das Olympische Dorf, lässt der fertiggestellte Ist-Zustand selbst die plattenbauverwöhnten Regionen Osteuropas erblassen. Sechs triste, langgezogene und monotone Wohnblöcke mit endlosen Reihen gleichförmiger quadratischer Fensteröffnungen, deren einziger gestalterischer Akzent zwei über jeweils drei Blöcke gespannte Fluchtweganlagen sind. Keine Balkone, keine baulichen Verschattungen, keine Begrünung. Keine Abwechslung, keine Liebe zum Detail, keine ablesbaren Strukturen. Geschweige denn ein Hauch von Wohnlichkeit. Beim Anblick dieser Kolosse drängen sich die schlimmsten Studentenheim-Klischees der 1950er- und 60er-Jahre auf. Wie gebaute Klimaleugner stehen sie da – und verneinen alles, was im Bau- und Wohnsektor der letzten Jahre zum Common Sense geworden ist. Oder zeigen sie schlicht und ehrlich, wie es um den Mailänder Wohnbau seitdem Expo-Boom bestellt ist?
Eines ist sicher: Der Glanz der Spiele wird vergehen, doch ihr bauliches Erbe wird bleiben. Dieses Jahr wird es wohl noch schwerer als sonst sein, das Interesse an den Strukturen des Olympischen Dorfs aufrechtzuerhalten – und sie vor dem Abgleiten in die bekannte Problemviertel-Dynamik zu bewahren. Der einzige Hoffnungsschimmer liegt darin, dass die Wohnraumsituation in Mailand – wie in allen europäischen Metropolen – derart angespannt ist, dass letztlich alles genutzt wird, was verfügbar ist. So wird man wohl auch für diese Bauten eine Verwertung finden – vermutlich sogar noch eine relativ hochpreisige. Und damit passen diese grauen, aus der Zeit gefallenen Elefanten vielleicht doch besser zu den Olympischen Spielen, als man anfangs glauben möchte.
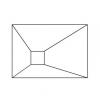






Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.