Aus dem Bauch

-
1. Gute und weniger gute Gefühle
Jene Politik, die den Bauch anspricht, greift um sich, nicht nur in Trumps Amerika. Südtirol hatte 2024 emotional einiges zu bieten, im Positiven beispielsweise einen nie dagewesenen „Wir-sind die-Nummer-1"-Hype rund um Jannik Sinner, einen Hype, der von allen Bevölkerungsgruppen des Landes geteilt wird.
Weniger gute Gefühle gab es angesichts der nicht enden wollenden Wolfs- und Bärengeschichten, bei denen der eher städtisch geprägte Tierschutz dem eher ländlich geprägten Kampf gegen Großraubtiere gegenüberstand. Mit seinem Dokumentarfilm „Gefährlich nah. Wenn Bären töten" schuf Andreas Pichler weit über die Grenzen des Landes hinaus etwas objektivere Klarheit.
Die neu angetretene Landesregierung versuchte sich 2024 irgendwie zusammenzuraufen und gemeinsame Nenner zu finden, die bis 2028 halten können - wenn möglich.
Als Sündenbock musste 2024 die Migration herhalten und das nicht nur, wenn es ums Thema Sicherheit ging. Der im März neu bestellte Quästor Paolo Sartori profilierte sich jedenfalls als Hardliner, wenn es um Festnahmen und angestrebte Ausweisungen ging und setzte auf ausgiebige Kommunikation seiner Maßnahmen. Dafür bekam er Applaus, vereinzelt auch Drohungen. Das allgemeine Unsicherheitsgefühl wurde damit befeuert, und Medien spielten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
Noch so ein Bauchthema war 2024 der Tourismus. Der Klimawandel hingegen war kein Thema, das die öffentliche Meinung oder die Politik besonders bewegt hätte.
Wie Bauchthemen gezielt politisch gespielt werden, zeigte das Thema Schule und Sprache besonders deutlich. -
2. Der Fall Goetheschule
Im Herbst lösten die Medien einen Disput um die Klassenbildung in der Bozner „Goetheschule" aus, der auch über die Grenzen des Landes hinaus starkes Echo bekam. Landesintern brachte das Thema viele politische Parameter durcheinander, es zeigte aber auch, was geschieht, wenn aufgrund von „Hörensagen" berichtet wird.
In dieser Schulaffäre wurden alle zu Fachleuten - Medien, Kommentierende, Social Media Nutzende, die Politik. Schule scheint eine einfache Materie zu sein, weil alle einmal dort waren.2.1 Vorausgeschickt
Bevor die Erzählung zu den Ereignissen im August 2024 beginnen kann, empfiehlt es sich, in Erinnerung zu rufen, worauf das Schulsystem in Südtirol beruht. Mit Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 670 vom 31. August 1972 wurde das Autonomiestatut veröffentlicht. In Artikel 19 geht es um die Schule.
„In der Provinz Bozen wird der Unterricht in den Kindergärten, Grund- und Sekundärschulen in der Muttersprache der Schüler, das heißt in italienischer oder deutscher Sprache, von Lehrkräften erteilt, für welche die betreffende Sprache ebenfalls Muttersprache ist. In den Grundschulen, von der 2. oder 3. Klasse an, je nachdem, wie es mit Landesgesetz auf bindenden Vorschlag der betreffenden Sprachgruppe festgelegt wird, und in den Sekundarschulen ist der Unterricht der zweiten Sprache Pflicht; er wird von Lehrkräften erteilt, für die diese Sprache die Muttersprache ist" (Autonomiestatut 2024).
hieß es vor 52 Jahren. Und weiter:
„Die Einschreibung eines Schülers in die Schulen der Provinz Bozen erfolgt auf Grund eines einfachen Gesuches des Vaters oder seines Stellvertreters. Gegen die Verweigerung der Einschreibung kann der Vater oder sein Stellvertreter bei der Autonomen Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes Berufung einlegen" (Autonomiestatut 2024).
Damals sollte die deutsche Schule so gut wie möglich abgesichert werden. Aus historischen Gründen war das nachvollziehbar, denn in Zeiten des Faschismus war das Deutsche in der Schule plötzlich und radikal abgeschafft worden, auch am Pausenhof. Das sollte sich nie mehr wiederholen.
2.1.1 Veränderung
Der „Vater oder sein Stellvertreter" klingt heute ziemlich aus der Zeit gefallen. Das erklärt sich damit, dass das Autonomiestatut unverändert blieb. Verändert hat sich in diesen 52 Jahren jedoch die Gesellschaft, und darauf wurde zu wenig geachtet. Der Fall Goetheschule zeigt, was Medien machen können, was Sprache machen kann und was mit den Menschen dahinter geschieht.
2.2.1 Muttersprache/Vatersprache/Erstsprache
Das Südtiroler Schulsystem funktioniert nach dem Prinzip der Muttersprache, ist also dreigeteilt. Die drei Systeme kommunizieren sehr wenig miteinander.
Der Duden sagt, „Muttersprache" sei jene „Sprache, die ein Mensch als Kind (von den Eltern) erlernt und primär im Sprachgebrauch hat." Die Linguistik ersetzt den Begriff inzwischen durch den neutraleren der „Erstsprache".
Als Erstsprache/Muttersprache gelten in Südtirol Deutsch, Italienisch oder Ladi- nisch. Weil sich die Gesellschaft aber weiterentwickelt hat, gibt es auch in Südtirol weitere Erstsprachen, und es kommt zu Vermischungen, ja sogar zu Situationen, in denen es zwei Erstsprachen gibt, eine „Muttersprache" und eine „Vatersprache".
Es gibt Familien, in denen nur eine der Landessprachen benutzt wird. Es gibt Familien, in denen mehrere der offiziellen Landessprachen zusammenkommen. Es gibt Familien, für die sowohl Deutsch als auch Italienisch Fremdsprachen sind. Es gibt auch Familien, in denen Elternteile nicht alphabetisiert sind. Die Kinder all dieser Familien kommen in eine der Schulen, die Südtirol im Angebot hat.2.1.3 Italiani
Vor inzwischen mehr als 100 Jahren begann in Südtirol die Ansiedlung von Menschen aus anderen Regionen Italiens. Meist kamen sie aus ärmeren Verhältnissen. 1923/24 wurde das Deutsche in der Schule abgeschafft. Das Italienische wurde sprachlich dominant, sozial dominant blieb aber die deutschsprachige Bevölkerung, sie hatte den Besitz, war aber ihrer Sprache „enteignet" worden.
Sozial entstand ein Ungleichgewicht, das sehr viel später den so genannten „disagio" (Unbehagen) auslöste und beispielsweise zur Folge hatte, dass sich ein Großteil der italienischen Bevölkerung der deutschen Sprache verweigerte. Das Deutsche an italienischen Schulen war/ist nicht beliebt und wurde/wird selten mit Hingabe unterrichtet. (Dasselbe gilt inzwischen vermehrt auch für das Italienische an peripheren deutschen Schulen).
Einzelne versuchten/versuchen, ihren „disagio" durch Annäherung an die deutsche Sprachgruppe auszuschalten. Sie schickten/schicken die Kinder auch ohne ausreichende Vorkenntnisse in die deutsche Schule. Damit sollte/soll ihnen der soziale Aufstieg erleichtert werden.
Umgekehrt gibt es dieses Phänomen nicht. Es gibt keine deutschsprachigen Familien, die ihre Kinder in die italienische Schule schicken.2.1.4 Mehrsprachige
Bei mehrsprachigen Familien kann es auch vorkommen, dass ein Kind die Pflichtschule in der einen, die Oberschule in der anderen Landessprache besucht. Meistens ist das in zweisprachigen Familien kein Problem.
Neu dazugekommen ist jene Vielsprachigkeit, die überall in Europa durch die Mobilität/Migration entsteht, und da greifen die alten Muster aus dem Jahr 1972 nicht mehr wirklich. Südtirol ergeht es wie anderen Ländern: es müssen Lösungen gefunden werden, die einen zufriedenstellenden Schulbesuch und einen angenehmen Unterricht für alle ermöglichen. Das kann überall zu Problemen führen, in Südtirol ist die Sache aus historischen Gründen besonders vertrackt und deshalb besonders attraktiv für politische Mobilisierungen.2.2 So fing alles an
Es war der 28. August 2024, acht Tage vor Schulbeginn, als Medien darauf aufmerksam machten, dass an der Goetheschule in Bozen etwas anders war als üblich.
Die Tageszeitung Dolomiten titelte im Aufmacher „Zu viele ohne Deutschkenntnisse. Direktorin greift zur Selbsthilfe" (Dolomiten 2024a) und legte im Innenteil noch eins drauf: „Kein Deutsch? Ab in eine eigene Klasse" (Dolomiten 2024b). Und im zweiten Innentitel hieß es „Deutsche Schule: SVP fährt die Krallen aus" (Dolomiten 2024c). Wer die Redaktion auf das Thema hingewiesen hatte, ist nicht bekannt.
Die Redakteurin (bv) begann ihre Erzählung mit einer Rüge, die sich an Teile der SVP richtete und in folgendem Satz versteckt war: „Eigentlich sollte alles anders werden, doch im Herbst wird die deutsche Schule in den Städten und im Unterland erneut von Kindern geflutet, die des Deutschen nicht mächtig sind." (Dolomiten 2024b) Man habe vor der Landtagswahl „ein verpflichtendes Beratungsgespräch und Kurse im Sommer" als „neue Hürde gegen die Flut von ABC-Schützen mit massiven Sprachproblemen" eingeführt (Dolomiten 2024b). Wer dann aber „mit seinem Sprössling nach Pakistan fährt, ohne Kurse zu absolvieren, kann das Kind trotzdem in die deutsche Schule schicken", hieß es wertend (Dolomiten 2024b). Damit war Gefühlslagen Tür und Tor geöffnet.
Wohlgemerkt: die zitierten Formulierungen stammen von der Dolomiten-Redak- tion, nicht von der im Artikel genannten Schuldirektorin, die auch im Bild zu sehen war. Diese hatte lediglich Auskunft gegeben über die Klassenzusammensetzung, die auf der Grundlage eines ausgeklügelten Konzepts erfolgt war, das auch bekannt gewesen wäre.
Es wäre darum gegangen, das bereits existierende Goethe-Modell, das früher schon mit der Universität Bozen ausgearbeitet worden war, zu ergänzen. Ziel wäre es gewesen zu verhindern, dass Schule aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse als Ort der Frustration erlebt wird. Das bestehende Goethe-Modell unterrichtet Ganztags- und Halbtagskinder in bestimmten Tagesabschnitten gemischt und folglich gemeinsam.
Mit der Öffnung von Klassen wollte auch das Konzept „Sprache-Plus-Klasse" arbeiten und zwar in einem mehrjährigen Prozess. Es sah bei den ersten Klassen einen Zug vor, in dem Kinder mit guten bis sehr guten Deutschkenntnissen und solche aus anderssprachigen Familien mit ausreichenden Sprachkenntnissen sitzen. In der anderen ersten Klasse sollten Kinder mit nicht ausreichenden Sprachkenntnissen gezielt gefördert werden, um so Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Am Nachmittag sollten alle Ganztagskinder dann sowieso gemeinsam unterrichtet werden. Geplant waren auch gemeinsame Projekte mit der Klasse der Reformpädagogik, die meist von muttersprachlichen Kindern besucht wird.
Ziel wäre es gewesen, am Ende der ersten Klasse ein Sprachniveau zu erreichen, welches eine Öffnung der Klassen im zweiten Jahr ermöglicht hätte. In den Folgeklassen wären die Stundenpläne so parallelgeschaltet worden, dass die Klassen anlassbezogen geöffnet und gemischt unterrichtet hätten werden können. Das Modell versprach sich mit dieser Methode Inklusion durch ein differenziertes und individualisiertes Bildungsangebot in hetero- und auch homogenen Gruppen.
Die nun folgende hoch emotional ausgetragene monatelange Debatte fußte aber nur auf dem Hörensagen, denn zum komplexen Projekt selbst wurde nicht weiter recherchiert. Dazu kam, dass die einen von den anderen abschrieben. Worum es wirklich ging, schien wenig zu interessieren. -
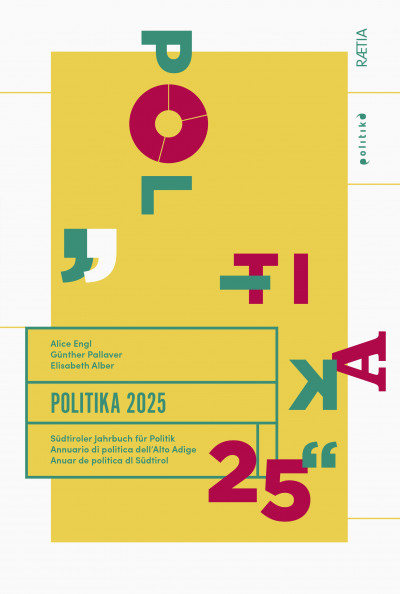 Jahrbuch Nummer 18: Alljährlich im Frühjahr erscheint POLITKA – Das Südtiroler Jahrbuch für Politik. Foto: Edition Raetia
Jahrbuch Nummer 18: Alljährlich im Frühjahr erscheint POLITKA – Das Südtiroler Jahrbuch für Politik. Foto: Edition Raetia2.3 Die Macht der Worte
Während die RAI Südlirol sachlich darüber berichtete, dass an der Goetheschule eine Sprachförderklasse eingerichtet werde, die „Kinder auf ein gemeinsames Lernen mit deutschsprachigen Kindern vorbereiten" soll (RaiSüdtirol 2024a), donnerte die Politik los.
Schnell war der Begriff der „classi ghetto" geprägt, dessen Copyright möglicherweise auf den italienischen Bildungslandesrat Marco Galateo der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia zurückgeht, ein Begriff, der in den Medien nun ständig wiederholt wurde.
Ungeachtet der Frage, ob so eine Terminologie angesichts der Geschichte passend ist, hat der Begriff mit Sicherheit etwas bewirkt, vor allem unter den Betroffenen. Es fühlt sich nämlich anders an, eine Sprachförderklasse, eine Willkommensklasse, eine „Sprache-Plus-Klasse" oder eine „Ghetto-Klasse" zu besuchen.
Die Tageszeitung „Alto Adige" schrieb am 29. August auf der Titelseite „ Classi 'ghetto' alle elementari. Il caso. Bufera sulla decisione della direttrice della Goethe di istituire una sezione speciale per i bambini che non parlano il tedesco. No di Kompatscher e Achammer" (Alto Adige 2024).
Im Innenteil ließ die Journalistin Sara Martinello dann unter anderem den italienischen Bildungslandesrat Marco Galateo (FdI) zu Wort kommen, der den Begriff „Ghetto" als Zeichen der Entrüstung über den Versuch der Goethe-Schule benutzte. Er zeigte sich mit den deutschen Regierungsvertretern Kompatscher und Achammer darüber einig, dass das so nicht geht. Der „rechte" Galateo witterte zudem Rassismus (Martinello 2024).
Von Rassismus sprach auch der „linke" PD-Senator Luigi Spagnolli, der beklagte, dass die Stellungnahme des SVP-Parteiobmanns Steger, der sich für das Konzept ausgesprochen hatte, „intrinsecamente razzista" sei. Spagnolli sagte auch, er hoffe, dass „tutti i bambinifacciano lapausa insieme e che entrino dallo stesso ingresso" (L'Adige 2024). Spagnolli gab zwar zu, dass er das Projekt nicht kenne und deshalb nicht beurteilen könne, ob die Direktorin möglicherweise das Richtige getan habe. Das Wort Rassismus verwendete er trotzdem, und das tut was mit den Bäuchen.
Genauso löst der Begriff „fluten" Bilder und Gefühle aus. Er prägte die Debatte in der Tageszeitung Dolomiten. Mit dem Bild, dass Kinder, die nicht Deutsch können die Schule „fluten" wurde losgelegt, und dieses „Fluten" wurde Monate später auch noch wiederholt (Heidegger 2024).2.4 Unheilige Allianzen
Der Verein Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) sprang auf den „classi ghetto"-Zug auf und beklagte, dass die Einrichtung dieser Klassen „dal maggior partito della nostra terra" gesponsert und „da altre forzepolitichepiu estremiste" unterstützt worden sei, obwohl „infondata sul piano culturale, scientifico e didat- tico, inaccettabile sul piano istituzionale e illegittima ai sensi dei principi della Costituzione e della stessa autonomía" (L'Adige 2024). Auch der Anpi kannte das Projekt nicht wirklich.
Als sich dann der Kammerabgeordnete der postfaschistischen Fratelli d'Italia (FdI), Alessandro Urzì, mit der Partisanenvereinigung Anpi einig zeigte und vor dem „geradezu gefährlichen" Vorgehen der Goetheschule warnte, kamen die politischen Linien endgültig durcheinander. Die Schule sei ein Ort der „Erziehung zu den bürgerlichen und kulturellen Werten der westlichen Gesellschaft" dekretierte Urzi (stol 2024). „Wenn wir darauf verzichten, indem wir Ghettos schaffen, schaffen wir soziale Bomben und Orte der Auseinandersetzung" (stol 2024). Dass sich Urzì - wie viele andere - nicht wirklich mit dem Konzept befasst hatte, wird daran deutlich, dass er sich auf die Migration bezog, die im Fall der Goethe-Schule aber eigentlich nicht im Mittelpunkt stand.
Die Liste der „unheiligen Allianzen" im Fall Goetheschule ließe sich unendlich weiterschreiben. Sie beruhten/beruhen vor allem auf dem Spiel mit Emotionen, dem politischen Kalkül also.2.5 Schlagwort Integration
Besonders unverständlich ist das plötzliche Engagement für die Integration (auch Zugewanderter) von Seiten jener Partei, die in Rom die Regierung stellt, jene Regierung, die ein glückloses Abschiebezentrum in Albanien gebaut hatte und sich auch sonst nicht unbedingt von rassistischen Äußerungen distanziert.
„Das ist eine Ghetto-Klasse und Rassismus pur', faucht der italienische Bildungsrat Marco Galateo", kolportierte die Tageszeitung Dolomiten einen Tag nach Aufdeckung des angeblichen „Skandals" unter dem Titel „Zoff um Goethe in der Koalition. Schule: Kein Deutsch, eigene Klasse: FdI auf der Palme" (Dolomiten 2024d).
Als dann im gleichen Kontext auch Lega-Landesrat Christian Bianchi zu Wort kam, wurde einiges klarer „Sollten Migranten in einer Klasse zusammengelegt worden sein, ist das mehr als diskutabel. Sind auch italienische Kinder darunter, ist es zu verdammen" (Dolomiten 2024d).
Das ist nämlich einer der Gründe für die Entrüstung in der italienischen Polit- szene. Es ist offensichtlich nicht erwünscht, dass die eigenen des Deutschen nicht mächtigen Kinder mit Migrantenkindern in eine Klasse gesetzt werden, sollten sie in die deutsche Schule eingeschrieben worden sein.
Integration bedeutet im Schulkontext übrigens mehr als die Integration zugewanderter Menschen. So findet der Begriff Anwendung, wenn es um Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen (heute auch Diagnosen) geht. Im deutschen Sprachraum werden diese vielfach noch in sogenannten Sonderklassen unterrichtet. In Italien wurden diese Klassen 1977 abgeschafft, und darauf ist man zu Recht stolz. Aber Begriffe können zu Missverständnissen führen. Wenn in den Medien zum Fall Goetheschule die Begriffe Integration bzw. Sonderklasse verwendet werden, schwingen all diese Nebenbedeutungen mit, und die verstärken die Emotionalisierung.2.6 Das Überschwappen
Der „Fall Goetheschule" schaffte es übrigens sehr rasch in die nationalen und internationalen Medien. Bereits am Tag des Eklats, gegen Abend allerdings, berichtete „Il Giornale" davon: „Una classe di soli migranti e italiani che non sanno il tede- sco: bufera a Bolzano. L'istituto elementare Goethe nel caos, la preside si difende sottolineando di non voler rallentare l'apprendimento dei bambini di madrelingua. SVP a favore, ira FdI: 'E pericoloso'" (Balsamo 2024). Am Tag danach lieferte „Il Fatto Quotidiano" den Titel: „No alla classe ghetto di Bolzano, la sovrintenden- te scolastica: 'Lapreside deve seguire la norma'" (Corlazzoli 2024).
„Absage an Klassen für Migranten-Kinder" (Orf.Tirol 2024a), meldete der ORF - eine Ungenauigkeit, die in der Berichterstattung immer wieder vorkam, obwohl es sich im Fall der Goethe-Schule keineswegs „nur" um Migranten-Kinder handelte, sondern um Kinder mit nicht ausreichenden Sprachkenntnissen, die ohne Zweifel auch die italienische Staatsbürgerschaft haben können.
Die „Frankfurter Rundschau" titelte: „,Traurige Affäre' spaltet Südtirol: Grundschul-Rektorin entfacht riesigen Eklat". Die Rundschau berichtete, dass über das Thema Sprachförderklassen oder gemeinsames Lernen auch in anderen Ländern wie Deutschland und Österreich gestritten werde. „Kurzzeitiger Sprachunterricht könne sinnvoll sein, sagte Hannes Schweiger vom Institut für Germanistik dem Standard. Dabei müssten die Kinder aber möglichst schnell in reguläre Klassen integriert werden" (Bletzinger/Schaefer 2024).
„Warum Südlirol über eine Deutsch-Förderklasse streitet", erklärte Matthias Rüb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung „Weil viele Kinder an der Bozener Goethe-Schule nicht mehr Deutsch sprechen, wollte die Direktorin eine Förderklasse bilden. Dafür bekam sie ein Disziplinarverfahren. War das angemessen?" (Rüb 2024).2.7 Die Menschen
Die Direktorin geriet in den Fokus von Politik und Medien, wurde in Kommentaren gelobt oder gerügt und beschloss folgerichtig, sich nicht mehr öffentlich zu äußern. Gegen sie wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das sogar eine Gehaltskürzung zur Folge haben könnte.
Das Projekt Sprache Plus wurde vom Schulamt nie bekannt gemacht, es wurde offensichtlich nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, es als Grundlage für unaufgeregte Gespräche zu sehen.
Die von Politik und Medien kreierten Negativ-Schlagworte aber werden nicht so schnell in Vergessenheit geraten.
In der SVP haben sich zu diesem Thema Gräben aufgetan. Befördert wurde diese Spaltung durch die bevorstehenden Gemeindewahlen und die Angst vor Konkurrenz von Rechtsparteien. Eine parteiinterne Kommission soll's rechtzeitig richten - möglicherweise.
Von den Kindern selbst und von den Lehrpersonen war in der öffentlich ausgetragenen Aufregung nie die Rede, obwohl es gerade für diese eine große Herausforderung ist, mit den gesellschaftlichen Veränderungen zurechtzukommen. Sowohl Lehrpersonen als auch die Familien selbst müssen sich damit auseinandersetzen. Dass sie alle nun über Medien und Politik (hoffentlich nur vorübergehend) zu jenen werden mussten, die mit „dieser" Schule zu tun haben, hat ihnen sicher nicht gutgetan.
Von der Möglichkeit, das Südtiroler Schulsystem - auch nur versuchsweise - aus den Käfigen herauszuholen und dann grundlegend zu überdenken war auch nie die Rede.
Was geblieben ist, sind ungute Bauchgefühle, eine Vorwahlkampf-Stimmung in der Stadt Bozen und Bauchweh in Parteien und Koalitionen.
Und weil sich die Mischung von Migration und Schulgeschichten offensichtlich als lohnend erwies, schickte die Tageszeitung Dolomiten einen Kommentar des Vizechefredakteurs Günther Heidegger mit dem Titel „Gegen die Kapitulation" nach. Dort befasste sich dieser zwar nicht mit Sprache, wohl aber mit Tradition und Religion, genauer mit dem Adventskranz. Dieser sei vom Pult der Klassenzimmer verschwunden, weil er den Lehrpersonen nicht mehr wichtig sei „oder weil Hakim und Halime mittendrin sitzen und sich daran stören könnten" (Heidegger 2024).2.8 Gegen Sprachlosigkeit
Zum Abschluss noch ein wichtiger Satz aus dem Konzeptpapier „Mehrjähriges Konzept Sprache-Plus-Klasse":
„Dass Sprachkompetenz auch der Schlüssel für soziale Kontakte und Interaktion ist, versteht sich von selbst. Wir beobachten besorgt, dass Gewalt an Schulen zunimmt, wo die Sprachlosigkeit' die Bewältigung von Konflikten auf verbaler Ebene nicht erlaubt" (Mehrjähriges Konzept 2024).
3. Autonomie. Eine Rechts-RechtfertigungDie Rückgewinnung autonomer Befugnisse war im Jahr 2023 der Grund dafür, dass man sich zu einer Koalition zwischen SVP, Freiheitlichen, FdI, Lega und La Civica entschieden hatte. So wäre es in Rom einfacher, etwas zu erreichen, hieß es.
Das Schulthema wurde im Regierungsprogramm dieser neuen Koalition dreigeteilt weitergeschrieben, und es bleibt für die deutsche Schule bei den Grundsätzen des Artikel 19 und sieht keine bi- und plurilingualen Klassen vor, während solche an italienischen Schulen möglich sind. Dort steht:
„Mehrsprachige Projekte sollen verstärkt angewandt werden, um so die Erlernung der deutschen Sprache und einer weiteren Fremdsprache verstärkt zu vermitteln und zu fördern". Für das „paritätische Bildungsmodell" der ladinischen Schule steht „die Stärkung der ladinischen Muttersprache bei gleichzeitiger Umsetzung von speziellen Ansätzen zur integrierenden Mehrsprachendidaktik in den Unterrichts- und Fremdsprachen im Mittelpunkt". (Regierungsprogramm 2023, 31).
An erster Stelle werden im Regierungsprogramm die „Initiativen zur Wiederherstellung, Aktualisierung und zum Ausbau der Autonomie" genannt (Regierungsprogramm 2023, 8). Die angestrebte Rückgewinnung autonomer Befugnisse, mit der auch die Koalition gerechtfertigt worden war, hätte mit November 2024 abgeschlossen und von der Regierung verabschiedet sein sollen.
Kurz vor Torschluss allerdings meldeten sich die italienischen Koalitionspartner mit neuen Vorschlägen zu Wort. Im Dezember 2024, als dieser Beitrag verfasst wird, waren die Verhandlungen noch im Gang.4. Belastender TourismusDas Bauchgefühl zum Thema Tourismus ließe sich als Unbehagen oder gar Unmut beschreiben, ein Dauerbrenner im Tourismusland Südtirol. Auch in diesem Fall ist die Gesellschaft zweigeteilt in erfreute Tourismustreibende auf der einen und genervte Einheimische auf der anderen Seite, wobei sich letztere auch ungerecht behandelt fühlen. 2024 war der Begriff Overtourismus nicht mehr wegzudiskutieren. Die Bevölkerung reagierte empfindlich auf die gefühlte „Enteignung" beispielsweise auf Passstraßen, auf der Autobahn, auf Stadtzufahrten bei Regenwetter usw.
Nicht nur in Südtirol wurde dieser Dissens 2024 sichtbarer. In touristischen Hotspots wie Venedig wurde ein Stadteintritt eingeführt, in Hallein blockierten Einheimische mehrfach die Zufahrt, auf Mallorca gingen Ende Mai 25.000 Mallorqui- ner/-innen gegen das Zuviel auf die Straße, eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen namens Mallorca Platja Tour rief die Einheimischen dazu auf, als Zeichen des Protests gegen den anhaltenden Massentourismus jedes Wochenende einen beliebten Strand zu besetzten und ihn so unattraktiver zu machen. In Madrid wurde gegen illegale Kurzzeitappartements mobilisiert, die dem Wohnungsmarkt entzogen werden, und in Barcelona kündigte Bürgermeister Jaume Collboni an, dass die derzeitigen Lizenzen für Ferienappartements in der Stadt bis spätestens 2028 auslaufen und nicht erneuert werden sollen (vgl. Müller 2024).
Auch in Südtirol wuchs der Appartement-Markt 2024 stark an, indirekt gefördert dadurch, dass die Immobiliensteuer für touristische Vermietungen geringer war als jene für Normalvermietungen. In der von Wohnungsnot gebeutelten Landeshauptstadt lag sie z. B. bei 0,56 Prozent, während jene für reguläre Vermietungen an Ansässige bei 0,9 Prozent lag. Bauernhöfe entstanden teils neu, um den noch weniger besteuerten Urlaub auf dem Bauernhof anbieten zu können, und der Mietmarkt für die Bevölkerung schrumpfte oder wurde unbezahlbar.
In Südtirol machten Sticker-Aktionen auf die Belastung aufmerksam. Eine weist auf Südtirols „9 Mio. Tourists" hin, eine andere zeigt sich mit „Tourists go home"- Schriften auf den Felsen der Dolomiten. Daneben gab es auch Initiativen und Aktionen mit konkreten Vorschlägen, beispielsweise zum Thema Mobilität.4.1 Die Gästekarte
Die Landesregierung hatte 2022 mit eigenem Beschluss die sogenannte Gästekarte eingeführt. Damit sollte die Mobilität der Gäste auf öffentliche Verkehrsmittel umgeleitet werden. Das wiederum hatte zur Folge, dass immer mehr Verkehrsmittel überfüllt waren und Einheimische auf der Strecke blieben. Die Politik hatte es offensichtlich gut gemeint und schlecht getroffen.
In der Bevölkerung machte sich Unmut darüber breit, dass es nicht mehr möglich war, mit dem Bus mitzufahren, für den man bezahlt hatte oder in die Seilbahn zu steigen, für die man ebenfalls gründlich bezahlt hatte, weil gratis fahrende Touristen und Touristinnen alles verstopften.
Dass die Gäste nichts bezahlten, trifft zwar nicht zu, sie zahlten indirekt eine Kleinigkeit, aber ihnen wurde das Gefühl vermittelt, alles sei gratis. Ihre Gästekarte bekamen sie an der Rezeption ausgehändigt, ohne dass sie dafür Geld in die Hand nehmen mussten. Freie Fahrt für das Bauchgefühl also. Die Gäste nahmen das Angebot als Gratisangebot wahr und nutzten die kostenlose Gelegenheit, indem sie mehr herumfuhren als sie es gemacht hätten, wenn sie für die Fahrten hätten bezahlen müssen. Einheimische waren verärgert, weil sie gezwungen waren, als Zahlende und Arbeitende den Gratis-Fahrenden Platz zu machen.
Wer sich auch noch die Mühe nahm, nachzusehen, was die Gästekarte zusätzlich im Angebot hatte, war endgültig enttäuscht. Denn je nach Ausgabeort bot diese Karte die Möglichkeit, Schwimmbäder gratis zu nutzen, Ermäßigungen bei Kulturveranstaltungen zu bekommen, die mit lokalen Steuergeldern finanziert sind, die Angebote der Tourismusvereine kostenlos in Anspruch zu nehmen und alle Museen im Land gratis zu besuchen. Letzteres stellte sich aber als so unrentabel heraus, dass das Angebot von den Museen für 2025 aufgekündigt wurde. Was bisher in den Sand gesetzt worden ist, muss von Steuergeldern ausgeglichen werden (RAI Südtirol 2024b).
„Make Tourists pay" nennt sich eine Aktionsgruppe, die im Herbst 2024 entstand und forderte, dass Gäste für ihre Fortbewegung im Land bezahlen sollen. „Make Tourists Pay" sei eine „Gerechtigkeitsbewegung" sagte Sprecher Moritz Holzinger. „Wir fordern die Landesregierung auf, eine Mobilitätsabgabe von zwei Euro pro Tourist pro Nächtigung einzuführen. Wir sind ein Hochpreisland: Daher können die Touristen diese Abgabe von zwei Euro sicher verkraften." Und weiter: „Mit dem neuen System könnten dann Einheimische und Touristen die Öffis kostenlos nutzen, was wirklich eine Motivation wäre, das Auto stehenzulassen." Das könnte auch „die Tourismusgesinnung verbessern" (NST 2024). Ob dieser Vorschlag Gehör finden wird, ist noch offen.
Etwas konkreter ist inzwischen das, was eine Initiativgruppe von Bürgerinnen und Bürgern im August 2023 angeregt hatte. Damals war eine Unterschriftenaktion gestartet worden, mit der bei der Rittner Seilbahn die Einrichtung einer Vorzugsspur für Südtirol-Abo/Südtirolpass nach dem Beispiel Venedigs angeregt wurde. Ende 2024 wurde diese operativ.4.2 Saisonsarbeitende
Dass es in der saisonfreien Zeit dazu kommt, dass im Tourismus Arbeitende zwischenzeitlich zu Obdachlosen werden, ist eine „Randerscheinung", die wenig Beachtung findet und nur vorübergehend zur Sprache kommt, wenn wieder einmal von Räumungen die Rede ist, mit denen vor allem in Bozen zyklisch „bereinigt" wird. Das bedeutet dann, dass die Polizei illegale Ansiedlungen unter Brücken wegputzt. Unter den „Weggeputzten" könnten auch Saisonsarbeitende sein (vgl. ORF Südtirol heute 2024).
5. Und die Frauen5.1 Im Landtag
2024 jährte sich zum 60. Mal ein Ereignis, das fast unbeachtet vorbeigezogen wäre, hätten nicht Frauenarchiv und Eurac Research darauf aufmerksam gemacht. Am 15. November 1964 waren nämlich die ersten zwei Frauen in den Landtag gewählt worden. Bis dahin hatten dort ausschließlich Männer gesessen. Heute kommen auf 35 Abgeordnete ganze zehn Frauen, weniger als ein Drittel also.
Anlässlich des Jubiläums hatten das Center for Autonomy Experience, Eurac Research, das Frauenarchiv Bozen, der Südtiroler Landtag und der Landesbeirat für Chancengleichheit pünktlich am 15. November zur Tagung „60 Jahre Frauenpräsenz im Südtiroler Landtag 1964-2024" geladen. Im Mittelpunkt standen die ersten zwei Abgeordneten Waltraud Gebert (SVP) und Lidia Menapace (DC). Die Veranstaltung richtete sich am Vormittag an Schülerinnen und Schüler, die mit großem Interesse dabei waren, am späten Nachmittag konnten Interessierte kommen. Diese waren weniger intensiv dabei, nicht einmal alle Landtagsfrauen waren zu sehen.5.2 Das Gendern oder geschlechtergerechte Sprache
Frauen sollen auch 2025 in der Südtiroler Politik eine Rolle spielen. Im Mai gibt es in fast in allen Südtiroler Gemeinden Wahlen, und die Vorrunden zum Wahlkampf sind eröffnet. Weichenstellungen erfolgen bereits im Vorfeld. Einerseits suchen die Parteien nach möglichen Kandidatinnen, andererseits ist es immer wieder der Fall, dass unterschwellig und wohl unbeabsichtigt Emotionen angesprochen werden, die der Sache nicht nutzen. So ist beispielsweise von Bürgermeisterwahlen die Rede, was selbstredend suggeriert, dass ein Bürgermeister eigentlich ein Mann zu sein hätte, auch im öffentlichen Rundfunk. Das passt ironischerweise sehr gut in ein Land wie Italien, wo sich die Ministerpräsidentin explizit als „il Presidente" anreden lässt.
Dass Medien in Südtirol nicht besonders aufmerksam mit der Thematik umgehen, hat sicher auch mit Eile zu tun, kann aber nur schade genannt werden. Dabei böte die Landesverwaltung online Handreichungen für eine gendergerechte und trotzdem flüssige Sprachgestaltung (Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz 2010; Richtlinien 2021, Art. 8).Als in Bayern mit 1. April 2024 ein Genderverbot in Kraft trat, wurde das Thema auch in Südtirol aufgegriffen.
Die Allgemeine Geschäftsordnung der Bayerischen Staatskanzlei deklarierte mit 1. April 2024 „geschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gender-Gap oder Mediopunkt sind nun ausdrücklich [als] unzulässig". Das gelte unabhängig von etwaigen künftigen Entscheidungen des Rates für deutsche Rechtschreibung zu der Frage der Verwendung von Sonderzeichen. „Ministerpräsident Markus Söder habe es schon beim politischen Aschermittwoch der CSU im Februar dieses Jahres angekündigt: ,Wir machen ein Genderverbot! So einen Unsinn gibt es bei uns nicht!'", erinnerte BR24 am 17. November 2024 in einem Rückblick über „Sechs Monate ,Genderverbot'" (BR24 2024).
In Südtirol nahm der rechte Landtagsabgeordnete Jürgen Wirth Anderlan gemeinsam mit seinem inzwischen Ex-Parteikollegen Andreas Colli die Entscheidung aus Bayern flugs zum Anlass, um Ähnliches auch für Südtirol zu fordern. Er legte dem Landtag einen entsprechenden Beschlussantrag vor und schrieb am 22. Januar auf der Parteiseite:„Schützen wir unsere Muttersprache vor dieser Vergewaltigung!', unterstreicht der JWA-Abgeordnete Jürgen Wirth Anderlan die Forderung. Bürger_innenmeister_innen, Zufußgehende, Professix... die deutsche Sprache wird angegriffen. Das sogenannte „Gendern" ist eine ideologisch motivierte Sprachnormierung. Diese hat auch Eingang in die Bildungseinrichtungen sowie die Verwaltung gefunden. Gegen den Willen des Volkes" (JWA 2024).
SVP Fraktionssprecher Harald Stauder hielt sich in der Debatte eher bedeckt, berichtete die Neue Südtiroler Tageszeitung. „Wir sollten den Leuten nicht vorschreiben, wie sie zu schreiben und zu reden haben, aber man kann ihnen durchaus nahelegen, wie man es machen könnte, um Verständlichkeit und Lesbarkeit zu gewährleisten". Ideologische Zugänge seien abzulehnen, betonten Stauder und Waltraud Deeg. Er selbst denke im alltäglichen Gebrauch nicht viel darüber nach, sagte Stauder. Und Deeg meinte, sie sehe „im täglichen Leben einer Frau und anderer Zielgruppen noch ganz andere Herausforderungen zu bewältigen" (Fresenius 2024).
Waltraud Deegs Mutter, Waltraud Gebert Deeg, hatte noch als „Der Landesrat" unterzeichnet, anderes stand damals aber gar nicht zur Debatte. Dass aber heute „der Bürgermeister" ein anderes Bild weckt als „die Bürgermeisterin", ist ebenso klar. Da spielt der Bauch eine entscheidende Rolle, und dieser kann wahlentscheidend sein, wie Frank Patalong vor inzwischen fast zehn Jahren im Magazin Der Spiegel unter dem Titel „Politiker: Mehr Erfolg mit dunkler Stimme" berichtete. Er schrieb:„Politische Qualifikation ist bei der Wahlentscheidung offenbar zweitrangig. Laut einer Studie lassen sich Wähler stark vom Erbe der Steinzeitmenschen beeinflussen: Sie machen die zu Anführern, die am tiefsten brummen. [...] Gewählt wird am Ende, wem die Mehrheit schlicht das meiste zutraut. Und dabei spielen Signale eine wichtige Rolle, die mit sachlicher Kompetenz gar nichts zu tun haben" (Patalong 2015).
Damit wären wir wieder dort, wo wir angefangen haben, beim Bauch. 2012 hatte eine Forschergruppe um Casey Klofstad von der Universität Miami mit Kollegen von der Duke University nachgewiesen, dass „Steinzeit-Instinkte" folgenden „Idealpolitiker" generieren „50, männlich, Bariton" (vgl. Patalong 2015). Bei weiblichen Kandidatinnen falle das Kriterium der dunklen Stimme noch mehr ins Gewicht. Wenn dann vor Wahlen auch noch überall von einer Bürgermeisterwahl die Rede ist, wird es für Frauen besonders schwer, und es wird fast schon verständlich, dass sie keine Lust mehr auf den Job haben - auch eine Bauchentscheidung, die aber zumindest schade ist.
6. Beben im DezemberEs war der 3. Dezember, als die Staatsanwaltschaft von Trient eine groß angelegte Aktion startete, bei der in Südtirol und im Trentino Hausdurchsuchungen durchgeführt und Verhaftungen vorgenommen wurden. Betroffen waren Personen, die beschuldigt wurden, dem Benko-Signa-Imperium anzugehören und auf die eine oder andere Art unlautere Geschäfte betrieben zu haben. Die Aufregung war groß, die öffentliche Entrüstung auch - wieder Gefühle also, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite und selbstverständlich viel Stoff für Stammtischgespräche und politische Vereinnahmungen.
Derzeit gilt für alle Betroffenen die Unschuldsvermutung, und was letztlich herauskommen wird, ist vollkommen offen. Interessant waren die Auswirkungen der Meloni-Regierung auf diesen Fall, denn die Anklagen gegen zwei Politiker wurden Dank der Nordio-Reform sofort archiviert. Diese ist Teil der Justizreform und hatte im Sommer den Tatbestand des Amtsmissbrauchs abgeschafft (Van Greven 2024).Literaturverzeichnis: Siehe POLITIKA 2025
Weitere Artikel zum Thema
Culture | NeuerscheinungPolitisches Jahrbuch
Books | Salto WeekendPolitika
Society | SALTO Gespräch„Schule ist mehr als Sprachkompetenz“
ACHTUNG!
Meinungsvielfalt in Gefahr!
Wenn wir die Anforderungen der Medienförderung akzeptieren würden, könntest du die Kommentare ohne
Registrierung nicht sehen.



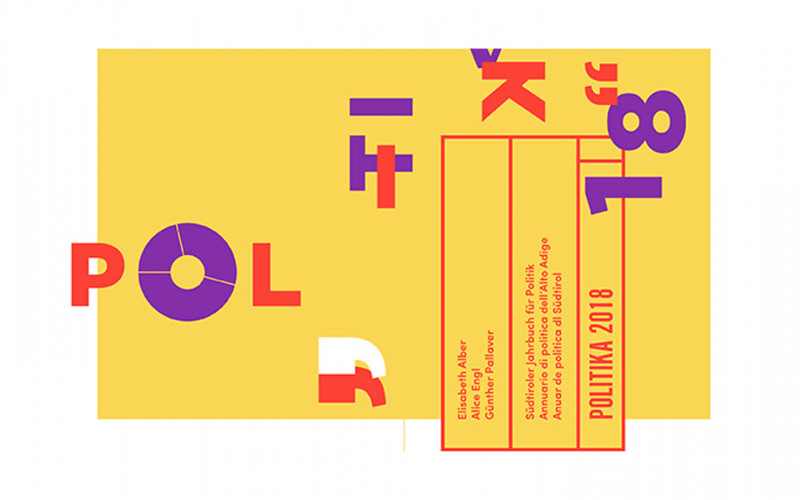

Grazie, Renate Mumelter, per…
Grazie, Renate Mumelter, per averci messo a disposizione l'estratto ed il compendio dell'annuario 2025 della rivista Politika! Un grande e bel lavoro.