Gemeinsam einzigartig

-
Ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung, Übergewicht, übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen: Es ist bekannt, dass der Lebensstil eines Menschen als eine der Hauptursachen für das Auftreten von Krebserkrankungen gilt. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und zu informieren, findet nunmehr seit 25 Jahren der Weltkrebstag statt, der jährlich am vierten Februar begangen wird. Das Motto 2025 lautet „United by Unique“ zu Deutsch „Gemeinsam einzigartig“. Mit diesem Motto soll betont werden, dass hinter jeder Krebsdiagnose ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte steht. Zwar sind die Betroffenen durch die Diagnose verbunden, trotzdem hat aber jeder Einzelne eine eigene Geschichte und eigene Bedürfnisse.
-
Der Mensch im Mittelpunkt
Im Rahmen einer Pressekonferenz informierte die Südtiroler Krebshilfe heute über die Krankheit und teilte dabei einige interessante Fakten mit. Der Fokus lag dabei auf dem Individuum und der Zusammenarbeit zwischen Onkologen und Psycho-Onkologen.
Zu Beginn hob die Präsidentin der Südtiroler Krebshilfe, Maria Claudia Bertagnolli, die Wichtigkeit eines modernen, menschenzentrierten Ansatzes in der Krebsvorsorge hervor. Sie betonte, dass die moderne Krebsversorgung darauf abziele, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und sich nicht nur auf die Behandlung der Krankheit konzentriere. So könne die Einzigartigkeit jeder Person berücksichtigt und der oder die Betroffene aktiv in die Therapieentscheidungen einbezogen werden.
Im Anschluss erklärten Luca Tondulli, Primar der Onkologie am Krankenhaus Bozen und Brigitte Greif, Psychoonkologin beim Psychologischen Dienst Krankenhaus Meran, wie wichtig die Zusammenarbeit ihrer beiden Bereiche ist. „Die Krebsdiagnose kann eine starke Belastung sein, sowohl für die kranke Person selbst, als auch das nähere Umfeld“, so Greif. Dieser anfängliche Schockzustand sei oft von Emotionen wie Angst, Trauer und Wut, aber auch Ungewissheit geprägt. Des Weiteren käme es auch zu existenziellen Krisen, wie der Frage nach dem Sinn des Lebens sowie finanzielle Sorgen. Sie erklärte zudem, dass Angehörigen die Situation fast im gleichen Maße zu schaffen mache, da es bei ihnen ebenfalls zu Ungewissheit und Sorgen komme. Um hier zu helfen, setzt die Psycho-Onkologie bei der sogenannten Resilienz an. „Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen, mit Stress umzugehen und sich an veränderte Lebensumstände anzupassen“, erläuterte Greif. Bei einer Krebserkrankung bedeute dies, dass Betroffene und ihre Familien lernen, mit der Diagnose und den damit verbundenen Herausforderungen und Folgen umzugehen und Stärke aus dieser Zeit zu ziehen. Erreicht werden könne dies durch eine offene Kommunikation, emotionale Unterstützung und die Aktivierung von Ressourcen. „Es ist wichtig, dass jede Familie die notwendige Unterstützung erhält“, meint die Psycho-Onkologin.„Dies umfasst die Erfüllung der körperlichen, psychologischen, sozialen, beruflichen und emotionalen Bedürfnisse der Betroffenen.“
Auch Primar Tondulli hob die Wichtigkeit hervor, nicht nur die Krankheit zu berücksichtigen, sondern auch ein Augenmerk auf die sozialen und psychischen Auswirkungen von Krebs zu legen. Er erläuterte, dass die von der Krebsdiagnose hervorgerufenen Emotionen oft so intensiv sind, dass sie die Gelassenheit der Menschen beeinträchtigen und oft ihre Fähigkeit, sich anderen zuzuwenden. Dies könne sogar die Motivation, den Therapieweg zu gehen, hemmen. Die Behandlung von Krebspatienten müsse deshalb nicht nur darauf ausgerichtet sein, ihre Überlebenschancen zu erhöhen, sondern auch die notwendigen Ressourcen zur Verbesserung ihrer Lebensqualität bereitzustellen und die physischen und psychischen Folgen der Krankheit zu mindern. Was wiederum eine Zusammenarbeit zwischen Onkologen und Psycho-Onkologen unabdingbar mache. „Durch die Zusammenarbeit können wir das Empowerment des Patienten fördern, ihre Mitsprache bei Therapieentscheidungen während aller Stadien der Krankheit unterstützen und die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern. Dies umfasst die Erfüllung der körperlichen, psychologischen, sozialen, beruflichen und emotionalen Bedürfnisse der Betroffenen“, erklärte Tondulli. Diese ganzheitliche Herangehensweise stelle sicher, dass nicht nur die Krankheit, sondern der Mensch in seiner Gesamtheit betrachtet wird, um eine bestmögliche Lebensqualität während und nach der Behandlung zu gewährleisten.
-
Südtirol in Zahlen
Am Ende der Konferenz informierte Guido Mazzoleni, Volontär beim Tumorregister Südtirol und Präsident des Ärztebeirates der Südtiroler Krebshilfe, noch über einige Daten und Fakten zu Krebs in Südtirol: „Vergleicht man Südtirol mit dem Rest Italiens, so schneidet die Provinz laut der PASSI Studie 2022-2023 bei den wichtigsten Risikofaktoren sehr gut ab. Eine wichtige Ausnahme gibt es allerdings: den Alkoholkonsum“, so Mazzoleni. Er wies darauf hin, dass in Südtirol im Fünf-Jahresabschnitt (2017-2021), ohne die Berücksichtigung von Hautkrebs durchschnittlich 3.038 neue Tumorfälle pro Jahr registriert wurden, davon 1.669 bei Männern und 1.369 bei Frauen. Auf Grundlage der Bevölkerungsstruktur von 2024 werden somit rund 1.800 neue Fälle bei den Männern und 1.400 bei den Frauen erwartet, so Mazzoleni weiter.
„Die Teilnahme an den kostenlosen Screening-Programmen in Südtirol ist ein wichtiger und effektiver Weg.“
Im Zeitraum 2017-2021 war der Prostatakrebs der häufigste Tumor bei Männern (25 Prozent aller Fälle im Vergleich zu einer nationalen Schätzung von 19 Prozent), gefolgt vom Dickdarmkrebs (10 Prozent gegenüber 15 Prozent), der Harnblase (10 Prozent gegen 13 Prozent) und Lunge (9 Prozent gegen 12 Prozent). Frauen erkrankten hauptsächlich an Brustkrebs (29 Prozent, im restlichen Italien 30 Prozent), gefolgt von Dickdarm- und Lungenkrebs (10 Prozent gegenüber 12 Prozent) (8 Prozent gegenüber 7 Prozent). „Insgesamt zeigt die zeitliche Entwicklung der beobachteten Werte im Fünfjahreszeitraum 2017-2021 eine wesentliche Stabilität des Trends bei den beiden Geschlechtern, auch wenn die Zahl der Fälle zunimmt“, so Mazzoleni. Dies führt der Experte auch auf den demografischen Wandel der Gesellschaft zurück, denn je älter ein Mensch wird, desto höher ist das Risiko auf eine Tumorerkrankung. In Südtirol starben zwischen 2019 und 2023 durchschnittlich 1.195 Personen jährlich an Krebs. Davon waren 646 Personen männlich und 549 weiblich.
Was die Früherkennungsprogramme wie den Pap-Test angeht, sieht Mazzoleni noch Potenzial. „Die Teilnahme an den kostenlosen Screening-Programmen in Südtirol ist ein wichtiger und effektiver Weg, um Krebserkrankungen frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln“, betonte der Präsident abschließend. -


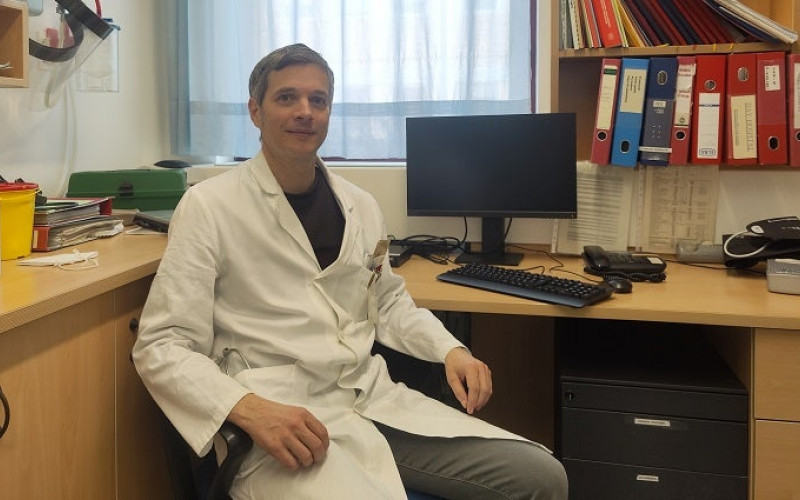
Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.