Ein Buch mit Folgen

-
1
Im Deutschen ist der Ausdruck Stiefmuttersprache durch die Kontrastsituation zu Muttersprache einerseits und zu Stiefmutter andererseits so einleuchtend, dass der Neologismus ohne große Anstregung jederzeit neu erfunden/gefunden werden kann. So schreibt die Schriftstellerin Olga Grjasnowa über ihr Verhältnis zur deutschen Sprache: „Womöglich ist das Deutsche meine Stiefmuttersprache, wobei das Bashing der Stiefmutter auch nicht mehr zeitgemäß ist.“ Um den Titel von Gabriele Di Lucas Lingue matrigne zu verstehen, müssen wir uns vom Deutschen ganz lösen und in das von Metaphern dominierte Italienisch eintauchen; und wir erkennen dabei, dass die Metapher der Stiefmüttersprachen, den Kern der sprachlichen Situation in Südtirol tatsächlich treffend ausdrückt. Aber ich kann es nur auf Italienisch denken. Um die negativen Konnotationen in die deutsche Paraphrase zu bringen, kann mir aber eine idiomatische Redewendung helfen: Mit der Muttersprache ist kein Staat zu machen.
So klar hat das noch nie jemand gesagt, und erst recht kein italienischer Autor. Alles, was Di Luca in seinem brillanten Buch schreibt, ist wahr.
Die Entwertung der deutschen Standardsprache – wenn wir den sprachwissenschaftlichen Fachausdruck verwenden wollen – ist der Kern der Lüge über die Südtiroler Mehrsprachigkeit. Sie ist das große Tabu unserer Gesellschaft, das Politikerkarrieren beflügelt und Mittelschicht-Eltern in Sorge um die Zukunft ihrer Kinder grämen lässt.
So klar hat das noch nie jemand gesagt, und erst recht kein italienischer Autor. Alles, was Gabriele in seinem brillanten Buch schreibt, ist wahr. Ich habe es mitgelebt, wie viele andere kritische Beobachter auch. Ich habe die Lüge schon vor vierzig Jahren durchschaut und habe 1986 meinem Vortrag auf der Bozener Tagung Tradurre/Übersetzen den ironisch-polemischen Titel gegeben: „Die Verantwortung für das Wort“. 1998 begann ich an der neugegründeten Universität in Brixen das Fach „Deutsche Sprache“ zu unterrichten. Ich bin also Zeitzeuge der Entwicklung, von der Di Luca schreibt. Es gibt aber einen Unterschied zwischen uns. Ich habe damals geschwiegen. Und ich kann nicht sagen, mir hätten die Worte gefehlt. Ich habe nicht „die Worte nicht gefunden“, die Wahrheit ist: Ich habe nicht nach den Worten gesucht.
Ich habe nicht „die Worte nicht gefunden“, die Wahrheit ist: Ich habe nicht nach den Worten gesucht.
Meine Texte von damals waren voller Hoffnung und Zuversicht im Vertrauen auf die Wirkungskraft der neugegründeten dreisprachigen Universität, die zum Symbol und zum Anstoß für ein Neues Südtirol werden sollte. Dass sie das nicht geworden ist, genauso wie die neue Stadt- und Landesbibliothek nicht realisiert wurde, ist der Nährboden, auf dem die Lüge vom mehrsprachigen Südtirol weiter gedeiht.
Mein Versuch, vor 20 Jahren die Sprachentrennung an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen zu überwinden, ist gescheitert. Ich hatte die Reform vielleicht auch nur angedacht und kein Feuer der Begierde und des Widerstands entfacht. Und als Ergebnis der erfolgreichen sprachlichen Trennung der Studiengänge in Brixen werden heute die Entscheidungen zum Unterricht an den Schulen in Südtirol im Fakultätsrat auf Englisch diskutiert. Von Teilnehmern, für die Englisch nicht die Erstsprache ist. Die dreisprachige Universität Bozen. Aber ist die „dritte“ Sprache der Universität nicht, wie die Aufschriften an den Wänden bezeugen, das Ladinische?
Im deutschsprachigen Studiengang gab es damals viele Studentinnen, die erstaunliche Mängel in ihrer Deutschkompetenz aufwiesen. Dies führte jedoch nicht zu einem innovativen Bildungsauftrag, sondern zu Konflikten mit den Institutionen. Ich habe zu all dem geschwiegen, selbst dort, wo es notwendig gewesen wäre, zu sprechen.
Das Buch von Gabriele war längst überfällig.
Für die Leser, die Gabriele Di Luca aus seinen italienischen Texten kennen, hält das Buch eine Überraschung bereit. Das letzte Kapitel, L’Algoritmo e l’altro. Il bilinguismo e l’intelligenza artificiale. Es ist eine profunde Analyse der Probleme, ohne Firlefanz aus der Sicht der Menschen geschrieben, die davon betroffen sind. Das sind wir, unsere Kinder und Enkelkinder, wenn wir soweit vorausdenken wollen. Die ersten Zeichen sind bereits zu sehen, in den Ankündigungen der YouTube-Koryphäen, die sich mit Meldungen überschlagen, das Erlernen von Fremdsprachen sei mit den neuen „KI-Assistenten“ zu einem Kinderspiel geworden, laut kreischend verkündet, auch aus Angst, von anderen übertönt zu werden, die verkünden, das Erlernen von Fremdsprachen sei überflüssig geworden, weil die neuen KI-Brillen und andere gadgets Simultanübersetzngen in beide Richtungen ermöglichen.
-
So wichtig das Buch von Gabriele Di Luca als Bestandsaufnahme der Vergangenheit auch ist, sein größter Wert besteht darin, dass es ein Aufruf für die Zukunft ist. Leben wir denn nicht alle länger als es die Statistiken bei unserer Geburt voraussehen hätten lassen? Was tun mit dieser gewonnenen Zeit? Zwanzig Jahre im Durchschnitt. Könnten wir nicht versuchen, einen Beitrag zu leisten, indem wir dem Versagen, das Di Luca diagnostiziert, entgegentreten?
Dem schleichenden Verfall der Sprachkompetenz kann man wirkungsvoll begegnen. In der Wissenschaft ist das Phänomen unter dem Fachterminus sprachliches „Plateau“ bekannt und wird genau mit den Worten beschrieben, die auch Gabriele di Luca verwendet: „Sussurriamo al nostro orecchio interiore: dài, va bene così, di più non puoi fare, tanto quello che sai ti basta e avanza“. (S. 25). Die Plateau-Kompetenz ist der Zustand, der erreicht wird, nachdem die Lernenden mit dem Lernen aufgehört haben.
„Lingue matrigne“ ist ein Aufruf, mit dem Lernen nie aufzuhören.
-
2
Gabriele Di Lucas Buch ist ein Bericht über die vernachlässigte Aufrichtigkeit im öffentlichen Leben in Südtirol. Das Vernachlässigen bricht oder schleift mit der Zeit kleine Teile der Redlichkeit ab, bis am Ende die Lüge erscheint. An diesem Punkt ergreift Gabriele Di Luca das Wort, oder das Wort ergreift ihn, wie wir mit Karl Kraus sagen könnten, es ist das Wort, das ihn ergreift, ihn zum Sprechen zwingt. Vom Leitartikel zum umfassenden Traktat.
Das Buch ist ein großer Wurf, sodass ich es hier wie einen Klassiker betrachte und gleichsam mit den Augen des Philologen aus der Zukunft auf es zurückblicke. Wie war das, wovon der Autor da schreibt? Auf Seite 13 des Vorworts lese ich: „È possibile raccontare qualcosa di denso e specifico sapendo che da lontano apparirà indecifrabile e da vicino scontato? L’asimmetria è totale: da un lato il vuoto dell’ignoranza, dall’altro il sovraccarico di interpretazioni.“
So viel Inhalt bei so wenigen Worten, und kunstvoll als Chiasmus gebaut.
Das Buch ist ein großer Wurf, sodass ich es hier wie einen Klassiker betrachte und gleichsam mit den Augen des Philologen aus der Zukunft auf es zurückblicke.
Ist es möglich, etwas Dichtes und Spezifisches zu erzählen, im Wissen, dass es aus der Ferne unentschlüsselbar und aus der Nähe als selbstverständlich erscheinen wird? Die Asymmetrie ist vollkommen: auf der einen Seite die Leere der Unwissenheit, auf der anderen das Übermaß an Deutungen.
Als Parallelismus verstanden, ABAB, wird die unentschlüsselbar scheinende Ferne zur Leere der Unwissenheit gestellt, wohl nach dem Motto: Wer weit entfent ist, weiß wenig. Und wer nahe dran ist, hat es mit einem Übermaß an Deutungen zu tun. Darin sind sich auch die Analysen der bedeutendsten Vertreter der KI einig, Chat GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5.
Wie sollte es auch anders sein? Mit den Parametern des Verstehens von unzähligen Lesern versehen, die in kondensierter Form ChatGPT zu seinen Antworten verhelfen, kann der Text nur so verstanden werden, wie die Vielen ihn verstanden haben, als banal und nichtssagend; die lectio difficilior der Lektüre als Chiasmus ist für die KI unerreichbar.
Als Chiasmus gedeutet kommt es zur umgekehrten Verteilung der Merkmale: ABBA. Zur Ferne gehört das Übermaß an Deutungen – im ‚indecifrabile‘ stecken die vergeblichen Versuche des Verstehens durch Interpretation. Zur Nähe, der alles selbstverständlich erscheint, gehört die Ignoranz.
Nachdem wir die Anstrengung des Lesens gemeistert haben, folgen die Anstrengungen des Handelns. Was sagt mir das, was ich verstanden habe? Was muss ich als Konsequenz dessen tun, was der Text mir sagt?
„Lingue matrigne“ ist ein Aufruf, mit dem Denken nie aufzuhören.
-
Buch & Buchvorstellungen
In Südtirol wird die Mehrsprachigkeit oft als vorbildliches Beispiel des Zusammenlebens gefeiert, doch dabei handelt es sich um eine institutionelle, beruhigende Rhetorik, um eine reine Fassade, hinter der latente Spannungen, normative Machtstrukturen und Heucheleien eines Landes verborgen liegen, das noch immer von tiefen Bruchlinien durchzogen ist. Zwischen autobiografischem Exkurs und kritischer Analyse, bietet der Essay von Gabriele Di Luca ein klarblickendes und provokantes Porträt unser Grenzregion, das einen ihrer „gründenden Mythen“ dekonstruiert.
Das Buch wird morgen, am 8. November um 18 Uhr in der Ubik-Buchhandlung in Bozen im Gespräch mit Alex Marcolla präsentiert und am 13. November um 18 Uhr in der Akademie deutsch-italienischer Studien in Meran mit Madeleine Rohrer.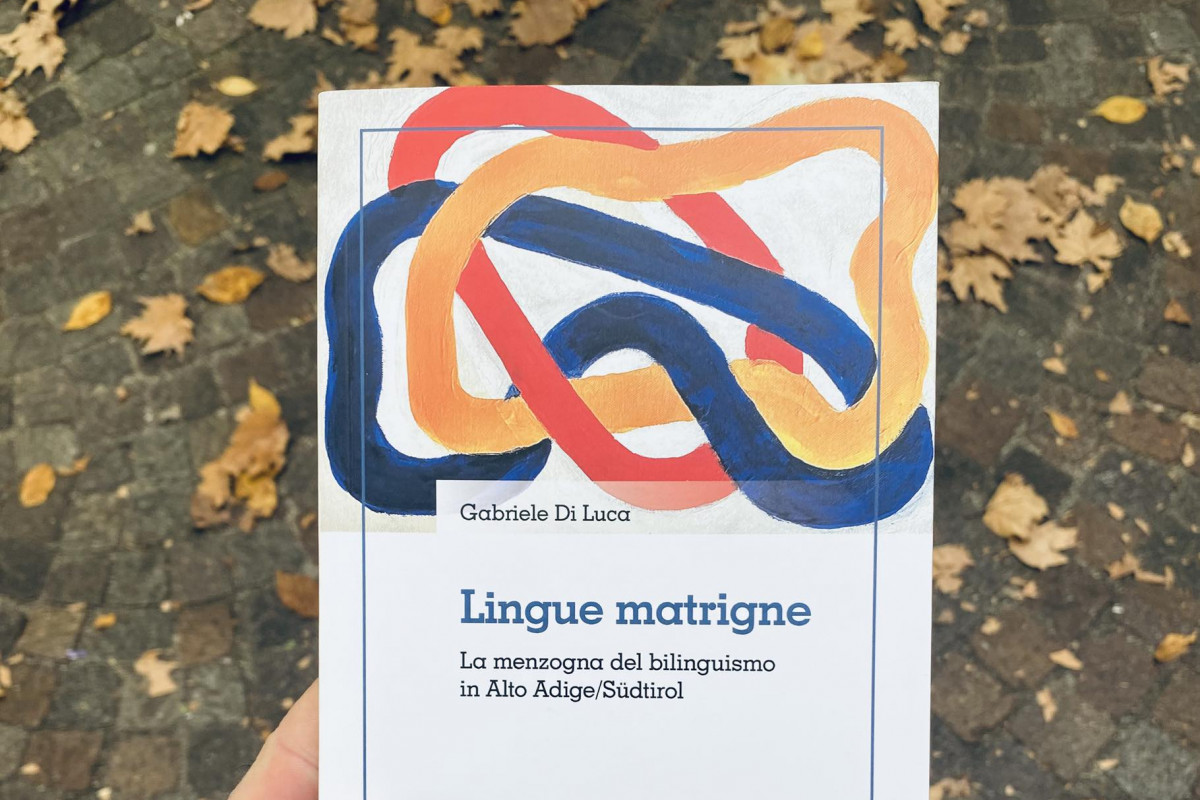 Foto: Federico Zappini
Foto: Federico Zappini -

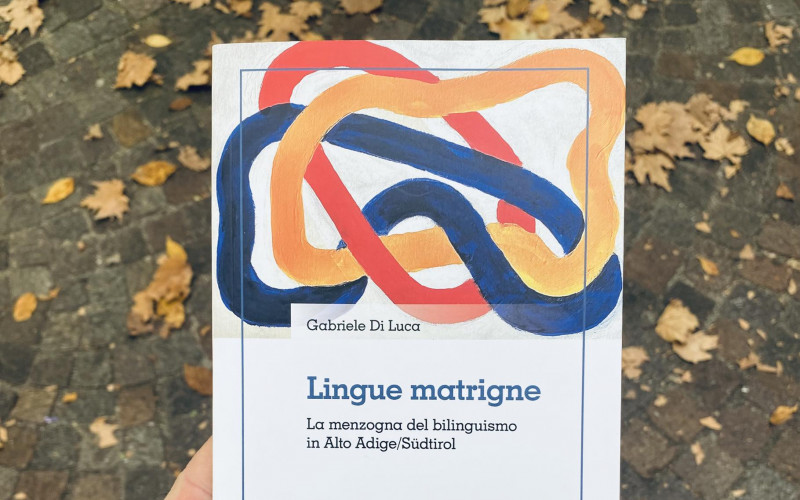
Schon wieder dieses Buch…
Schon wieder dieses Buch. Ist das PR? Dann bitte kennzeichnen!
Antwort auf Schon wieder dieses Buch… von Lollo Rosso
Vielleicht liegt es einfach…
Vielleicht liegt es einfach daran, dass es ein ganz offensichtliches Interesse an den in diesem Buch vertieften Themen gibt … was, unter anderem, aus der großen Nachfrage nach dem Buch zu schließen ist.
Antwort auf Schon wieder dieses Buch… von Lollo Rosso
Laut dem Autor liegt die…
Laut dem Autor liegt die Schuld für die mangelnde Integration der Südtiroler im Südtiroler Dialekt. Daher würde die Abschaffung des Dialekts eine bessere Integration ermöglichen. Eine einheitliche zweisprachige Schule für alle sollte dazu beitragen, den Dialekt aus dem Alltag der Kinder zu verbannen.
Interessanterweise bereiten die Dialekte der ladinischen Täler jedoch keine derartigen Probleme.
In Südtirol wird die…
In Südtirol wird die Mehrsprachigkeit oft als vorbildliches Beispiel des Zusammenlebens gefeiert,
Dass in Südtirol mehr Sprachen zusammen leben ist Tatsache.
Man kann es feiern oder trauern.
Aber das als Lüge zu bezeichnen bedeutet in böser Absicht zu handeln.
Großartiger Beitrag!
Großartiger Beitrag!
Bin schon etwas verblüfft ob…
Bin schon etwas verblüfft ob der Zelebrierung des einen Abschnitts. Einen Chiasmus zu lesen ist weder schwierig noch etwas Besonderes, und ehrlich gesagt hab ich mich schon bisschen viel daran gestoßen dass der Buchautor die hiesigen LeserInnen als ignorant klassifiziert.
Herr Drumbl - ein GPT funktioniert nicht so wie sie es darstellen. Die „Parameter des Verstehens“ sind keine. Das Einzige, was in kondensierter Form gefeedbackt wird, ist eine (insgesamte, nicht Wort- oder Satz- bezogene) Bewertung darüber ob der von dem digitalen Plapperpapagei generierte Text den Erwartungen des Fragestellers entspricht.
Nur die Hersteller selbst und ihre Investoren - die ein Interesse daran haben der ganzen Welt glauben zu lassen wir hätten hier eine Maschine die etwas verstehen kann - würden dieses banale Feedback als Textverständnis bezeichnen.
Antwort auf Bin schon etwas verblüfft ob… von Christoph Moar
In Ihrem RAI-Interview haben…
In Ihrem RAI-Interview haben Sie anders über die LLMs gesprochen. Das ist nicht der Ort, um die Diskussion darüber zu vertiefen. Ich habe nur erwähnt, aus welchen Quellen diese Programme gelernt haben. Warum bluffen Sie bei Ihrer Kompetenz? Sie brauchen hier niemandem zu imponieren. Haben Sie die Kompetenz, zu beurteilen, was auf der Ebene der Textualität als banal zu gelten hat?
... fehlende Kompetenz?…
... fehlende Kompetenz? Haben wir Sprechende nicht ALLE eine Meinung? Wird hier einmal mehr ein Thema genutzt um uns alteingesessene Bewohner zurechtzuweisen?
Zu erinnern wäre an weitere Regionen mit ähnlicher Sprachenvielfalt wie u. A. Sardinien, Graubünden, Luxemburg, Provence, Elsas ...