Gesellschaft | Gastkommentar
Die Zeit ist reif
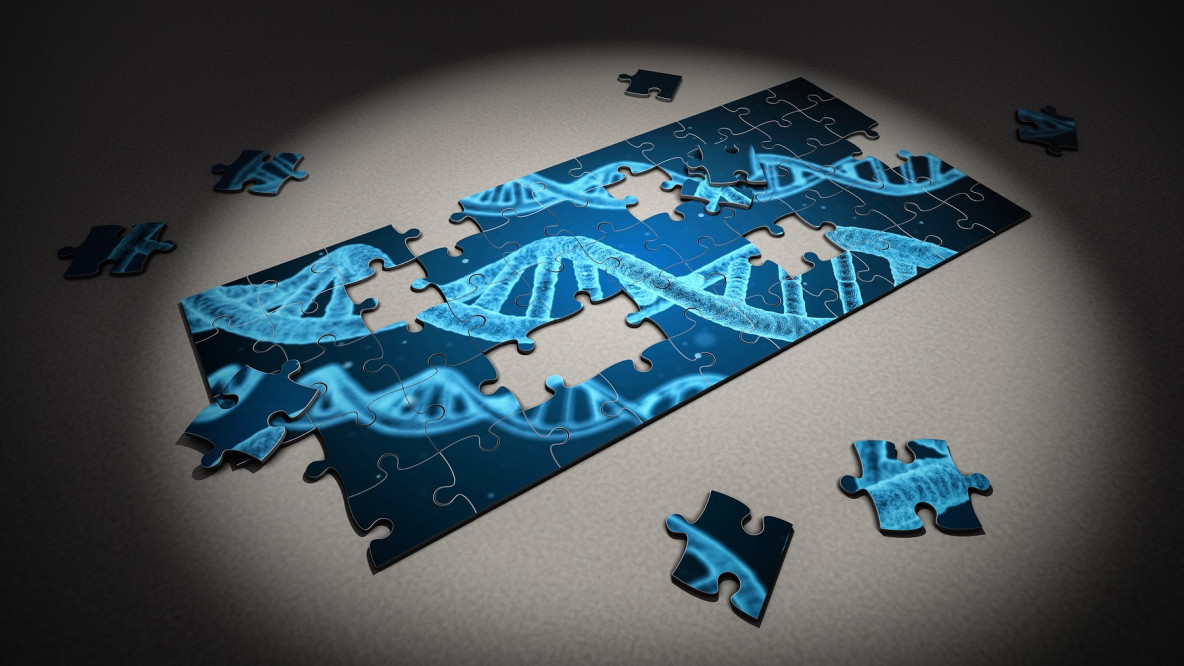
Foto: Pixabay
Uns alle vereint ein Ziel: Wir wollen wieder normal leben wie vor Covid-19. Doch wie kann Südtirol das schaffen? Wie können Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Kultur wieder nachhaltig und zielführend normalisiert werden? Alle konzentrieren sich immer noch nur auf die neuen Infektionen und den Impfstoff als Allheilmittel. Dies obwohl seit knapp 2 Monaten weltweit angesehene Studien beweisen, dass natürliche Immunität auch bei Covid-19 nicht nur aufgrund neutralisierender Antikörper sondern vor allem auch wegen der sog. T-Zellen (Gedächtniszellen des Immunsystems) lange anhält (Langzeit-Immunität). Die wertvolle und entscheidende Ressource der natürlich Immunen wird aber weiterhin vernachlässigt. Die Zeit ist reif, für die Nutzung der natürlichen Immunität einzustehen.
Zurück zur Normalität. Wir benötigen beides.
Um zur Normalität zurückzukehren, benötigen wir beide Formen von Immunität: die mittlerweile weit fortgeschrittene natürliche und die künstliche Immunität durch Impfung. In der Summe werden sie dazu führen, dass sich die Situation schrittweise normalisiert.
Natürliche und künstliche Immunität durch Impfung. Zusammenhang.
Impfungen funktionieren in aller Regel nur dann, wenn die natürliche Immunität funktioniert. Impfung bedeutet – so wie bei der natürlichen Immunität – aber auch nicht volle Immunität. Ein Restrisiko besteht bei beiden Formen der Immunität.
Natürlich Immune in Südtirol. Schätzung.
Die Zahl der natürlich Immunen, d.h. die von der Infektion Genesenen, ist groß und wird von Tag zu Tag größer. Sie ist somit eine der wertvollsten Ressourcen im Kampf gegen das Virus. Offizielle Statistiken vernachlässigen leider bisher die enorme Dunkelziffer. Konservativ rechnet man international mit einem Faktor 4 bis 6, d.h. 4 bis 6 Mal soviel Infizierte wie in den offiziellen Statistiken erfasst. In Südtirol dürften deshalb Stand heute (bei ca. 31.000 mittels PCR Test positiv Getesteten) zwischen 125.000 - 185.000 SüdtirolerInnen unwissend mit dem Virus in Kontakt gekommen und davon genesen sein, d.h. eine natürliche Immunität aufgebaut haben.
Herdenimmunität. Beispiel Gröden.
Gröden ist zwar nicht für ganz Südtirol repräsentativ, stellt dennoch ein sehr gutes Beispiel dar. Eine im Juni 2020 vonseiten des Sanitätsbetriebes repräsentative Antikörperstudie (Astat Info nr. 38) hat bei ca. 30% der GrödnerInnen Antikörper im Blut nachgewiesen. Seither ist mehr als ein halbes Jahr vergangen, d.h. die Immunisierung (Durchseuchung) ist mittlerweile noch viel weiter fortgeschritten. Es wäre sonst nicht zu erklären, wieso man aktuell im Grödnertal, bei ca. 10.000 Einwohnern, aktuell knapp 20 aktive Fälle zählt.
Relevanz der Immunen. Beispiel Sanitätsbetrieb.
Wenn wir die – mittlerweile durch weltweit anerkannte Studien (z.B.: Wajnberg in: Science) nachgewiesene – natürliche Immunität nicht nutzen, zahlen wir dafür einen riesigen Preis. Bei einem mittlerweile so hohen Anteil der Immunen ist es gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch ethisch nicht mehr vertretbar, ihr Potential nicht anzuerkennen und zu nutzen. Es ist beispielsweise nicht mehr verhältnismäßig, Immune weiterhin wie Noch-Nicht-Immune zu behandeln und Ihre Freiheiten gleichermaßen einzuschränken. So muss aktuell ein Immuner immer noch in Quarantäne, wenn er in Kontakt mit einem Positiven kommt. Besonders relevant ist dies im Gesundheitswesen, das bekanntlich auch aufgrund des Personalmangels überlastet ist. Tatsächlich ist ein großer und schnell wachsender Anteil des Gesundheitspersonals immun. Wenn ihre Immunität effektiv identifiziert und genutzt würde, könnten viele Probleme weitgehend entschärft werden. In Südtirol betrifft es beispielsweise aktuell gemäß offiziellen Kommunikationen mehr als 1.400 MitarbeiterInnen im Sanitätsbetrieb.
Anerkennung der natürlichen Immunität. Beispiel Island...und Südtirol
Island zeigt, wie es anders gehen kann: Seit 10. Dezember sind beispielsweise die Grenzen für Urlauber geöffnet, die nachweislich die Infektion überstanden haben. So einfach funktioniert es: Der Nachweis einer bestandenen Infektion muss über einen PCR- oder quantitativen Antikörpertest erfolgen. Zudem bestehen für die Covid-19-Immunen keine Einschränkungen mehr, wie z.B. Quarantäne. Da davon auszugehen ist, dass Island seine Entscheidungen nicht auf einer anderen wissenschaftliche Basis trifft, ist die Vorgehensweise zu begrüßen. Erfreulicherweise wurde auch in Südtirol die Kraft der natürlichen Immunität bereits – ganz leise – anerkannt. So wurden Menschen, die in den drei Monaten vor der Massen-Schnelltestaktion postiv auf das Virus getestet wurden und in Isolation waren, vom Schnelltest mit der Begründung befreit, sie sollten ausreichend Antikörper haben, um nicht infektiös zu sein.
Relevanz der Immunen. Start der Impfkampagne.
Die letzten Tage und Wochen sind gekennzeichnet durch knappe Mengen an Impfdosen und Lieferengpässen. Auch in Südtirol. Zudem wird bekanntlich in den nächsten Monaten die Impfung ohnehin nicht für alle gleichzeitig zur Verfügung stehen. Um so mehr wird es entscheidend, zu wissen, wer bereits eine natürliche Immunität aufgebaut hat um noch besser zu priorisieren und den knappen Impfstoff noch gezielter einsetzen zu können. Zudem wäre es sinnvoll die SüdtirolerInnen transparent über die unterschiedlichen Formen der Immunität (Vor-/Nachteile/Risiken) zu informieren. Dann kann jeder – je nach persönlicher Situation und nach Rücksprache mit dem Arzt – in Eigenverantwortung entscheiden, ob er eine natürliche Immunität mit einer künstlichen Impfung „auffrischen“ will oder sich auf die natürliche Immunität verlässt.
Teststrategie Südtirols. Vorschlag.
Die Strategie Südtirols, breit zu testen anstatt die persönlichen und wirtschaftlichen Freiheiten weiter einzuschränken, war und ist richtig. Die durchgeführten und weitere geplante Virus-Schnelltests sollten durch weitere zielführende Test-Strategien ergänzt werden. Neben der gerade laufenden Virusaktivität sollte auch der Bestand an (tatsächlichen) Immunen durch quantitative Antiköpertests erfasst und in offiziellen Statistiken bzw. bei zukünftigen Strategien und Massnahmen berücksichtigt werden. Dafür sollte allen SüdtirolerInnen die Möglichkeit gegeben werden, sich freiwillig einem quantitativen Antikörpertest zu unterziehen. Diese Antikörpertestungen könnten – entsprechend neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Immunität – in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Am Anfang beispielsweise alle 2-3 Monate.
Antikörpertestungen. Anreize. Nutzen.
Erstens: Man würde ein besseres Bild über das tatsächliche Infektionsgeschen erhalten (auch wissenschaftlich für die Zukunft relevant). Zweitens: Die Impfdosen sind bekanntlich sehr knapp und könnten gezielter eingesetzt werden. Drittens: Gäbe es vielen Menschen mehr Gewissheit und würde auch Ihre Ängste mindern, ihre Produktivkräfte befreien und Lebensqualität erhöhen. Viertens: Es gäbe einen positiven Anreiz zum freiwilligen Testen (sowohl bei Testaktionen der öffentlichen Hand als auch von Seiten der Privatwirtschaft).
Immunität. Weitere Implikationen.
Weiters sollte – unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit – auch darüber diskutiert werden, wie künftig mit den natürlich bzw. künstlich Immunen durch Impfung umgegangen werden soll, was beispielsweise die (teilweise) Befreiung von den üblichen Bestimmungen angeht (z.B. Isolation bei Kontakt mit Positivem, etc.). Auf jeden Fall sollten künstlich und natürlich Immune gleich behandelt werden.
Antikörpertestungen. Ein zielführender Südtiroler Weg.
Südtirol hat die Chance – auf Basis international anerkannter wissenschaftliche Evidenz – durch flächendeckende Antikörpertestungen den bereits eingeschlagenen „Südtiroler Weg“ weiter auszubauen und zielführender zu gestalten. Mit einem solchen Vorgehen könnte Südtirol die Krise nicht nur effizient und zielführender bewältigen, sondern zum Vorbild für Italien und Europa werden.
Der Beitrag ist in gemeinsamer Forschung mit Reiner Eichenberger, Professor für Theorie der Wirtschafts- und Finanzpolitik an der Universität Freiburg, Schweiz, entstanden.
Guter Beitrag. Danke dafür.
Guter Beitrag. Danke dafür.
ich sehe da mindestens 2
ich sehe da mindestens 2 Probleme:
1. was wir nicht wissen: ich weiß nicht genau wer schon eine natürliche Immunität aufgebaut hat und wie lange und wie gut diese wirkt. Ist beim Impfstoff das selbe, da Langzeitdaten natürlich noch fehlen. Sie schreiben selber von Dunkelziffer, bzgl. wer schon alles infiziert war. Nur die positiv getesteten sind bekannt. Das schränkt den Ansatz schon mal ein, da Antikörpertest nach wenigen Monaten nicht mehr anschlagen (dafür gibt es genug Belege) Diese Unbekannten sind wesentlich - Faktor 4-6 wie Sie schreiben, kann ich nicht einschätzen.
2. bei dem beschriebenen Ansatz haben wir ein moral hazard Problem das zu adversen Effekten führen kann. das heißt nicht, dass der Ansatz nicht sinnvoll ist, aber es hängt von den Menschen ab:
a) Es wird ein positiver Anreiz geschaffen, sich mit dem Virus zu infizieren um sich wieder frei bewegen zu können. Entscheidend ist das empfundene Risiko des Einzelnen, einen schweren Verlauf bzw. Folgeschäden zu haben im Verhältnis zum persönlichen Nutzen, wieder mehr Freiheiten genießen zu dürfen. Das kann zu einer „provozierten“ Infektionswelle führen durch das Pendant der „Masern-Partys“ für Kinder. Nicht wünschenswert.
b) Man bräuchte so etwas wie einen Covid-Ausweis, der einem Immunität bescheinigt, wie soll das sonst jemand auch nur stichprobenartig kontrollieren warum Person A etwas darf das Person B nicht darf. Das regt zu Fälschungen an, was epidemiologische Geisterfahrer heraufbeschwört. Genauso wie es Ärzte gibt, die - sagen wir mal - verschreibungsfreudig sind, wird es auch solche geben, die gerne viele Ausweise ausstellen.
dies nur skeptische Gedanken für Ihre Gedanken-Fabrik.
Antwort auf ich sehe da mindestens 2 von Michl T.
1) Bei den
1) Bei den Antikörperschnelltest kann es passieren, dass diese nicht anschlagen. Aber da gibt es, genauso wie bei den Antigentest halt auch Falsch-Positive bzw. Falsch-Negative. Macht man allerdings Blutproben, kann ein recht genauer und zuverlässiger Wert bestimmt werden. Aktuelle Studien gehen aber sehr wohl davon aus, dass die natürliche Immunität eine Langzeitimmunität ist. Siehe: https://www.i-med.ac.at/mypoint/news/749681.html
2)
a) Da wirst du leider recht haben. Man hört das jetzt schon bei vielen Infizierten, „dann hat mans frisch hintersich“.
b) Wird die Immunität über Blutproben festgestellt ist dies ein sehr objektiver Weg. Werden diese zudem noch archiviert, wird kaum ein Arzt seine Zulassung riskieren. Schwarze Schafe gibt es immer wieder, aber deshalb gleich alles in Frage stellen? Dann müsste man viele andere Sachen zuerst in Frage stellen.
Antwort auf ich sehe da mindestens 2 von Michl T.
"variiert die Menge und Art
„variiert die Menge und Art der Antikörper, die bei einer natürlichen Infektion gebildet werden. Der Schutz, der durch eine natürliche Infektion entsteht, reicht also in manchen Fällen nicht aus. Die Anzahl der neutralisierenden Antikörper, die durch eine Impfung gebildet wird, ist vier- bis fünfmal höher als bei einer natürlichen Infektion.“
Danke Bernd Gänsbacher für die zusätzliche Info :)
Die die nicht impfen dürfen
Die die nicht impfen dürfen bleiben vor der Türe? Die Dicken auch? Wer noch ? Der immune bekommt einen pokal.
Spaltung der Gesellschaft,
Spaltung der Gesellschaft, genau so etwas brauchen wir. Bravo Herr Girardi!
Soviel zur „Denkfabrik“.
Antwort auf Spaltung der Gesellschaft, von Arne Saknussemm
Was ist das mittlerweile für
Was ist das mittlerweile für ein verschwenderisches Argument geworden, das „Spaltung der Gesellschaft“. Es wird in einer freien Demokratie zum Glück immer und überall Fürsprecher und Gegner, Solche und Andere geben. Will man das nicht, dann ab nach Nord-Korea. Da ist die Gesellschaft nicht gespalten, aber zu welchem Preis?
Antwort auf Was ist das mittlerweile für von M Ma
Beati pauperes spiritu
Beati pauperes spiritu
Antwort auf Spaltung der Gesellschaft, von Arne Saknussemm
"divide et impera" sagte mal
„divide et impera“ sagte mal jemand...
Abgesehen davon, die Situation ist nicht einfach. Es stimmt und wie! Die Tausende Südtiroler die eine natürliche Immunität haben könnten freier sein und der Gesellschaft/Arbeit/Wirtschaft ein Stück Normalität zurückgeben. Und wenn diese Leute immer wieder mit Coronavirus in Kontakt kommen, frischt sich ihre natürlich erworbene Immunität auch immer wieder auf...
Aber logisch, da bräuchte es eigene Erklärungen, Pässe, ... und jede Menge Kontrollen! Machbar? Ich denke nicht, es scheitert schon ein mal an den Kontrollen!
PS für Michl: waren es nicht „pox-parties“, also harmlosere Windbocken Parties im Kleinkindalter?
Antwort auf "divide et impera" sagte mal von Christian I
https://de.wikipedia.org/wiki
https://de.wikipedia.org/wiki/Masernparty
Das Robert Koch-Institut nennt eine Letalität von 1:1000. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC geht von einer Sterblichkeit von 1:500 bis 1:1000 aus.
Anteil einer nicht-immunen Population, bei dem es nach Kontakt mit einem Krankheitserreger zu einer Infektion kommt bei Masern: fast 1!
Hochinfektiös und ziemlich letal dieser Erreger.
Antwort auf https://de.wikipedia.org/wiki von Michl T.
Wenn die Letalität nur 1:1000
Wenn die Letalität nur 1:1000 beträgt, müsste Gröden 40.000 Einwohner haben...
Antwort auf Wenn die Letalität nur 1:1000 von Markus S.
Gab es so viele Masernfälle
Gab es so viele Masernfälle in Gröden?
"Uns alle vereint ein Ziel:
„Uns alle vereint ein Ziel: Wir wollen wieder normal leben wie vor Covid-19.“
Wirklich?
Haben wir vor Covid-19 normal gelebt?
Ist es normal, dass wir die Ressourcen der Erde zu Lasten der Nachkommen ausbeuten?
Ist es normal, dass in Südamerika der Regenwald gerodet wird, damit ausreichend Soja für die Massentierhaltung produziert werden kann?
Ist es normal, dass wir Tierleid mitverantworten, in dem wir auf Konsumentenseite zu viel und zu billiges Fleisch essen?
Ist es normal, dass wir nichts unternehmen, wenn arme Staaten mit Hilfe von Potentaten, die von unserem Wirtschaftssystem unterstützt werden, zu unserem vordergründigen Vorteil arm gehalten werden?
Ist es normal, dass wir die Brennergrenze offen haben wollen, aber um den Schengenstaaten eine unüberwindbare Mauer für Nichteuropäer wünschen?
Ich hatte bisher offensichtlich die falsche Vorstellung von einer Denkfabrik.