„Von Klimaneutralität weit entfernt“
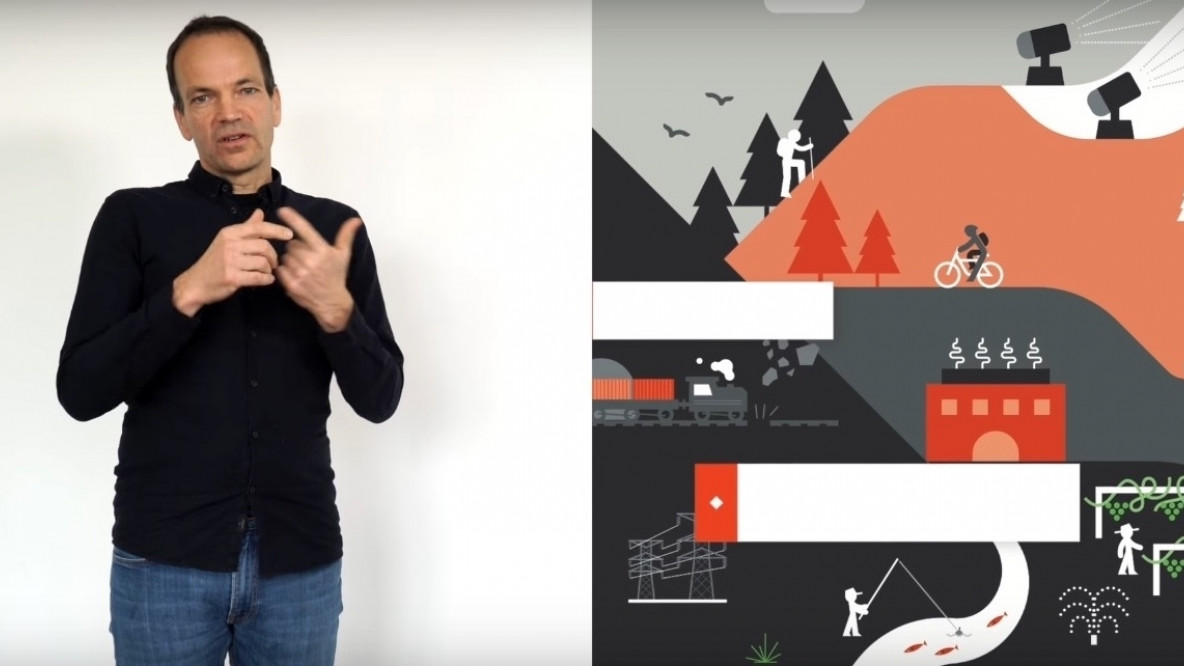
Ein neues Jahr beginnt bekanntlich oft mit guten Vorsätzen. Gut gemeint, aber nicht ernsthaft umgesetzt – das kann sich die Politik in Sachen Klimawandel nicht mehr leisten. In Bozen findet am kommenden Mittwoch (22. Jänner) eine Fachtagung zum Thema statt. „Klimanotstand – was geschieht in Südtirol?“ Zu dieser Frage diskutieren lokale Experten, Techniker, Vertreter von Forschungseinrichtungen und führende Wissenschaftler wie der Meteorologe und Klimatologe Luca Mercalli. Am selben Tag wird die Klimastrategie der Stadt Bozen präsentiert. In Meran ist es bereits am heutigen Donnerstag so weit. Um 20 Uhr findet die Vorstellung des „Aktionsplans für Nachhaltige Energie und Klima“ für die Bürger statt. Der EURAC-Klimaforscher Marc Zebisch hat in federführend mit ausgearbeitet.
salto.bz: Herr Zebisch, in Südtirol gibt es bereits den Klimaplan des Landes, der bis Mitte 2020 überarbeitet werden soll. Wozu braucht es einen Klimaplan für Gemeinden wie es der „Aktionsplan für Nachhaltige Energie und Klima“ ist, der für Meran ausgearbeitet wurde?
Marc Zebisch: Im Umgang mit dem Klimawandel gibt es zwei sich ergänzende Strategien. Der Klimaschutz beschäftigt sich damit, wie Treibhausgasemissionen reduziert werden können, um den weiteren Klimawandel abzuschwächen. Die Klimaanpassung umfasst Strategien, wie man sich an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels anpassen kann: mehr heiße Tage, ein Zunahme von extremen Niederschlägen, ein abnehmende Wasserverfügbarkeit im Sommer.
Der Aktionsplan, den Eurac Reserach zusammen für die Gemeinde Meran erarbeitet hat, ist ein Aktionsplan zur Anpassung an den Klimawandel. Dieser Plan ist eine Ergänzung zum bereits bestehenden Aktionsplan für Nachhaltige Energie und Klima der Gemeinde Meran, der sich mit dem Klimaschutz beschäftigt.
Das Update des Klimaplans für Südtirol ist ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz. Auf Landesebene werden viele wichtige Entscheidungen zu Regelungen und Förderungen getroffen. Dennoch liegen viele Entscheidungen, die Klimaschutz wie auch Klimaanpassung betreffen, auf Gemeindeebene. Insofern sind Pläne auf Gemeindeebene wichtig für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen, vor allem in Bereich Bauen, Grünplanung und Infrastruktur.
Neben den regionalen Auswirkungen würde sich Südtirol auch den Auswirkungen des Klimawandels auf globaler Ebene nicht entziehen können: humanitäre, wirtschaftliche und eventuell auch militärische Krisen.
Wie viele Südtiroler Gemeinden haben einen solchen Plan? Wie verbindlich sind die darin enthaltenen Maßnahmen?
Wenn wir von einem Aktionsplan für Anpassung sprechen ist die Gemeinde Meran meines Wissens nach die erste Gemeinde in Südtirol, die einen solchen vorstellt. Auch Bozen wird einen solchen Plan in Kürze vorstellen. Der Plan wird auf Gemeindeebne beschlossen, die darin beschriebenen Maßnahmen sind Vorschläge, die dann von der Gemeinde noch detaillierter ausgearbeitet werden.
Welche Maßnahmen können Städte bzw. Gemeinden ergreifen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?
Bezüglich Anpassung kann man keine Patentrezepte aussprechen. Hier ist jede Gemeinde ein wenig anders gelagert. In Meran zum Beispiel sind die problematischen Klimawirkungen die Zunahme von heißen und trockenen Perioden und entsprechende Hitzeinseln in der Stadt. Hitzeperioden belasten die Gesundheit, vor allem von älteren Menschen und schaden dem Stadtgrün. Außerdem ist in Meran das komplexe Ent- und Bewässerungssystem nicht optimal auf Starkregenereignisse vorbereitet. Entsprechend beziehen sich die Schlüsselmaßnahmen für Meran auf diese Wirkungen.
Im Umgang mit dem Klimawandel gibt es zwei sich ergänzende Strategien: Klimaschutz und Klimaanpassung.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel sollen Hitzeinseln zunächst erfasst und dann bei Neubaumaßnahmen Frischluftschneisen erhalten werden. Oder im Fall von Hitzewellen sollen in den Stadtvierteln Anlaufpunkte mit gekühlten Räumen und sozialen Dienstleistungen eingerichtet werden. Zur Verbesserung der Situation bei Starkregenereignissen soll eine Arbeitsgruppe zur zukünftigen Zweckbestimmung, Modernisierung und zentralen Steuerung und Verwaltung der Meraner Kanalsysteme eingerichtet werden, sowie Maßnahmen zur Entsiegelung getroffen.
Können solche Maßnahmen auch für andere Gemeinden sinnvoll sein?
Zum Teil. Für andere Gemeinden, etwal in höhere gelegenen Regionen, können die kritischen Klimawirkungen und entsprechend auch die Anpassungsmaßnahmen aber ganz andere sein und zum Beispiel mehr mit Naturgefahren (z.B. Rutschungen) oder dem Rückgang der Schneesicherheit im Tourismus zu tun haben. Auf den Hochplateaus mag hingegen die Wasserversorgung für die Landwirtschaft ein wichtiges Thema sein.
Was auf jeden Fall immer angebracht ist, ist eine gründliche Analyse der möglichen Anfälligkeiten in einer Gemeinde und die gemeinsamen Ausarbeitung von Maßnahmen mit entsprechenden Beteiligten sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung.
In Meran wird der Strategieplan nun den Bürgern präsentiert. Sie haben ein Szenario für Meran gezeichnet, wie sich das Klima bis zum Ende des Jahrhunderts verändern wird, falls keine wirksamen Maßnahmen und Programme umgesetzt werden, um den Klimawandel zu einzudämmen. Wie wird sich Südtirol insgesamt verändern? Mit welchen Folgen?
Seit den 1960er Jahren ist die Jahresdurchschnittstemperatur um 1,5 Grad angestiegen. Im Sommer ist es in Bozen und Brixen sogar um fast drei Grad wärmer geworden. Nach dem pessimistischsten Szenario muss man bis für den Sommer mit einer weiteren Erwärmung bis 2100 um fünf Grad rechnen. Auffallend ist auch die Zunahme der sogenannten Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. In den 1960er Jahren konnte man sie in Bozen an einer Hand abzählen. 2015 waren es 29 – ein Rekord. Doch bis Ende des Jahrhunderts könnten 60 Tropennächte im Jahr Normalität sein. Eine solcher Klimawandel würde vermutlich neben den regionalen Auswirkungen auf der globalen Ebene humanitäre, wirtschaftliche und eventuell auch militärische Krisen auslösen, denen sich Südtirol nicht entziehen könnte. Auch bei einer Verringerung der Emissionen würde der Klimawandel immer noch mit einer Erwärmung um 2-3 Grad einhergehen. Insofern gibt es aus meiner Sicht keine Alternative zu der vom EU-Parlament beschlossenen Klimaneutralität bis 2050, die nur durch einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen möglich ist.
Die drei wichtigsten Sektoren beim Klimaschutz: Verkehr, Gebäudesanierung, Verringerung des Energiebedarfs für Heizen und Kühlen.
Welche sind die größten Klimagefahren für Südtirol?
Das unterscheidet sich von Region zu Region. Im Süden und im Unterland sind Hitze und Trockenheit ein Problem für die Bevölkerung, aber auch die Land- und Forstwirtschaft. Die abnehmende Schneedecke in Winter schränkt die Möglichkeiten für den Wintersport ein und reduziert die Wasserverfügbarkeit im Frühsommer.
Zunehmende Extreme wie Starkniederschläge und Stürme gefährden weite Teile Südtirol und betreffen neben Land- und Forstwirtschaft auch Infrastruktur, Verkehr und Gebäude. Land- und Forstwirtschaft sind durch eine zunehmenden Druck durch Pflanzenkrankheiten und Schädlingen betroffen. Aber auch die menschliche Gesundheit ist durch die Verbreitung von Zecken, Tigermücke oder durch allergene Pollen beeinträchtigt.
Wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf in der Südtiroler Klimaschutz-Politik?
Wenn wir über Klimaschutz reden, sind die drei wichtigsten Sektoren der Verkehr – vor allem die Förderung von emissionsfreiem Verkehr, insbesondere Öffentlichem Nahverkehr –, die Gebäudesanierung bezüglich Isolation, und die Verringerung des Energiebedarfs für Heizen und Kühlen sowie die Förderung von erneuerbaren Energien.
Südtirol sollte alle seine Möglichkeiten nutzen, um in allen Sektoren die EU-Strategie einer Klimaneutralität bis 2050, oder besser früher, umzusetzen.
Sehen Sie in diesen Bereichen Fortschritte?
Das größte Sorgenkind ist aus meiner Sicht der Verkehr, da hier die Emissionen weiter zunehmen statt abnehmen. Aber auch im Gebäudebereich gehen die Maßnahmen zu langsam, hier sind wir noch weit von einem Trend in Richtung Klimaneutralität entfernt. Die Emissionen in der Landwirtschaft sind bisher nur sehr pauschal erfasst. Ebenso gibt es bisher wenig Überlegungen zur Senkung der Emissionen in der Landwirtschaft. Eine Förderung von lokalen Produkten und weniger Import – von Fleisch und Futtermitteln – und Export, etwa von Äpfeln, würde die Emissionen schon senken.
Und die privaten Haushalte?
Private Haushalte tragen natürlich über Verkehr, Heizen, Kühlen zu Emissionen bei, aber auch durch das Konsumverhalten, das einen großen Anteil an den globalen Emissionen hat – auch wenn diese meist nicht in Südtirol, sondern in anderen Regionen wie China (Konsumprodukte) oder Südamerika (Fleisch, Kraftfutter) entstehen.
Was kann Südtirol tun?
Südtirol sollte alle seine Möglichkeiten nutzen, um durch Regelungen – Steuern, Vorschriften –, Anreize, technische Maßnahmen sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung in allen Sektoren die EU-Strategie einer Klimaneutralität bis 2050, oder besser früher, umzusetzen. Es müsste sichergestellt sein, dass die Summe aller Maßnahmen auch tatsächlich geeignet ist, die angestrebten Emissionsreduzierung zu erzielen. Klimaschutz ist eine Chance! Gerade eine Kombination aus modernen Technologien, regionalen Wirtschaftskreisläufen und eine nachhaltige Sicherung der natürlichen Ressourcen würde langfristig die Lebensqualität der Südtirolerinnen und der Südtiroler sichern und die Region zum Vorbild in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit machen.
ein wichtiger Artikel; beim
ein wichtiger Artikel; beim ersten Durchlesen 2 Bemerkungen zur klaffenden Schlucht zwischen Wort und Tat:
.
- „Wenn wir über Klimaschutz reden, sind die drei wichtigsten Sektoren der Verkehr – vor allem die Förderung von emissionsfreiem Verkehr, insbesondere Öffentlichem Nahverkehr“: grad eben hat die öffentliche Hand für Bozen, Meran, Leifers etwa 60 Diesel(!!!)-Busse für den öffentlichen Verkehr für die nächsten 15 Jahre gekauft. Mein 6-l-Diesel Baujahr 2000 darf nicht nach Bozen fahren, ein 2-Tonnen-SUV mit 15-18 l Verbrauch im Stadtverkehr hat freie Fahrt. Der billige Umwegverkehr über den Brenner wird - zwecks Geldverdienen - nicht abgestellt.
.
- „ ... und die Verringerung des Energiebedarfs für Heizen und Kühlen sowie die Förderung von erneuerbaren Energien“: die Geothermieanlage für die Heizung im Haus müsste ich abschalten und die alternativ eingebaute Gasbefeuerung zünden: russisches Alperia-Gas hilft zu billigerem Heizen als der südtiroler Alperia-Strom aus Wasserkraft.
.
Bisher sehe ich nicht, dass die Politik beim Klimaschutz konkret in die richtige Richtung zu gehen versucht. Alles bleibt Lippenbekenntnis, wenn man 2019 Dieselbusse für die Zukunft kauft.
Antwort auf ein wichtiger Artikel; beim von Peter Gasser
Da haben Sie zwei gute
Da haben Sie zwei gute Argumente eingeworfen, Herr Gasser! Es gibt anscheinend auch im Bereich des Natur- und Klimaschutzes zuwenige Manager, die auch vernetzt und ökologisch denken können! Oder sich die Mühe machen! Das mit den Diesel-Bussen fällt in die Zuständigkeit des Landes, und das hat anscheinend noch keinen Klimaplan.
Antwort auf Da haben Sie zwei gute von Sepp.Bacher
Doch, hat es: https://umwelt
Doch, hat es: https://umwelt.provinz.bz.it/publikationen.asp?publ_action=4&publ_artic…
Antwort auf Doch, hat es: https://umwelt von pérvasion
Ja, der Plan von 2011:
Ja, der Plan von 2011:
Plan: "Südtirol übernimmt Verantwortung im Klimaschutz:
Südtirol wird die CO2-Emissionen innerhalb 2020 auf 4 t ... pro Jahr und Person senken".
Stand 2019: „Durchschnittlich emittiert jeder Südtiroler“, erklärt der Direktor der KlimaHaus-Agentur Ulrich Santa, „knapp 7,4 Tonnen CO2 im Jahr.“
.
Plan: „ Südtirol deckt den Energiebedarf weitgehend unabhängig von fossilen Energieträgern. Der durch regenerative Energieträger abgedeckte Anteil am Bedarf wird bis 2020 mindestens 75%, bis 2050 über 90% betragen“.
Stand 2019: noch immer ist Heizen mit GAS am billigsten.
Antwort auf Ja, der Plan von 2011: von Peter Gasser
Sie sollten das nicht so eng
Sie sollten das nicht so eng sehen, fast alle Industrieländer haben einen Plan, das ist doch schon mal was.
Nur wissen die regierenden Politiker der meisten Ländere auch, dass die Nebenwirkungen des Umsetzen diesen Planes sie sehr wahrscheinlich ihren politischen Kopf kosten könnte.
Also lässt man es mit dem Plan gut sein.
Antwort auf Doch, hat es: https://umwelt von pérvasion
@ Pervasion
@ Pervasion
Die beiden Dokumente sind mit 2010 datiert und beschränken sich nur auf einen Bereich. In diesem Interview wird von einem notwendigen Update des Klimaplans für Südtirol gesprochen!
Dies wäre gut, aber von
Dies wäre gut, aber von beschränkter Wirkung.
Über 90% des menschlich verursachten CO2 betrifft Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Heizung: hier müssen Gesetzgeber und Politik ansetzen; alles andere ist schön, aber wenig wirksam.
Klimaschutz ist keine Chance,
Klimaschutz ist keine Chance, sondern Schadensbegrenzung. Und mit welchen Regelungen, Steuern und Vorschriften kann Südtirol regionale Wirtschaftskreisläufe fördern? Das Steuersystem ist nationale Kompetenz und Südtirol gehört zum europäischen Binnenmarkt. Somit können auch keine Zölle eingeführt werden.
Anstatt diesen diffusen Optimus, wäre besser man würde über konkrete Maßnahmen sprechen.
Antwort auf Klimaschutz ist keine Chance, von gorgias
Südtirol kann aber Steuern
Südtirol kann aber Steuern für bestimmte Personengruppen usw. reduzieren. Und hat das bei Unternehmen und Hungerrentnern bereits getan.
Antwort auf Südtirol kann aber Steuern von Sepp.Bacher
Von hier wird die Veränderung
Von hier wird die Veränderung kommen:
https://www.salto.bz/de/article/16012020/ein-brief-bringt-die-grosse-we…
Die Politik (die Politiker) scheint dazu aufgrund ihrer Wahl-„Kurzichtigkeit“ wirklich nicht sonderlich geeignet zu sein.
Na keine Angst "Klimahysterie
Na keine Angst, „Klimahysterie“ hat die Mainstreampresse kurzerhand erfunden, um von Rueckkoppelungsprozessen und der enormen Verantwortungslosigkeit von Wirtschaft und Politik abzulenken.
Das sind wichtige Hinweise
Das sind wichtige Hinweise von Prof. Zebisch. In Bezug auf Industrie, Energie-Heizung und Verkehr wird sich das Land schwer tun. Beim frisch erstellten Raumordnungsplan sehe ich leider viele geöffnete Schleusen in Richtung Ausweitung neuer Kubaturen durch die Kompetenzenzuweisungen an die Gemeinden und die reduzierten Bremsen der Naturschutz-und Umweltorganisationen. In Bezug auf die Landwirtschaft scheint mir das offensichtlich klarer, gibt doch der-Malser-Weg (kleinteilige, vielfältige Produktion ohne Chemie statt industrialisierte Monokulturen, Ausbau lokaler Märkte) praktisch die Stoßrichtung an, aber der Bauernbund boykottiert den und auch der zuständige Landesrat Schuler versucht ihn zu verhindern/ verzögern durch durchsichtige Kompromissvorschläge. Die groß angekündigte Studie zur Biodiversität der Universität/ Eurac zum Biodiversitäts- Monitoring wird in auffälliger Stille nach außen in camera caritatis vorbereitet - gerade hier käme es darauf an, dass deren Ausrichtung auf Klimaanpassung und Klimaschutz offen dargelegt, wirklich gestärkt werden und keine Zeit beim Anpacken verloren wird.
Antwort auf Das sind wichtige Hinweise von Klaus Griesser
Sie schreiben: „In Bezug auf
Sie schreiben: „In Bezug auf Industrie, Energie-Heizung und Verkehr wird sich das Land schwer tun“:
Wieso?
- wer kann den Transit-Umwegverkehr über den Brenner beenden? Das Land.
- wer kann dafür sorgen, dass Heizen mit Alperia-Russland-Gas nicht billiger ist als Heizen mit hausgemachtem Alperia-Wasserkraft-Strom (Wärmepumpe)? Das Land.
Antwort auf Sie schreiben: „In Bezug auf von Peter Gasser
In Bezug auf den
In Bezug auf den Transitverkehr gebe ich Ihnen recht, aber bei den Widerständen der Transportunternehmer sieht man: das Problem liegt tiefer, im System. Industrie/ Bauwesen & Handel & Landwirtschaft wollen schrankenlosen Import-Export - da tut sich das Land schwer. Bezüglich Heizen: es geht nicht darum welche Stromerzeugung billiger ist, sondern dass zuviel Energie und damit CO2 produziert wird.
Bei der Diskussion Klimaschutz/ Klimaanpassung muss dringend vor allem anderen der dafür anstehende SYSTEMWECHSEL durchgecheckt werden. Das meine ich auch selbstkritisch zu dem was ich oben ausführte bzgl. Landwirtschaft - und zwar in hierarchischer Reihenfolge von der Erde hin zu einzelnen Staaten und dann zu Regionen usw. Meines Wissens haben nur die Nachdenkseiten die Leser zu einer Diskussion aufgefordert: was heißt das praktisch: Systemwechsel? Der Gemeinde-Meran- Plan von Prof. Zebisch sei von der Kritik lobenswerterweise herausgenommen, aber wieso gibt ihm nicht das Land einen entsprechenden Auftrag?
Antwort auf In Bezug auf den von Klaus Griesser
Sie schreiben:
Sie schreiben:
„es geht nicht darum welche Stromerzeugung billiger ist, sondern dass zuviel Energie und damit CO2 produziert wird“:
Heizen muss man ja, da kann unsere Gesellschaft vorher auf Vieles andere verzichten. Was aber nicht sein kann, ist, dass man eine Heizanlage mit Erdwärme abgeschaltet lässt, das die als Reserve installierte Gasheizung billiger ist.
Sie wissen, dass der „Systemwechsel“, wenn nicht weltweit, so doch mindestens europaweit gleichzeitig und gemeinsam und nur von der Politik und mit einschneidenden Gesetzen, welche Produzenten und Konsumenten gleichermaßen einbeziehen, vollzogen werden kann.
Antwort auf Sie schreiben: „In Bezug auf von Peter Gasser
Falsch, der Staat gibt die
Falsch, der Staat gibt die Stromtarife vor. Der Stromverkäufer kann nur bedingt auf den Preis einwirken.
Antwort auf Falsch, der Staat gibt die von Philipp Fallmerayer
Der Gesetzgeber, auch der
Der Gesetzgeber, auch der lokale, hat genug finanzielle Steuermechanismen zur Verfügung, die es ihm erlauben, in einem Land mit grünem Wasserkraftstrom-Überschuß das Heizen mittels Wärmepumpe billiger zu gestalten als mit aus Russland importiertem Gas. Wenn er denn will.
(Aber er verkauft die teure Wasserkraft lieber gewinnbringend, und liefert uns billiges Gas).
Antwort auf Der Gesetzgeber, auch der von Peter Gasser
Sie liegen mit der Anwendung
Sie liegen mit der Anwendung der möglichen finanziellen Steuermechanismen leider wieder falsch. Sofern Sie von einem Netz versorgt werden, das nicht zur Kategorie der historischen (Strom)Genossenschaften gehört (davon gehe ich als Leser einiger Ihrer Kommentare aus), unterliegen Sie den selben Netzgebühren, Systemkosten und sonstige Steuern wie jeder andere. Ihr Verkäufer kann somit nur bedingt auf den Preis einwirken, es liegt an Ihnen sich inmitten der Vielzahl von Anbietern einen eventuell günstigeren zu suchen.
Auch der Verkauf von Strom aus Produktionsanlagen ist - abgesehen der staatlichen Förderungen für erneuerbare Energien - nicht so lukrativ wie Sie behaupten, aktuell sprechen wir von rund 40€/MWh.
Vor Jahrzehnten wurde bereits entschieden, dass die Gewinne der öffentlichen Stromproduktion dem Land selbst bzw. deren In-house-Gesellschaft zufließen; sollten Sie ein anderes Modell propagieren, warte ich gespannt auf Ihre (konstruktiven) Ideen.
Die Gaspreise sind, aufgrund der Lage am Weltmarkt, seit jeher attraktiv. Sollte Ihnen Ihr gesamtes Energiepaket im Ganzen zu teuer sein, sind Sie herzlich eingeladen sich zum Selbstversorger zu mausern. Dann können Sie zumindest behaupten den (bösen) Stromkonzernen ein Schnippchen geschlagen zu haben...
Antwort auf Sie liegen mit der Anwendung von Philipp Fallmerayer
Ich verstehe Ihren Zynismus
Ich verstehe Ihren Zynismus nicht.
Natürlich kann die öffentliche Hand den Betrieb von Wärmepumpen fördern (eventuell mit Ökobonus - aus den Gewinnen?) damit weniger Öl oder Gas verbrannt wird.
Nochmal: wenn sie denn TUN will, wovon sie stets schön redet.
Antwort auf Ich verstehe Ihren Zynismus von Peter Gasser
Es sei Ihnen verziehen, dass
Es sei Ihnen verziehen, dass Sie über die komplexe Materie der Energiewirtschaft nur unzureichende Kenntnisse besitzen. Ihre Annahme, Stromverkäufer könnten Preise anbieten, die nicht dem Marktwert entsprechen, steht nämlich im Kontrast zur geltenden Gesetzgebung im Bereich Wettbewerb und ist somit nicht erlaubt.
Dies gilt auch für den Fall, dass dies aus ökologischen Gründen geschehen würde, wobei eine finanzielle Förderung von erhöhtem Konsum wiederum kontraproduktiv für das Gesamtsystem wäre.
Versuchen Sie einfach Ihren Konsum zu optimieren, den Markt auszuloten und sich nach alternativen bzw. modernen Energiegewinnungsmethoden umzusehen; dann ist Ihnen und der Umwelt geholfen.
Antwort auf Es sei Ihnen verziehen, dass von Philipp Fallmerayer
Weder ist es nötig noch
Weder ist es nötig noch angebracht, dass Sie etwa verzeihen; auch die Annahmen, welche Sie mir hier andichten, ist nicht die Meine.
Natürlich ist die Politik dafür verantwortlich, ob die Gasheizung im Betrieb billiger ist als eine Geothermalanlage oder Solarenergie.
Wie kommen Sie auf die abstruse Idee einer „finanziellen Förderung von erhöhtem Konsum“?
Wieso sollte ich Ihrem Rat folgen, und mich nach alternativen und modernen Energiegewinnungsmethoden" umsehen:
Ich bin erstens kein Energieproduzent; zweitens ging es in meinem Beitrag um das Unverständnis, dass Heizen mit Geothermie hStrom aus Wasserkraft) teure ist als das Verbrennen von russischem Gas.
Das ist lustig:
Das ist lustig:
Wenn von Vater und Mutter nur mehr 1 fortpflanzungsfähiges Kind in Europa übrigbleibt, dann - halbiert sich die Bevölkerung.
Bei 500 Millionen fehlen dann bald 250 Millionen - und Sie wollen allen Ernstes die Zuwanderung stoppen?
Da bin ich erst Mal sprachlos.
Als es in Europa im 19.
Als es in Europa im 19. Jahrhundert eine Krasse Überbevölkerung gab, hat man in der ganzen Welt neue Siedlungsgebiete erobert und die Einheimischen z. B. USA, Australien, Neuseeland, stark dezimiert. Wenn es jetzt in anderen Kontinenten eine Überbevölkerung gibt, dann hat das auch viel mit der kapitalistischen westlichen Welt zu tun, die dort natürliche Gleichgewichte zum Kippen gebracht hat. Aber es gibt nicht mehr viele Kontinente, welche diese Überbevölkerung aufnehmen könnte.
Wie Europäer könnten z. B. dazu beitragen, dass wir nicht dauernd noch das Lebensalter erhöhen, sondern eher uns zeitiger aus dem Leben verabschieden! Und das schreibe ich als Betroffener. Also weniger Transplantationen, Defibrillatoren, und andere Lebens-rettende und -verlängernde Maßnahmen. Einerseits ist das nicht mehr zu bewältigen und anderseits tut dieses Generationen-Ungleichgewicht der Gesellschaft nicht gut!
Antwort auf Als es in Europa im 19. von Sepp.Bacher
Lieber Herr Bacher,
Lieber Herr Bacher,
Ihr philosofischer Gedanke hat mich da an eine Idee erinnert, oder weist auf eine in Ihrem Unterton darauf hin, …. welche seinerseits in den dreißiger - anfang vierziger Jahren praktiziert worden ist....
Antwort auf Lieber Herr Bacher, von Alois Abart
Da haben Sie mich völlig
Da haben Sie mich völlig missverstanden: Es ist ein Unterschied, ob das System entscheidet und die Maßnahmen dann auch durchführt, oder ob Personen aus eigenen Bewusstsein und eigener Verantwortung entscheiden, ihr Leben nicht zu verlängern (zu lassen)!
Was soll das denn sein Herr
Was soll das denn sein Herr Rufer? Ein copy & paste ihrer eigenen Meinung, aber halt von höherer Stelle? Ausgerechnet Australien...eine Meisterleistung an Kreativität und Geisteshaltung!