Daten und Forschung

-
Unsere Gesellschaften stehen aktuell vor großen Herausforderungen, die auch Kunst und Kultur direkt betreffen und sie in die Verantwortung ziehen. In einer Zeit sich immer rapider aneinanderreihender Krisen und tiefgreifender Veränderungsprozesse gilt es, Lösungswege aufzuzeigen, wie bspw. bei gleichzeitiger sozialer Nachhaltigkeit und ökonomischer Stabilität mit der akut dringender gewordenen ökologischen Transformation umzugehen ist. Um nicht nur reaktiv auf äußere Einflüsse, sondern auch proaktiv und unabhängig agieren zu können, sind grundlegende Veränderungen vonnöten – gerade für eine Kulturpolitik, die sich als Gesellschaftspolitik begreift.
Nun gilt es mehr denn je, in Analyse und Forschung zu investieren, um bei kulturpolitischen Debatten und Entscheidungsfindungen sowie bei Interessensvertretung auf solide, unabhängige Datenlagen rekurrieren zu können. Daten bieten Transparenz (Informationsinstrument), ermöglichen die Darstellung von Entwicklung (Analyse- und Reflexionsinstrument), sind von grundlegender Bedeutung für kulturpolitische Diskussionen (Diskursinstrument) und bilden vor allem die Grundlage für kulturpolitische Steuerungen (Governance).
Tatsachen werden verdreht, Zweifel an wissenschaftlichen Ergebnissen geschürt, Daten bewusst falsch interpretiert – wenn es überhaupt eine Datengrundlage gibt.
-
Darüber hinaus kann datenbasierte Interessensvertretung dazu beitragen, Vielfalt und Inklusion in der Kultur zu fördern, indem sie sicherstellt, dass die Bedürfnisse und Interessen Aller berücksichtigt werden – unabhängig von ihrer Nähe zu politischen Akteur*innen oder ihrer Kapazität, sich in den gesellschaftlichen Entscheidungsfindungsprozess einzubringen.
Die Stärkung unserer Demokratie ist hierbei zentral, die das Aushandeln von Perspektiven und Ansichten auf dem Weg zur Entscheidungsfindung ermöglicht und voraussetzt. Schwierige Entscheidungen werden gemeinsam verhandelt. Dies führt zu einer größeren Akzeptanz von Maßnahmen, wenn Prozesse transparent kommuniziert werden. Wegen der hohen Komplexität gesellschaftspolitischer Zusammenhänge, dem rapiden Wandel und der teils begründeten Ängste der Menschen haben derzeit in vielen Ländern Europas und darüber hinaus populistische, antidemokratische Bewegungen und Meinungsmacher mit simplifizierenden Argumenten leichtes Spiel. Tatsachen werden verdreht, Zweifel an wissenschaftlichen Ergebnissen geschürt, Daten bewusst falsch interpretiert – wenn es überhaupt eine Datengrundlage gibt. Aus machtpolitischen, ideologischen Gründen aber auch aus Leichtsinn wird in Kauf genommen, dass objektiv falsche Entscheidungen getroffen werden. Eine auf falschen Daten und Interpretationen fußende Politik wäre jedoch gesellschaftlich desaströs.Die Kulturpolitische Gesellschaft und ihr Institut für Kulturpolitik versuchen daher, gezielt im Rahmen von Projekten angewandter Forschung solide und ausgewogene Datengrundlagen für politische Entscheidungen und Reflektionen herzustellen. Dies kann durch eigene Projekte angewandter Forschung- aber auch durch die sachkundige Analyse, Zusammenstellung und Kommunikation der Reflektionen und Forschungsergebnisse anderer geschehen. Durch die Analyse von Daten können Trends und Bedürfnisse innerhalb der Kultur identifiziert werden, was zu einer effektiveren Gestaltung von Programmen und Angeboten führt.
So betrachten z.B. die Kulturpolitische Gesellschaft und ihr Institut für Kulturpolitik seit vielen Jahren die Rolle der Kultur in der Regionalentwicklung. Die aktuelle Studie „Kulturpolitik und Kulturförderung für ländliche Räume“ verfolgt das Ziel, ein differenziertes Verständnis von aktuellen Leitbildern, Strategien und Programmen für die Förderung von Kultur in ländlichen Räumen zu erarbeiten. Konkret kann auf dieser Basis ein theoretisch fundierter und datengestützter Austausch zwischen Fördermittelgebern über Erfahrungen, Erfolge, Kriterien und Verfahren konzipiert werden, als Beitrag zur programmatischen und praktischen Weiterentwicklung von Förderpolitiken.
Ein weiteres Beispiel datenbasierter politischer Entscheidungsfindung ist die Erstellung von Kulturentwicklungsplänen (KEP). Die Kulturpolitische Gesellschaft hat in den letzten eineinhalb Jahren (2022-24) die Erstellung des KEP Rheinland-Pfalz gestaltet. Bei diesem Prozess wurden die Herausforderungen im Kulturbereich sichtbar gemacht sowie Potenziale aufgezeigt, die für eine nachhaltige Entwicklung signifikant sind und nun eine strategische Ausrichtung der Kulturpolitik ermöglichen.
Kulturpolitik braucht daher Kulturpolitikforschung als Basis ihrer konzeptionellen Entwicklung und zukünftigen Ausgestaltung.
Wichtig ist für die Kulturpolitische Gesellschaft ist auch stets der datenbasierte, vergleichende Blick in andere europäische und außereuropäische Länder, um politische Entscheidungsfindung zu unterstützen, so z.B. beim European Compendium of Cultural Policies and Trends.
Überregional setzt sich die Kulturpolitische Gesellschaft dafür ein, die Rolle der Kulturstatistik als Basis konzeptbasierter Kulturpolitik inhaltlich und strukturell zu stärken. Schon der parteiübergreifende Schlussbericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“ (2003-2007) verwies darauf, dass statistische Daten zum kulturellen Leben eine unverzichtbare Grundlage für kulturpolitische Entscheidungen sein sollten. Dieser Anspruch ist bis heute nicht eingelöst, da der Kulturstatistik in Deutschland nach wie vor ein geringer Stellenwert eingeräumt wird – insbesondere im Vergleich mit anderen Ressorts oder mit anderen Ländern Europas.
Gerade in Zeiten drohender Etatkürzungen, auch als Folge der aktuellen politischen Spannungen und Kriege sowie als Nachwirkung der Corona-Krise, herrscht eine noch größere Notwendigkeit zu verstehen, wo sowohl Kürzungen als auch Investitionen wie möglich sein könnten – und wo hierdurch ein fragiles System unwiederbringlich gestört werden könnte. Was braucht es unbedingt, um unsere demokratische Kultur für Alle zu sichern und Transformation zu ermöglichen?
Dennoch gilt es, im Sinne agilen Handelns, sich nicht durch unvollständige Datenlagen verunsichern zu lassen. Die gesellschaftliche Komplexität übersteigt jedes noch so komplette Forschungsdesign. Die Wahrscheinlichkeit der „richtigen“ Entscheidung nimmt dennoch mit Datenanalyse und dem Verstehen der Hintergründe zu. Eine gesunde Fehlerkultur erlaubt es darüber hinaus, nachzujustieren oder aufgrund einer veränderten Datenlage neue Entscheidungen zu treffen.
Kulturpolitik braucht daher Kulturpolitikforschung als Basis ihrer konzeptionellen Entwicklung und zukünftigen Ausgestaltung. Sie inhaltlich und methodisch weiterzuentwickeln sowie strukturell und finanziell abzusichern, ist Ziel der Kulturpolitischen
Gesellschaft – gemeinsam mit vielen anderen Akteuren, die sich für Kultur, Gesellschaft und Demokratie einsetzen.Weitere Artikel zum Thema
Kultur | Salto WeekendLebensnotwendig wie der Tod
Bücher | Salto booksNonturismo
Kultur | Kleider machen LeuteNennt sie nicht „Lumpen“!
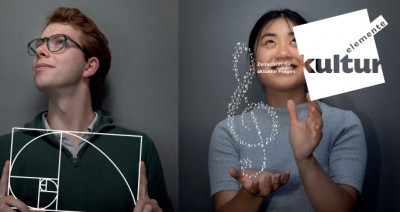





Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.