Architekturkommunikation

-
Text: LAMA Magazin 3|9 März 2021
Interview von Felix Obermair mit Prof. Riklef Rambow
-
Entwurfspräsentationen, Diskussionen mit Bauherr*innen, städtebauliche Leitsätze: Soll die eigene Botschaft beim Gegenüber richtig ankommen, erfordert das auch in der Architektur ein gutes Kommunikationsvermögen. Doch wo lernen angehende Architekt*innen, ihre Gedanken im Dialog mit Laien schriftlich, verbal und visuell adäquat zu vermitteln? Die Lehraufträge für Architekturkommunikation sind auf deutschsprachigen Hochschulen immer noch dünn gesät. LAMA hat sich mit Prof. Riklef Rambow, Professor für Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Mitbegründer von PSY:PLAN – Institut für Architektur- und Umweltpsychologie, unter anderem über diese Problematik unterhalten und dabei gelernt: Architektur ist Kommunikation!
-
Herr Prof. Rambow, Sie haben sich erstmals während Ihres Psychologiestudiums mit Architekturkommunikation beschäftigt. Wie kam es dazu?
Während meines Studiums erlebte ich die Architekturpsychologie als aussterbende Nischendisziplin. Im Praktikum in einem Architekturbüro habe ich versucht, psychologische Forschung im Zuge eines Wettbewerbsverfahrens in Entwurfsprozesse einzubringen. Das war nur so halb erfolgreich, hat mich aber nie wieder losgelassen. Gegen Ende meines Studiums habe ich mich dann mit der sogenannten Expertiseforschung beschäftigt, mit der Frage des professionellen Wissens: Was wissen Expert*innen in unterschiedlichen Fächern? Dazu gibt es in der Psychologie eine relativ starke Forschungstradition, die von Gebieten wie dem Schachspiel, der Informatik und der Medizin ausgegangen ist. Ich übernahm diese Ansätze aus der Expertiseforschung und übertrug sie auf die Architektur, wo diese Tradition nicht bestand. An der Universität Frankfurt entwickelte ich mit meinem späteren Doktorvater eine kognitionspsychologische Theorie der Experten-Laien-Kommunikation. In der Experten-Laien-Kommunikation gibt es immer das Problem, dass zwei kognitiv sehr unterschiedlich ausgestattete Personen sich verständigen müssen. Die Expert*innen müssen das, was sie als solche ausmacht – etwa die Fachkonzepte und ihr differenziertes Wissen – auf eine Ebene der Alltagssprache heruntertransformieren. Dieses Problem hat eigentlich jede Disziplin, allerdings jeweils in spezifischer Ausprägung, die mit der Art und Struktur des Wissens zusammenhängt.
Können Sie das anhand eines Praxisbeispiels veranschaulichen
Betrachten wir die Virologie: Sie steht als naturwissenschaftliches Fach vor der Herausforderung, Kausalitäten zu kommunizieren. Virolog*innen wie Christian Drosten müssen vor allen Dingen die Unsicherheit, die in der Wissenschaft immer eine große Rolle spielt, so herunterbrechen, dass diejenigen, mit denen sie reden, wissen, was sie tun und was sie nicht tun sollen und davon auch überzeugt sind. Dazu sollten sie z. B. erfahren, wie bei COVID-19 die Ansteckungswege verlaufen. Die Laien müssen das nur soweit verstehen, dass sie zum Schluss kommen: Es überzeugt mich, also verhalte ich mich, wie die Expert*innen es empfehlen. Obwohl auch die besten Virolog*innen immer wissen, dass ihre Handlungsempfehlungen nie hundertprozentig durch Fakten abgesichert sind, müssen sie sich zu möglichst klaren Aussagen durchringen, denen die Laien vertrauen können. In der Architektur ist es nicht ganz einfach, solche Entsprechungen zu finden. Das hat unter anderem damit zu tun, dass visuelle Kommunikation eine bedeutende Rolle spielt. Architekt*innen beurteilen etwa als Jurymitglieder in einem Wettbewerb einen Entwurf mit den Urteilen „gute Lösung“, „schlechte Lösung“, „geht vernünftig mit dem Kontext um“, und betrachten das als „ganzheitliche“ Aussagen. Es ist dann aber sehr schwierig, diese Aussagen zu „entpacken“ und im Detail zu begründen. Das äußert sich in Juryberichten manchmal in Tautologien: „Das funktioniert, weil alle Funktionen erfüllt sind“, „die Lösung ist angemessen, weil die richtigen Entscheidungen getroffen wurden“. Es wird dann nicht mit inhaltlichen Begründungen, sondern mit solchen Allgemeinplätzen gearbeitet. Für erfahrene Architekt*innen haben solche Wahrnehmungen oft eine hohe spontane Evidenz, und es scheint dann nicht erforderlich, dass sie noch genauer erklärt werden sollten. Diese ganzheitliche Wahrnehmung komplexer Strukturen ist übrigens durchaus mit der Situation im Schachspiel vergleichbar
Welche Forschungsziele verfolgen Sie in der Architekturkommunikation?
Der erste Punkt in meiner Forschung, aber auch in der Lehre, ist immer der, den (angehenden) Architekt*innen klarzumachen, wie sehr sie bereits Expert*innen für ihr Gebiet sind. Sie selbst können meist nicht einschätzen, wie stark sich ihre Wahrnehmung im Laufe des Studiums, der Ausbildung und der Berufspraxis verändert hat. Ein*e Architekt*in, die sich ein Gebäude ansieht, hat nicht das gleiche Gefühl wie ein*e Chirurg*in, die sich unter dem Mikroskop eine hochkomplexe Gemengelage anschaut und sich sofort bewusst ist, dass das, was sie sieht, kein*e andere*r so sieht, geschweige denn erklären kann. Ein*e Architekt*in, der vor einem Haus steht, denkt auch spontan, da würden alle das Gleiche sehen. Aber schon unsere Wahrnehmung hängt extrem von unserem Vorwissen ab, z. B. über die Aufmerksamkeit, d. h. darüber, wohin wir wie genau schauen. Der zweite Punkt ist der, dass in den akademischen Diskursen häufig Widersprüche eingebaut sind: An den Hochschulen werden Architekturen ausgezeichnet, die bewusst auch provozieren, unbequem oder sperrig sind. Überspitzt gesagt: Unter den bestbewerteten Masterpräsentationen sind regelmäßig Arbeiten, bei denen ich mit ziemlicher Sicherheit einen Sturm der Entrüstung vorhersagen kann, würden sie realisiert. In der Architektur gibt es viele Konfliktfelder, die keine einfachen Lösungen haben. Ich wäre der letzte, der der Architektur diese Sperrigkeit austreiben wollte. Allerdings hat die Architektur die Kluft zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung über lange Zeiträume unterschätzt. Auf lange Sicht führt das zur Entfremdung vom eigenen Publikum. Unterm Strich muss es aber immer irgendeine Verständigung geben. Daran arbeite ich. Zu sagen, „Oje, keiner versteht mich, und das ist auch gut so“, ist die Todsünde der Architekturkommunikation. Man sollte jedem gegenüber die Bereitschaft aufbringen, zu erklären, warum man bestimmte Dinge tut oder sie nicht tut und was dabei die entscheidenden Qualitäten sind, auch und gerade gegenüber Menschen, die auf den ersten Blick ignorant, desinteressiert oder ablehnend erscheinen.
-
Welche Rolle spielt die Disziplin Architekturkommunikation im heutigen Architekturalltag? Füllen Sie mit Ihrem Beratungsbüro PSY:PLAN immer noch einen Nischenplatz aus oder haben Sie es mittlerweile mit stärkerer Konkurrenz zu tun?
Schwierige Frage. Mit Architekturvermittlung und -kommunikation beschäftige ich mich nun seit fast 25 Jahren. Ich würde sagen, die Aktivitäten auf dem Gebiet haben sich in dieser Zeit allgemein intensiviert. Gerade Österreich ist da relativ gut aufgestellt, mit der Österreichischen Gesellschaft für Architektur (ÖGFA), der Architekturstiftung Österreich und den Häusern der Architektur in allen Bundesländern als erfolgreiche Institutionen der Architekturvermittlung. Dieser Aktivitätenstrang hat sich etabliert. Auch in der Beschäftigung mit Architektur in der Schule, mit Kindern und Jugendlichen, sind die Aktivitäten auf moderatem Niveau verstetigt worden. Die Anzahl an Ausstellungen über Architektur hat ebenfalls deutlich zugenommen. Trotzdem ist die Architekturkommunikation immer noch ein Nischenfach. Auch in den Häusern der Architektur gibt es immer wieder Veranstaltungen, die rein auf ein Fachpublikum zugeschnitten sind. Eine breitenwirksame Ausstellung, etwa zum Schulbau, so zu gestalten, dass sie von 10.000 Grazer Bürger*innen – also allen, die von der Thematik eigentlich betroffen sind – besucht und diskutiert wird, ist immer noch fast unmöglich. In der Architekturkommunikation haben wir zudem immer die Schwierigkeit, uns gegenüber dem Marketing abzugrenzen. Das eine darf man nicht mit dem anderen verwechseln. Auf der Marketingebene ist es ab einer bestimmten Bürogröße selbstverständlich geworden, dass für die Öffentlichkeitsarbeit Profis eingestellt werden. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Auffassung, welche Rolle solche Kommunikationsspezialist*innen spielen sollten, sehr unterschiedlich ist. In der Regel besetzen sie eine spezialisierte Stelle, die „end of the line“ arbeitet. Da geht es z. B. um die Websitegestaltung und das Füttern des Instagram-Feeds, aber nicht wirklich um eine konzeptionelle Mitarbeit der Kommunikationsfachperson schon in den interessanten Phasen. Dass diese auch bei einem Wettbewerbsentwurf mitentscheiden kann und sagt, was sie darin aus Kommunikationssicht berücksichtigen würde, ist immer noch eine ganz seltene Ausnahme. Auch der an sich sinnvolle Gedanke, die Kommunikationsplanung als Chance zur Organisationsentwicklung des Büros zu nutzen, wird meiner Einschätzung nach viel zu selten verfolgt. Gleichzeitig muss man feststellen, dass Architektur, Städtebau und Baukultur allein von der finanziellen Ausstattung her nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. In Deutschland gibt es etwa die Bundesstiftung Baukultur als politisches Instrument, um den Dialog über Architektur auf eine breite Basis zu stellen. Sie macht auch sehr gute Arbeit, ist aber verglichen mit anderen Bundesstiftungen personell deutlich unterbesetzt
Es gibt also noch einiges zu tun. Wer sind dann in der Praxis Ihre Auftraggeber*innen?
Jene Art von Kommunikationsberatung, die ich mir bei der Gründung unseres Beratungsbüros ursprünglich vorgestellt habe, praktiziere ich eigentlich kaum. Wenn wir überhaupt in Planungsprozesse einbezogen werden, dann von Bauherr*innenseite. Architekt*innen hingegen sind schwierige Auftraggeber*innen, auch weil sie wegen des in der Ausbildung vermittelten Bildes der Alleskönner*innen und Generalist*innen das Gebiet der Architekturkommunikation selbst übernehmen möchten und einen Psychologen, der sie dort unterstützen könnte, oft eher skeptisch betrachten. Aber natürlich auch, weil die Budgets den Einbezug externer Fachleute nur schwer hergeben. Das ist immer noch eine Riesenhürde.
Kommen wir zu Ihrer Lehrtätigkeit am Karlsruher Institut für Technologie. In der Lehrveranstaltung „Architekturkommunikation und Soziale Medien“ haben Sie Formate wie Video-Blogs, Podcasts und Online-Foren analysiert. Kann man hier für die letzten Jahre gewisse Trends ablesen?
Wir haben die aktuellen medialen Möglichkeiten für Architekturkommunikation untersucht. Welche Rolle spielt Architektur im Augenblick auf Youtube, bei Podcasts oder auf Instagram? Welche Themen werden dort überhaupt vermittelt? Unsere Analyse hat gezeigt, dass Architektur dort, ähnlich wie schon früher im Fernsehen, eine relativ enge Nischenexistenz führt. Über das Abgleichen mit anderen Themengebieten haben wir Möglichkeiten analysiert, wie schnell und kostengünstig produzierbare Formate, z. B. Videos, in der Architekturvermittlung schon auf studentischer Ebene eingesetzt werden und so die Grenzen hin zur Öffentlichkeit erweitert werden können. Ein Podcast kann etwa für Architekturstudierende eine interessante Ergänzung oder ein Ersatz für die langsam aussterbenden Fachmagazine sein. Es gibt aber auch Formate, wo Leute in Drei-Minuten-Videos interessante Einblicke in ungewöhnlich gestaltete Wohnungen ermöglichen, die recht erfolgreich sind. Wir haben versucht, das Faszinationspotential von Architektur bei Laien auszuloten. Die Neugier und Motivation von Laien anzusprechen, macht ja auch Influencer*innen so erfolgreich. Könnte man sich so etwas auch auf einem Niveau vorstellen, auf dem der schmale Grat zwischen der Lebenswelt des Publikums und den kulturellen Interessen von Architekt*innen gehalten wird? Das Skizzieren birgt z. B. ein enormes Faszinationspotential: Man schaut den Architekt*innen über die Schulter, wie sie für bestimmte interessante Bauplätze Ideen aufzeichnen und später in die Tat umsetzen. Es muss also nicht notgedrungen eine TV-Heimwerkersendung sein
-
LAMA Magazin
LAMA – das lösungsorientierte Architekturmagazin – wurde im Sommer 2019 von vier jungen Grazer Architekturstudierenden konzipiert. LAMA hinterfragt die Architekturdisziplin in Lehre, Praxis und ihrem gesellschaftlichen Stellenwert. Über neun Ausgaben hinweg werden in einem dreijährigen Prozess Schritt für Schritt zukunftsorientierte Lösungsansätze für die Architektur formuliert. Dazu versammelt LAMA einen interdisziplinären Pool aus Expert*innen und Laien, die diese Lösungsansätze gemeinsam ausarbeiten. Als finale Zielsetzung wird ein „Handbuch für eine gesellschaftsbildende Architekturkommunikation“ verfasst, das die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse kompakt zusammenfasst.
LAMA ist die Nachfolgepublikation des SCHAURAUM. Architekturmagazins, das sich von 2016 bis 2019 in 6 Ausgaben verschiedensten Themen der Architektur kritisch gewidmet hat. SCHAURAUM.-Ausgaben könnt ihr weiterhin hier auf der LAMA-Website bestellen.
-
Ich denke tatsächlich, dass da eine ganze Menge Potentiale schlummern, die noch gehoben werden könnten. Die Architekturfotografie etwa: Wie kann man die Künstlichkeit von klassischen Architekturfotos erweitern, indem man dort das Prozesshafte stärker einbringt? Wie kann ich mich als Architekt*in auch als jemand darstellen, der oder die nicht eine vorgefertigte Lösung produziert, sondern mit den Bauherr*innen etwas gemeinsam entwickelt?
Die Kommunikation der eigenen Entwurfsprozesse ist ja schon im Architekturstudium ein großes Thema. Vielfach wird versucht, in der Endpräsentation eines Architekturprojekts einen möglichst linearen Entwurfsprozess darzustellen. Wo kann ein Lehrfach Architekturkommunikation hier Unterstützung bieten? Das nachträgliche Glätten des Entwurfsprozesses ist in der Kommunikation nach außen zumindest ein Stück weit sinnvoll bzw. sogar erforderlich. Laien sollte man die eigenen Irrungen und Wirrungen beim Entwerfen eher nicht zumuten, da sie das meist nur bedingt interessiert. Die Rekonstruktion des Prozesses in einer Art und Weise, dass er sinnvoll, nachvollziehbar und nicht zu kompliziert erscheint, ist eine der zentralen Aufgaben der Architekturkommunikation. Eine Entwurfspräsentation sollte wie eine gute, schlüssige Argumentation aufgebaut sein und für jede Entscheidung, die man thematisiert, sollte man gute Gründe nennen können. Das ist schon einmal das Erste, was die Studierenden in meinen Seminaren lernen. Das Zweite ist, dieser Argumentation eine narrative Struktur zu geben. Der Effekt des mentalen Konstruierens, in dem die vielen verschiedenen Anforderungen und scheinbaren Widersprüche elegant zu einer integrierten Lösung verbunden werden, ist wesentlich für eine spannende Geschichte, durch die Laien Entscheidungsprozesse in der Architektur besser verstehen können. Diese Geschichte gut zu erzählen ist oft mühsamer, als ein schickes Rendering zu präsentieren, aber sie ist eminent wichtig
Blicken wir in die Zukunft: Wie kann Architektur zukünftig (besser) vermittelt werden, wo gibt es das größte Entwicklungspotenzial?
Entwicklungspotenzial sehe ich ohne Ende. Ich verstehe Architekturkommunikation als ein ganz breites Feld, auf dem wir immer wieder Gelegenheiten nutzen und Bestehendes weiterentwickeln müssen. In Karlsruhe lehren und forschen wir in allen Bereichen der Architektur, von Ausstellungen über Soziale Medien bis hin zur Architekturkritik als Mittel der Kommunikation. Die starke Stellung, die Fachmagazine vor 20 Jahren noch hatten, gibt es nicht mehr. Heute nehmen die Studierenden über Architizer, Dezeen oder Archdaily quantitativ eine viel größere Bandbreite an Projekten wahr, Hunderte Bauten aus aller Welt täglich frei Haus. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, drei Seiten Text zu lesen. Solche Entwicklungen müssen wir in der Architekturkommunikation nachverfolgen und versuchen, praxistaugliche Lösungen anzubieten. Die Architekturkommunikation hat leider keine klare Struktur, es gibt keinen „Dachverband der Architekturkommunikator*innen“ oder ähnliches, und es beschäftigen sich in der Forschung leider immer noch viel zu wenige Personen damit. Meine Professur in Karlsruhe ist eine 50-%-Stelle, die zudem aus einer Stiftungsprofessur hervorgegangen ist. Dann gibt es noch Prof. Jan Krause, der an der Hochschule Bochum die Professur für Architektur Media Management innehat, und das war es in Deutschland auch schon. Vor zehn Jahren, zu Beginn meiner Zeit in Karlsruhe, habe ich gehofft, dass auch andere Hochschulen das Fach einführen würden, bislang ist das aber noch nicht geschehen.
Warum ist ein für die Berufspraxis wesentliches Fach wie die Architekturkommunikation in der Hochschullehre so unterrepräsentiert?
Das hat viele Gründe. Der wesentlichste Grund ist vermutlich, dass Kommunikation etwas ist, von dem wir alle glauben, dass wir es schon irgendwie hinbekommen. Man muss sich ja erst eingestehen, dass eine wissenschaftlich fundierte Architekturkommunikation den Studierenden etwas vermitteln kann, was die anderen Fächer, vor allem die Entwurfsprofessuren, nicht in gleicher Weise können. Die Zusammenarbeit mit Entwurfsfächern muss auch ich immer wieder neu verhandeln, da gibt es viele kritische Punkte, etwa die Verständlichkeit der Plandarstellungen und Visualisierungen, die Rolle von Darstellungstrends, ästhetischen Vorlieben etc. Das ist nicht einfach, denn nicht immer ist es möglich, zwischen Entwurf und Kommunikation sauber zu trennen, d. h. manchmal begebe ich mich auf das Feld des Entwurfs. Hierbei sind Fingerspitzengefühl und gegenseitiger Respekt erforderlich. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass bei den Studierenden eine sehr große Offenheit für das Thema besteht und auch die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen hervorragend funktioniert und sehr bereichernd ist. Das beste Beispiel hierfür ist die gemeinsame Betreuung von Masterarbeiten, die sich sowohl quantitativ als auch qualitativ fantastisch entwickelt. Ich glaube, da haben wir in Karlsruhe mittlerweile ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal. Ohne Zweifel würde sich manche Hochschule einen Gefallen damit tun, den Bereich Architekturkommunikation ein bisschen stärker in der Lehre zu thematisieren. Untersuchungen zeigen, dass Architekt*innen zwischen 60 und 80 Prozent ihrer Zeit im Büro mit Kommunikation verbringen – etwa mit Bauherr*innen, Fachplaner*innen, Handwerker*innen, auf Bürgerversammlungen … Architektur ist Kommunikation. Entwürfe müssen kontinuierlich und konsequent vermittelt und verhandelt werden, wenn sie realisiert werden sollen. Diese Kommunikation ist nicht immer konfliktfrei und sie ist nicht immer erfolgreich, aber man muss sich ihr stellen und zwar offensiv, also mit dem Willen, die Kommunikation aktiv zu gestalten, sodass sie die eigenen architektonischen Ideen stärkt. Auf diese Herausforderung müssen wir die Studierenden vorbereiten, so gut es geht. Ansonsten droht der Praxisschock, und das bedeutet Frustration und nicht selten Flucht in den Zynismus, was für die Baukultur oft die größte Katastrophe ist.
Vielen Dank für Ihren Einblick in die Welt der Architekturkommunikation!
-
Felix Obermair hat in Graz und Mailand Architektur studiert. Seiter arbeitet er als Projektleiter beim Bozner Buchverlag Edition Raetia. Architektur und Verlagswesen verbindet sein Engagement bei LAMA, dem lösungsorientierten Architekturmagazin.
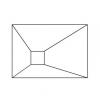

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.