Das Ende der „Virologokratie“
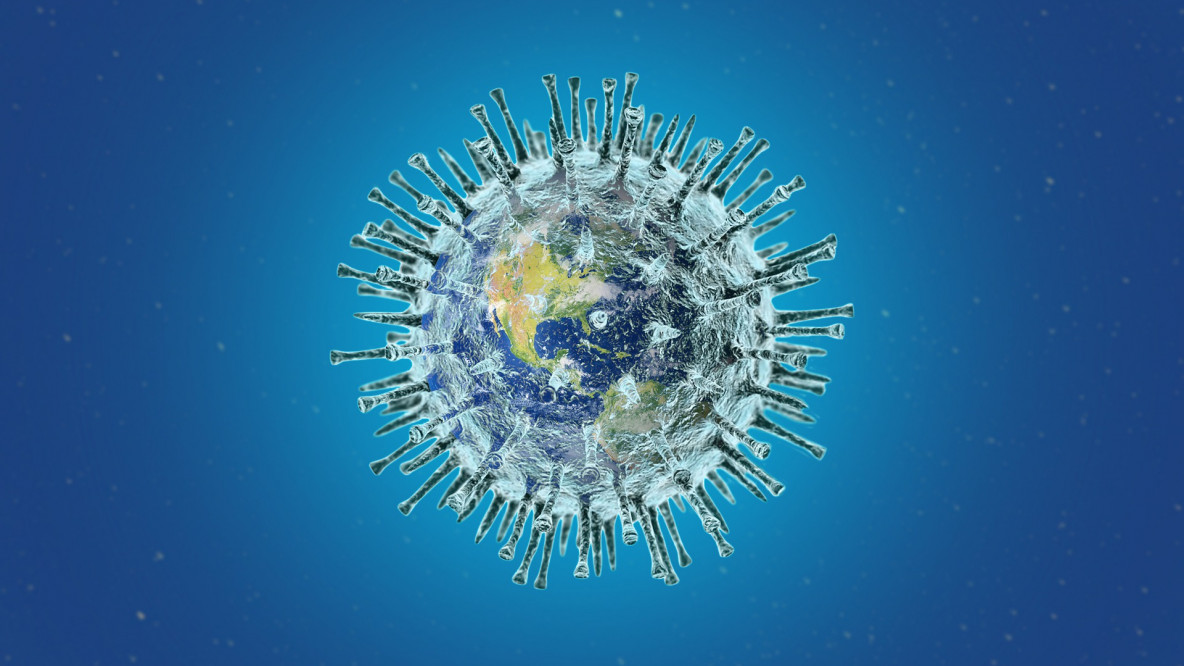
Bisher waren Virologen, Epidemiologen und Immunologen die stillen Dirigenten in dieser Krise. Ihre Dienste waren wichtig, doch die Krise hat schon längst keine rein medizinische Dimension mehr. Nun sind andere Qualitäten gefragt. Eine Replik auf den Beitrag „Covidioten an die Macht!“.
Wir gehen gerade in „Phase 2“ über, erste Lockerungen stehen an. Viele begrüßen das, aber längst nicht alle. Das ist einerseits verwunderlich und andererseits auch nicht. Denn die Angst vor Corona ist bei vielen nach wie vor groß. Und in der Tat sollte das Virus nicht unterschätzt werden. Immerhin hat Covid-19 bisher über 160.000 Menschen das Leben gekostet und einige werden noch dazu kommen.
Mediziner und Wissenschaftler haben uns dabei geholfen, die Gefährlichkeit des Virus einzuschätzen. Auch wenn noch viele Daten fehlen und das endgültige Ausmaß von Corona erst hinterher bekannt sein wird, haben wir inzwischen so einiges über den neuen Erreger gelernt.
Wir wissen nun um seine Tücken. Das Virus verbreitet sich rasant, die Inkubationszeit kann lang sein und auch asymptomatische Träger sind hoch infektiös. Auch scheint der Verlauf von Covid-19 aggressiver zu verlaufen als bei einer herkömmlichen Grippe. Und nicht zu vergessen, gibt es noch kein probates Medikament und auch keinen Impfstoff.
Wir wissen aber auch, wer zu den besonders Gefährdeten gehört. Die Risikogruppen sind mittlerweile klar abgesteckt. Dass das Virus in seltenen Fällen auch für leidlich gesunde und jüngere Menschen gefährlich sein kann, ändert daran nichts. Aber auch, dass es sich bei dem Virus weder um die Pest noch um Ebola handelt, dürfte inzwischen klar sein.
Diese wichtigen Erkenntnisse haben wir den Virologen und anderen Wissenschaftlern zu verdanken. Ihr Verdienst ist löblich und unser Dank gebührt ihnen zurecht.
Dass man sich als Staatführung zu Beginn der Krise stark auf die Expertise von Wissenschaftskoryphäen verlassen musste, ist nur allzu verständlich. Denn niemand ist ernsthaft auf eine Epidemie vorbereitet - weder das Gesundheitssystem noch die Politik und eine Gesellschaft schon gar nicht.
Doch auch wenn diese Epidemie vermutlich erst am Anfang steht, ist es an der Zeit, dass sich die Staatsmänner wieder des eigentlichen Wesens ihrer Kunst gewahr werden.
Im Dialog Politikos veranschaulicht Platon die Staatskunst am famosen Weber-Gleichnis.
„Die Staatskunst ist gleichsam eine königliche Zusammenflechtung, die ein Gewebe liefert“ und weiter heißt es „Seine (des Staatsmannes) Aufgabe ist nicht eine besondere Verrichtung, sondern die Koordination, die umfassende Planung und die Lenkung des Ganzen“.
Zugegeben, der Text mag alt sein. Doch scheint er gerade angesichts der sich manifestierenden Komplexität der Krise, aktueller denn je. Denn inzwischen sollte klar sein, dass diese Krise schon längst keine rein medizinische mehr ist, sondern auch verheerende soziale, ökonomische, psychologische und gesellschaftspolitische Folgen hat und haben wird. Fragen der Verhältnismäßigkeit werden lauter. Die Unruhe des Volkes wächst. Nun ist politische Weitsicht gefragt.
Wer glaubt, es handle sich derzeit um einen reinen Interessenskonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft, der irrt. Wer glaubt, der Stillstand des öffentlichen Lebens hätte keine gesundheitlichen Folgen, irrt ebenso. Denn auch an der Wirtschaft hängen Leben und auch soziale und körperliche Nähe sind für unsere Gesundheit unentbehrlich.
Doch wie groß ist das Maß an Belastung, das einer Gesellschaft in dieser Krise aufgebürdet werden darf? Kann der gebotene Schutz für das Leben absolut sein? Darf das Wohl Vieler zugunsten der Gesundheit Weniger geopfert werden? Wann wird das Maß der Verhältnismäßigkeit der derzeitigen Maßnahmen gesprengt? Haben der soziale und wirtschaftliche Kollaps letztendlich nicht auch gesundheitliche Folgen? Inwieweit hängt ein effektives Gesundheitssystem an einer funktionierenden Wirtschaft? Wie wirkt sich der derzeitige Rigorismus auf unser politisches Selbstverständnis und unsere liberalen Demokratien aus?
Dass Virologen und Mediziner bei diesen Fragen lavieren, sollte nicht verwundern. Wie sollten sie auch anders, ihre Domäne ist fachspezifisch, die des Staatsmannes interdisziplinär. Der Fachspezialist sieht die Momentaufnahme, der Staatsmann das, was kommt. Der Wissenschaftler zieht medizinische, der Staatsmann aber politische Schlüsse. Zumindest wäre es so gedacht.
Der Fachspezialist, zu dessen Zunft zweifellos auch Mediziner und Virologen gehören, sieht das Leid, das Corona in den Krankenhäusern anrichtet. Er sieht die Sterbenden und Kranken – und das schmerzt. Ironischerweise ist es gerade deshalb wichtig, nun nicht mehr Virologen und Ärzten den Führungsstab zu überlassen. Denn aus der rein ärztlichen oder virologischen Perspektive lässt sich kein objektiver Blick auf diese Krise gewinnen. Der medizinisch-wissenschaftliche Mikrokosmos, in dem Ärzte, Virologen und Immunologen verkehren, führt zwangsläufig zu einer monodimensionalen Sicht auf diese Krise. Freilich ist das nicht ihre Schuld, sondern es ist nur allzu natürlich.
Aber gerade deswegen ist es nun unerlässlich, dass sich die politische Führung ihrer ursprünglichen staatsmännischen Qualitäten erinnert und die gesamte Dimension der Krise im Blick behält.
Die anstehenden Lockerungen scheinen jedenfalls darauf hinzudeuten. Man darf dennoch gespannt sein, wie es weiter geht. Denn die Gefahr der gefürchteten möglichen zweiten Welle ist keineswegs gebannt.
Ob die Staatsmänner sich der Staatskunst dann erneut erinnern werden oder aber das Zepter wieder aus der Hand geben, wird sich zeigen. Die Folgen könnten dann allerdings fatal sein und zu einer noch größeren humanen Katastrophe führen als eh schon.
Vielleicht trifft es aber auch zu, was der große Denker Giorgio Agamben unlängst zur Corona-Krise schrieb: „Offensichtlich ist es so, dass es die Seuche irgendwie, wenn auch nur unbewusst, bereits gab.“
Diese interdiszipläre
Diese interdiszipläre Sichtweise auf die Krise, sehe ich mittlerweile auch dringend notwendig und wünschenswert. Es sind mittlerweile auch viele andere Parteien in diese Krise involviert. Daher ist dieser Beitrag wichtig, gerade jetzt. Danke dafür.
PS.: Herr Widmann ich dachte ja, Sie hätten sich nach Ihrem ersten Artikel auf Salto.bz, von hier verabschiedet. Ich bin froh, dass es nicht so ist.
Antwort auf Diese interdiszipläre von Oberhofer Franz
Dem will ich mich anschließen
Dem will ich mich anschließen!
Koordinierung und
Koordinierung und Interessenausgleich sind komplexe und herausfordernde Aufgaben für die Politik. Das Problem aus der Sicht der Allgemeinheit ist, dass gerade in Ländern mit populistischen Parteien in der Regierungsverantwortung die politischen Führungskräfte zumindest teilweise nicht über die notwendige Ausbildung in Fachbereichen und die Führungskompetenzen verfügen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Häufig werden politische Reformen und Maßnahmen durchgeboxt, die nicht dem Allgemeininteresse entsprechen und anstatt eine valide Entwicklungsperspektive zu eröffnen irgendwelche Partikularinteressen bedienen. Dabei setzen sich politische Entscheidungsträger allzu gern und mit arroganter Berufung auf den WählerInnenauftrag über die Ratschläge von Fachleuten und die Evidenz von Statistiken hinweg. Die Politik ist auf die Expertise von Fachleuten angewiesen. Deshalb ist es nicht angebracht, diese beiden Akteure gegeneinander auszuspielen. Es braucht eine konstruktive Zusammenarbeit im Interesse des Allgemeinwohls. Zur Wiederherstellung des Vertrauens der Bevölkerung in die Politik ist mehr Transparenz in den Prozess der Meinungsbildung zu bringen. Für die Bürgerinnen und Bürger sind die Ziele, Lösungsoptionen und Argumente nachvollziehbar zu machen, die der politischen Entscheidung vorausgehen.
Im Beitrag steht:
Im Beitrag steht:
„ Der Fachspezialist, zu dessen Zunft zweifellos auch Mediziner und Virologen gehören, sieht das Leid, das Corona in den Krankenhäusern anrichtet. Er sieht die Sterbenden und Kranken – und das schmerzt. Ironischerweise ist es gerade deshalb wichtig, nun nicht mehr Virologen und Ärzten den Führungsstab zu überlassen. Denn aus der rein ärztlichen oder virologischen Perspektive lässt sich kein objektiver Blick auf diese Krise gewinnen. Der medizinisch-wissenschaftliche Mikrokosmos, in dem Ärzte, Virologen und Immunologen verkehren, führt zwangsläufig zu einer monodimensionalen Sicht auf diese Krise. Freilich ist das nicht ihre Schuld, sondern es ist nur allzu natürlich“:
Es ist davon auszugehen, dass Sie sich nicht informiert haben, wie interdisziplinär die Beraterstäbe von z.B. Merkel, Kurz, Macron, Conte zusammengesetzt sind, oder beispielhaft der deutsche Ethikrat oder die Leopoldiana. Dies zeigt, dass Ihr Beitrag nicht der Realität folgt, sondern polarisieren will zwischen hier Medizin und dort Ökonomie.
Was sagt eine der bedeutendsten Politikerinnen (nicht Virologin) gerade jetzt:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-angela-merkel-wa…
zudem:
https://www.spiegel.de/politik/corona-und-wege-aus-dem-lockdown-wir-bra…
Ich habe auch einige konkrete Fragen, da der Autor ja im Ressort Gesundheit arbeitet:
1. Ist Südtirol bereits im Containment, oder immer noch in der Mitigation?
2. Sind genügend Ressourcen und Tests vorhanden, um jedem Infektionsfall nachzugehen, und alle Kontaktpersonen nachzuverfolgen?
Man liest dazu nirgends etwas: über Transparenz und Information bin ich dankbar.
Zudem sei bemerkt, dass die Politiker großteils diese Katastrophe mitverursacht haben, daher liegt das Vertrauen doch stärker bei den Wissenschaftlern:
https://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=55426
Antwort auf Im Beitrag steht: von Peter Gasser
Diesem Kommentar von P.G.
Diesem Kommentar von P.G. schließe ich mich an. Auch würde mich eine konkrete Beantwortung der Fragen 1 und 2 in Bezug auf die derzeitige Corona-Seuche, die uns noch lange „begleiten“ wird, sehr interessieren.
Antwort auf Im Beitrag steht: von Peter Gasser
Ich finde diese Argumentation
Ich finde diese Argumentation ebenfalls unsinnig. Wenn man die Verflechtungen von Politik und Wirtschaft kennt, muß man sich überhaupt keine Sorgen machen dass deren Stimme nicht genug gehört wird.
Ich möchte auch kurz den
Ich möchte auch kurz den letzten Satz von Philosoph Giorgio Agamben aufnehmen:
Giorgio Agamben konnte letzthin seine Befriedigung darüber kaum unterdrücken, seine *lang vertretene Theorie des Ausnahmezustands* seiner Meinung nach bestätigt zu sehen.
Weiters fand ich: „Auch in anderen Beiträgen versteigt sich Agamben in allerhand gewagte Thesen wie diejenige, die Notstandsmaßnahmen seien “völlig unbegründet„ ((das sind sie natürlich nicht)). Ungeachtet all der zwischenmenschlichen Solidarität, die wir in der Krise aufleben sehen, behauptet Agamben, unsere Gesellschaft glaube an nichts mehr außer an das “nackte Leben", und prophezeit, der Ausnahmezustand werde auch nach der Epidemie fortdauern ((das wird er natürlich nicht)).
Dem unvermeidlichen Slavoj Zizek gelang eine in Teilen erfreuliche Antwort, in der er darauf verweist, dass das Virus keine von Politikern zu Zwecken der Machterweiterung erdachte Konstruktion ist. Kommentatoren wie Agamben „blenden den Realitätsgehalt der Gefahr“ vollständig aus, so der slowenische Philosoph. Ein angesichts der gängigen, auch von Agamben vertretenen Verharmlosung, die Covid-19-Pandemie wäre einer normalen Grippewelle vergleichbar, durchaus notwendiger Hinweis".
Antwort auf Ich möchte auch kurz den von Peter Gasser
Mh, ich denke der Autor
Mh, ich denke der Autor schreibt diesen Beitrag in Anbetracht der Gefahr einer möglichen zweiten Welle, was ja mit den Lockerungen durchaus passieren könnte. Und dann ist es eben wichtig, nicht mehr zu sehr nur auf die Mediziner zu hören, sondern auch die anderen Interessen der Gesellschaft im Blick zu haben. Leopoldiana ist sicher ein guter Ansatz wie ich finde, das könnten wir hier auch gebrauchen.
Das mit dem “destruktiven
Das mit dem „destruktiven Potenzial einer kollektiven gesellschaftlichen Mentalität“ sehe ich auch so, und ist (leider) mit schrecklichen Beispielen verbunden. Man denke nur an die Judenverfolgungen (Brunnenvergifter) und Frauenverbrennungen (Hexen) aus „kollektiver gesellschaftlicher Mentalität“ heraus in früheren Zeiten von Seuche und Gefahr.
Aus naturwissenschaftlicher Sicht sehe ich den Weg bei uns jetzt etwas leichtfertig, da es keine Transparenz gibt, wo wir uns gerade seuchenmäßig befinden. Bei manchem Politiker hört es sich so an, als sei alles längst vorbei - und das kann eine völlig falsche Erwartungshaltung in der Bevölkerung schaffen, welche dann zu Frust und in der Folge zu „destruktivem Potenzial einer kollektiven gesellschaftlichen Mentalität“ führen kann und führen wird.
Wirklichkeit aber ist:
das Virus ist da;
das Virus lauert und wird erbarmungslos explodieren, wenn wir weiterhin Fehler machen;
Zum Philosophisch-Ethischen, Herr Widmann (ich bin nur an informativer Diskussion interessiert, sollte ich „offensiv“ geklungen haben, sehen Sie mir das nach, es war dann wohl in einem Augenblick des Entsetzens), finde ich, dass es den Wert einer Gesellschaft ausmacht, wie diese mit den Armen, Kranken und NOTleidenden umgeht. Kultur bedeutet doch, sich um den Nächsten zu kümmern, und n i c h t, diesen zu opfern, ganz gleich für welchen Vorteil auch immer.
Das stehen wir zusammen durch, wir schaffen das (und ich gebrauche dieses Schlagwort jetzt ganz bewusst) - und wenn dadurch Schwächen, Fehler, Fehlentwicklungen sichtbar werden, dann wissen wir, was wir in Zukunft ändern müssen.
Egal was passieren wird: das
Egal was passieren wird: das Virus ist naturwissenschaftlich einfach zu berechnen, letzten Endes wird ein Impfstoff entscheiden, ob es gebändigt wird. Dieser Winzling zeigt die Zerbrechlichkeit dieses herrschenden Wirtschaftssystems, daran werden die Staatsmänner - schon gar nicht mit klassischen Regeln - nichts Wesentliches ändern können. Unsere Staatsmänner haben uns dieses Wirtschaftssystem schön präsentiert, jetzt erleben wir ein Desaster. Wir Menschen werden locker & selbständig denken und sie überreden müssen, es gründlich zu ändern. Und zwar solidarisch, mit dem Ziel des Gemeinwohls und nicht dem des individuellen Reichtums einer Elite.
Ich sehe dies so, dass die 2.
Ich sehe dies so, dass die 2. Welle eine unverrückbare Tatsache ist.
Es liegt aber an uns, wie drastisch oder wie leicht diese ausfallen wird.
Öffnen wir in der Phase der Mitigation, wird die folgende Welle drastisch ausfallen und der nachfolgende Frust wird groß sein;
warten wir die Phase des Containments ab und sichern die notwendigen Begleitmaßnahmen, wird der Erfolg des bisherigen lockdowns nachhaltiger sein.
Angesichts dessen, was in Gröden geschieht, erscheint es eher nicht so, dass wir diese Geduld aufzubringen vermögen.
Ich möchte nur diesen einen
Valentin Widmann schreibt in seinem Beitrag: „Dass man sich als Staatführung zu Beginn der Krise stark auf die Expertise von Wissenschaftskoryphäen verlassen musste, ist nur allzu verständlich.“
Dafür habe ich Verständnis. Dass aber die Expertisen und Emphehlungen dieser Wissenschaftskoryphäen nie kritisch hinterfragt wurden, dass unsere Führungen in Rom und Bozen offensichtlich nicht einen einzigen Gedanken daran verschwendet haben, dass diese wenigen Koryphäen vielleicht auch (teilweise) falsch liegen könnten, zeugt von großer Fahrlässigkeit und wenig Verantwortungsbewußtsein.
Haben wir irgendwann einmal davon gehört, dass die Theorien und Empfehlungen der verschiedenen „Covid Task Forces“ durch externe Fachleute kritisch überprüft wurden, und zwar im Auftrag der Regierung? Bei so einschneidenden Maßnahmen darf ich mich doch nicht auf ein paar wenige Experten verlassen!
Einen Überblick, wie viel Kritik mittlerweile von ebenfalls renommierten (Medizin)Wissenschaftlern SEIT WOCHEN geübt wird, aber leider kaum wahrgenommen wird, findet sich hier:
Weltweite Warnungen - International kritisieren Wissenschaftler, Ärzte, Juristen und andere Experten den Umgang der Regierungen mit dem Coronavirus.