Wir sind Teil der Lösung

-
-
Aber die Daten sind vielleicht nicht so eindeutig, wie es Herr Benedikter in seinem Beitrag vom 07.02.2024 darstellt. Was immer wieder auffällt, ist die einseitige Auslegung des komplexen Prozesses der Herstellung von notwendigen Nahrungsmitteln. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass in einigen Punkten die Landwirtschaft wissentlich in ein schlechtes Licht gerückt werden soll und Fakten verdreht dargestellt werden.
Die umfangreiche Subventionierung der Landwirtschaft ist dahingehend als Notwendigkeit zu betrachten, dass dadurch verhältnismäßig günstige Lebensmittel am Markt verfügbar sind. Nur so war es möglich, dass in den letzten Jahrzehnten der Einkommensanteil, welcher für Lebensmittel ausgegeben wird, laufend zurückgegangen ist, und der heute in Europa vorhandene Lebensstandard finanzierbar wurde. Ohne Subventionierungen wären Preise für Lebensmittel um ein Vielfaches höher, womit vor allem einkommensschwache Bevölkerungsschichten benachteiligt wären, denen die Subventionen so als indirekte Einkommensstütze dienen. Wir geben in Südtirol nur noch 12% unseres Einkommens für Lebensmittel und Getränke aus, aber fast 50% für Wohnen und den damit zusammenhängenden Kosten.
Wie jeder andere Wirtschaftszweig auch verursacht auch die Landwirtschaft Emissionen. Gleichzeitig ist sie aber der einzige Wirtschaftszweig, der auf natürlichem Wege auch zu dessen Bewältigung beitragen kann. Der einfachste, günstigste und einzige natürliche Weg CO2 aus der Atmosphäre zu binden, geschieht nämlich im Zuge des Pflanzenwachstums durch die Photosynthese, wobei auch Sauerstoff entsteht. Diese elementaren Zusammenhänge müssen wir bei allen Überlegungen im Hinterkopf behalten. Aber auch die Tierhaltung ist als unverzichtbarer Zweig zu betrachten, da rund 70% der landwirtschaftlichen Nutzflächen weltweit als nicht ackerfähig gelten, womit vor allem die Haltung von Wiederkäuern durch ihre Fähigkeit faserhaltige Futtermittel zu verdauen alternativlos zur Ernährung der Weltbevölkerung beiträgt. In dieser Hinsicht müssen Emissionen, welche in der Landwirtschaft entstehen, immer in Relation mit deren Ökosystemdienstleistungen gesehen werden. Ein Punkt, welcher in heutigen Klimabilanzierungen häufig nicht berücksichtigt wird.
Weiters kann die Aussage, wie sie auch im Klimaplan verankert ist, dass Heumilch in ihrer Erzeugung 25% weniger CO2-Äquivalente pro kg Milch ausstieße, durchaus angezweifelt werden. So belegen viele wissenschaftliche Untersuchungen das Gegenteil, womit die Formulierungen des Klimaplans eher ideologisches Wunschdenken als eine fachlich begründete Strategie darstellen. So schreibt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Deutschland, dass Treibhausgasemissionen je kg Milch durch die Erhöhung der Milchleistung, wie sie mit intensiveren Produktionssystemen einhergeht, durch die verbesserte Effizienz reduziert werden. Außerdem zeigen zahlreiche Untersuchungen aus dem norditalienischen Raum (z.B. Gislon et.al.), dass mit Südtirols konventioneller Bewirtschaftungsweise vergleichbare Betriebe in etwa dieselben Emissionen je kg Milch (fett- und proteinkorrigiert, FPCM) ausstoßen als Heumilchbetriebe. Durch eine kontinuierliche Verbesserung der Grundfutterqualitäten, wie sie auch in Südtirol zunehmend angestrebt wird, können die Emissionen im Vergleich zur extensiveren Heumilchwirtschaft um bis zu 15% je kg Milch gesenkt werden.
Werden die Treibhausgasemissionen der Milcherzeugung nicht mit Bezug auf den kg Milch, sondern den Quadratmeter landwirtschaftliche Nutzfläche betrachtet, mag es durchaus stimmen, dass die Heumilcherzeugung einen geringeren klimatischen Fußabdruck aufzuweisen scheint. Erklärbar ist dies mit dem einfachen Fakt des reduzierten Ressourceneinsatzes. Allerdings ist diese Strategie nicht zielführend, solange die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen nicht in gleichem Umfang sinkt. Ansonsten wird die Produktion einfach in andere Betriebe/Länder verschoben, was ausschließlich zu einer Verlagerung der Emissionsproblematik, nicht aber zu einer wirklichen Reduzierung führt.
Aber nur damit keine Zweifel aufkommen: wir stehen zur Heumilch, und wenn der Markt dafür bereit ist zu zahlen, werden die Betriebe frohen Mutes auf die Heumilchproduktion umsteigen. Aber ausschließlich mit der CO2-Diskussion lässt sich dieser Umstieg nicht rechtfertigen.
Es ist auch sinnlos, eine kontinuierliche Reduktion der Tierbestände als Ziel zur Emissionsminderung zu betrachten: abgesehen von den Emissionen, die damit nur verlagert und nicht verhindert werden, verschwindet damit die Viehhaltung, womit die vielfach nicht ackerfähigen Flächen Südtirols (85% der Flächen) ihre Nutzung verlieren und somit verwildern. Das endet unweigerlich in einem Verlust der Kulturlandschaft und Biodiversität, denn eines dürfte doch klar sein: die ersten Flächen, die verschwinden werden, sind jene, die extensiv und schwierig zu bewirtschaften sind.
Hinsichtlich der Auszahlungspreise für Milch wurden diese in den letzten Jahren in der Tat angehoben, gleichzeitig sind die Kosten für Produktionsmittel jedoch unverhältnismäßig stärker angestiegen, womit sich die Wirtschaftlichkeit nicht verbessert hat. Erst langsam scheint sich diese Situation wieder zum Besseren zu wenden. Auch ein Vergleich der reinen Auszahlungspreise mit anderen Ländern hinkt in dieser Hinsicht, da Produktionsbedingungen und -kosten nicht vergleichbar sind. Wird somit durch die zunehmend schwierigere Wirtschaftlichkeit – wobei der zusätzliche Druck über Klimamaßnahmen auch nicht hilfreich ist – ein Höfesterben hingenommen, ist dies nicht nur „schade“, sondern eine ernsthafte Bedrohung für die Südtiroler Kulturlandschaft. Rein durch die Bewirtschaftung und Pflege von Wiesen und Weiden werden diese nämlich offengehalten. Nur so kann die äußerst vielfältige und sowohl für die eigene Lebensqualität als auch den Tourismus wertvolle Kulturlandschaft als wichtigstes Kapital Südtirols langfristig erhalten werden.
Die angesprochene erhoffte Bereitschaft des Konsumenten, mehr für landwirtschaftliche und vor allem für tierische Produkte auszugeben, ist dabei anstrebenswert, allerdings nicht im Sinne von Mehrausgaben für einen verstärkten Verzehr tierischer Produkte. Dies wäre aus Sicht einer nachhaltigen Ernährung in der Tat kontraproduktiv. Diese Mehrausgaben sollen viel mehr den notwendig höheren Preis für ein hochwertiges und nachhaltig erzeugtes Produkt direkt vom Bauern und von unseren Genossenschaften bezahlen und somit die lokale Landwirtschaft unterstützen, anstatt durch Billigprodukte vom Discounter die Verlagerung ins Ausland zu fördern. Die Landwirtschaft kann nur das produzieren, was gekauft wird. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft.
Abschließend muss hervorgehoben werden, dass die Landwirtschaft in keinster Weise pauschal gegen Veränderungen im Produktionssystem gesinnt ist, solange diese mit dem Erhalt einer gesicherten Einkommensgrundlage vereinbar sind. Die Landwirtschaftspolitik darf nicht nur bis zum Acker und der Wiese, sondern muss bis zum Teller reichen. Dazu ist es gerade für unsere familiengeführten Kleinbetriebe unausweichlich, dass notwendige Schritte im Dialog mit den Landwirten selbst ausgearbeitet werden und Mehraufwände in den Produktionskosten durch zusätzliche Einkommensmöglichkeiten kompensiert werden können. Nur dann wird die Landwirtschaft zu einem echten Innovationsträger werden und die Herausforderungen meistern.
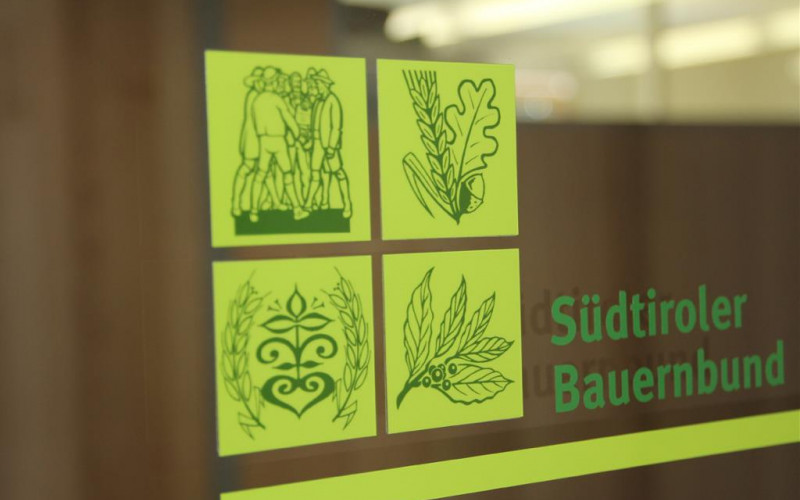
"Diese Mehrausgaben sollen…
„Diese Mehrausgaben sollen viel mehr den notwendig höheren Preis für ein hochwertiges und nachhaltig erzeugtes Produkt direkt vom Bauern und von unseren Genossenschaften bezahlen und somit die lokale Landwirtschaft unterstützen, anstatt durch Billigprodukte vom Discounter die Verlagerung ins Ausland zu fördern. Die Landwirtschaft kann nur das produzieren, was gekauft wird. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft.“
Das ist der springende Punkt: Raus aus dem „billigen“, bzw. industriellen Gedanken und hin zu einer „KM-0“ bzw. BIO/Herkunft Südtirol. Wenn ich mir so die Schweiz ansehe und anhöre, gibt es dort ein entsprechendes Grundverständnis dafür (das „BIO Schweiz“ ist dem „BIO EU“ z.B. überlegen) - bei uns würde das meiner Meinung nach heißen, wir nehmen uns die EU-Subventionen zur (industriellen) Landwirtschaft und machen etwas autonomes, für unsere alpine Landwirtschaft daraus. Dieser erste Schritt in Richtung mehr Autonomie impliziert auch weitere ökonomische Elemente, die wir übernehmen sollten, um den „Spiegel der Gesellschaft“ zu korrigieren - darauf einzugehen würde allerdings den Rahmen eines Kommentars sprengen.
Zitat: „Wenn ich mir so die…
@ Pasqualino Imbemba:
Zitat: „Wenn ich mir so die Schweiz ansehe und anhöre, gibt es dort ein entsprechendes Grundverständnis dafür (das “BIO Schweiz"...):
für regional ja, aber in der Schweiz ist auf basisdemokratischer Weise durch Mehrheitsentscheidung des Volkes (der Konsumenten) in den letzten Jahren 2 mal ein Referendum gescheitert, das ein Verbot der Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel mit gleichzeitigem Handelsverbot solcherart erzeugter Produkte forderte:
"Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: Art. 74 Abs. 2bis:
Der Einsatz synthetischer Pestizide in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Landschaftspflege ist verboten. Die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken von Lebensmitteln, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt worden sind, ist verboten":
das Volk hat basisdemokratisch mehrheitlich abgelehnt, auch das im Kommentar erwähnte „Bio Schweiz“ hatte sich dagegen ausgesprochen.
Antwort auf Zitat: „Wenn ich mir so die… von Peter Gasser
Danke für die Info. Hier ein…
Danke für die Info.
Hier ein Vergleich zu den BIO Auflagen Schweiz vs. EU: https://www.bio-suisse.ch/dam/jcr:f4b59c14-7e8c-4e7b-abd0-7a2412ae317d/…
Das Thema BIO ist aber nur ein Teil der gesamten Antwort. Ein weiterer liegt in anderen Bereichen der Ökonomie bzw. Politik.
Antwort auf Zitat: „Wenn ich mir so die… von Peter Gasser
"das Volk hat…
„das Volk hat basisdemokratisch mehrheitlich abgelehnt,“
Auch wenn das Ihr Lieblingsargument ist verzehrt es völlig die Sichtweise und soll uns suggerieren das der Verbraucher Schuld ist.
Bei detaillierter Betrachtung ergibt sich ein anderes Bild, die Schweiz hat weltweit die höchsten Agrarsubventionen, ca. 3,7 Milliarden bei knapp 9 Millionen Einwohner ergibt sich eine pro Kopf Subvention von ca. 400 €, zum Vergleich in Deutschland kommen wir auch auf beachtliche 100 € pro Kopf. (EU 6 Milliarden + nationale 2 Milliarden Subventionen)
Aufmerksamen Marktbeobachtern wird nicht entgangen sein dass zu dieser Abstimmung eine massive mediale Kampagne von Agrar + Chemielobby zusammen mit der Politik gefahren wurde und dadurch das Wahlverhalten entscheidend beeinflusst wurde. Hier griffen dann auch die üblichen Mechanismen welche solche exorbitanten Subventionen bei den Empfängern auslösen und führen dann auch zu solchen Zuständen
-> „ Viele haben verstanden, dass die großen Proteste meist von großen Interessen geleitet, wenn nicht manipuliert werden. Die meisten Subventionen (80%) gehen an die großen Betriebe (20%), “
Antwort auf "das Volk hat… von Stefan S
Zitat: „Auch wenn das Ihr…
Zitat: „Auch wenn das Ihr Lieblingsargument ist verzehrt es völlig die Sichtweise und soll uns suggerieren das der Verbraucher Schuld ist“:
„verzehrt“ wird hier gar nix (auch nicht ‚verzerrt‘), und „das der Verbraucher“ benötigt keine 2 Artikel („der Verbraucher“);
es gibt weder „Lieblingsargument“, noch „Schuld“, sonder Information (durch den Kommentar) und Entscheidung (durch den Bürger).
.
Entscheidet der Bürger in Ihrem Sinne, war er reif und selbstbestimmt, entscheidet er nicht in Ihrem Sinne, war er von der Lobby verführt - so kann man nicht argumentieren, meine ich.
Die basisdemokratische Entscheidung der Bürger ist deren basisdemokratische Entscheidung und damit deren Verantwortung.
Antwort auf Zitat: „Auch wenn das Ihr… von Peter Gasser
"Entscheidet der Bürger in…
„Entscheidet der Bürger in Ihrem Sinne, war er reif und selbstbestimmt, entscheidet er nicht in Ihrem Sinne, war er von der Lobby verführt - so kann man nicht argumentieren, meine ich.“
Bitte nicht Dinge mir zuschreiben welche in Ihren Gedanken erscheinen.
Natürlich akzeptiere ich die demokratisch herbei geführte Entscheidung, deswegen darf man sich trotzdem darüber Gedanken und recherchieren wie es zu diesem Entscheid kam.
Insbesondere vor dem Hintergrund dass wir das Zeitalter der Aufklärung mit großen Schritten verlassen und der Lobbyismus und Populismus immer mehr um sich greift.
Konstruktiver Artikel! Was…
Konstruktiver Artikel! Was ich vermisse (vielleicht im 3. Teil?!), sind konkrete Lösungsvorschläge wie nun regionale Kreisläufe und eine gesunde und klimafreundliche Landwirtschaft in Südtirol umgesetzt werden können?
Zusammengefasst sagt der Artikel, dass die Subventionen indirekt den Konsumenten entgegenkommen, die billiger einkaufen können. Der Bauer reduziert auch Emissionen durch die Landwirtschaft und erhält zudem die Kulturlandschaft. Und zwecks Ernährungssicherheit ist die Haltung von Wiederkäuern „alternativlos“. Mehr Konsum von „lokalen Produkten“ wäre ein guter Start, aber „die Landwirtschaft kann nur das produzieren, was gekauft wird“.
All dies stimmt nur bedingt: Jemand muss für die billigen Lebensmittel bezahlen – entweder der Bauer, der Steuerzahler, die Billigarbeiter oder die Natur. Südtirol’s Kulturlandschaft ist einzigartig, aber die vielen grünen Wiesen sind zumindest für Bienen artenarme Wüsten. Und was produziert wird, erklärt der klassisch geschulte Berater meist anhand von Profiten usw.
Ich hätte ein paar konkrete Fragen zu regionalen Hebeln an die Autoren Siegfried Rinner, Direktor des SBB und Christian Plitzner, Geschäftsführer des BRING:
1) Italien hat einzigartig in der EU verbindliche öffentliche Beschaffungskriterien („CAM“ – criteri ambientali minimi), d.h. jede öffentliche Einrichtung (vom Kindergarten, Schule, Universität bis Altersheim und Krankenhaus) muss im Bereich Verpflegung in der Kantine Mindestkriterien wie 50% bio/Gewicht: Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide; 50% bio/Gewicht: Rindfleisch; 100% bio: Milch, Joghurt, Eier etc. einhalten. Wieviel von diesen Kategorien in Südtiroler Kantinen sind Südtiroler Ursprungs?
2) Falls nur wenig Produkte auf die öffentliche Südtiroler Anfrage antworten, weil Südtiroler Genossenschaften und Sennereien anderwo höhere Preise erzielen wollen: wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass im Zuge von regionalen Wertschöpfungsketten mehr Südtiroler Produkte in Südtiroler Kantinen landen? (das ital. Vergaberecht prämiert km0 und erste Analysen zeigen, dass die Verbindlichkeit zu mehr nachhaltigem, vielfältigen und regionalem Anbau geführt hat)
3) Warum haben Gemeindeverband, SBB und Land bisher noch nie eine umfassende und praxisorientierte Marktstudie zu Nachfrage, Angebot und Potenzial öffentlicher Nachfrage und regionalem Angebot erstellt?
4) Wie können mehr der 116 Südtiroler Gemeinden von der 20,000 € Schwellenwert-Regelung Gebrauch machen, wonach bäuerliche Produkte und Lebensmittel direkt bei interessierten Direktvermarktern oder Genossenschaften eingekauft werden können?
5) Warum konnten Landwirtschaft und Tourismus bislang nicht einkommensinteressante Modelle finden, wie Landwirtschaft-Tourismus in kurzen Kreisläufen zusammenarbeiten können, obwohl sie voneinander so sehr profitieren? (Bislang gibt es nur einzelne gute Beispiele und kurzatmige akademische Pilotprojekte)
6) Wie können Bauern, die nicht vom Apfel oder der Milch leben, bei der Direktvermarktung besser unterstützt werden? Meist müssen sie sich selbst um Logistik, Vermarktung, Verwaltung usw. kümmern, was effektiv ein riesiger Aufwand ist, wobei Direktvermarktung zu einem alternativen, vielfältigerem Angebot führen kann, dass durchaus gutes Einkommen sichern kann.
7) Wie können Landespolitik, EURAC, Universität Bozen, IDM, NOI-Techpark, Landesinstitut für Statistik ASTAT, Handelskammer, HGV, Gemeindeverband, SBB, Laimburg und SABES-Dienst für Diät und Ernährung... besser koordiniert werden um prakisorientierte Daten, Lösungen und Umsetzungen zu erzielen? Wie sie schreiben: ‚alle sind Teil der Lösung‘ und die Herausforderungen können nicht alleine gemeistert werden.
8) Aufgrund mangelnder Nachfrage und Preislage, steigen einige Bauern derzeit von biologischer auf konventionelle Landwirtschaft um, obwohl die Zukunft längerfristig klar in Richt klima- und umweltfreundlicher Landwirtschaft geht. Welche sind ihre Visionen, wie die Südtiroler „Landwirtschaft im Wandel“ nach covid (Unterbrechung konventioneller Lieferketten), Ukraine (Preissteigerung...) und sich immer schneller wiederholender Hitzerekorde (Klimawandel) über Apfel, Milch und Subventionen hinaus, doch auch ein Model für eine resiliente, vielfältigere Landwirtschaft sein kann - mit zufriedenen Landwirten, Gastwirten und Konsumenten, die mehr von regionalen und nachhaltigen Kreisläufen profitieren?
Nb: Die Visionen für eine solche Landwirtschaft, und insbesondere für kleinstrukturierte Höfe (-40% in 20 Jahren), fehlen leider auch in Brüssel, wo Riesentraktorproteste jeweils kurzfristig Panik auslösen. Viele haben verstanden, dass die großen Proteste meist von großen Interessen geleitet, wenn nicht manipuliert werden. Die meisten Subventionen (80%) gehen an die großen Betriebe (20%), mit den großen Flächen und den großen Märkten. Nur mit dieser Großbauernlobby in Brüssel längerfristige Lösungen zu blockieren, wird die Krisen längerfristig nicht lösen. Und zu den großen Lebensmittelkonzernen, den Gewinnern im Lebensmittelproduktionskreislauf, die öffentlich ihre außerordentlichen Rendite zelebrieren, ist kein Traktor hingefahren.
Antwort auf Konstruktiver Artikel! Was… von Peter Defranceschi
"Und zu den großen…
„Und zu den großen Lebensmittelkonzernen, den Gewinnern im Lebensmittelproduktionskreislauf, die öffentlich ihre außerordentlichen Rendite zelebrieren, ist kein Traktor hingefahren.“
Vielen Dank für Ihre kenntnisreiche und pointierte Replik auf Rinner, der mit der üblichen „faccia tosta“ vorgibt, seine Klientel sei „Teil der Lösung“ (!) Wäre das so, möchte man sich das dazu passende Problem gar nicht vorstellen. Und einen ganz besonderen Dank dafür, dass Sie in der Coda die bestürzende, aber nicht zufällige Desorientiertheit der von interessierten Kreisen ins (G)Rollen gebrachten Trecker-Geschwader thematisieren.
Auf den Punkt gebracht…
Auf den Punkt gebracht. Diese kleinen Kreisläufe passen nicht ins „große Ganze“. Zentrale Aussage: 80% der Subventionen gehen an 20% der Betriebe, weil groß (und meist in der Hand von Investoren, so wie die Gostners ja auch tausende Hektar Landwirtschaft in Rumänien bewirtschaften lassen).
Die Landwirtschafts-Politik …
Die Landwirtschafts-Politik + SBB + BRING, treiben die Bauern in das: "Immer Mehr + Alles noch schneller + mit Technik + viel Beton ...,
... statt die landwirtschaftlichen Fördergelder den bäuerlichen Familien, ohne Zwang „zum Investieren“ zu zu wenden, „mit der Auflage die Natur nicht zu schinden!“
Südtirol ist das Land der…
Südtirol ist das Land der Vielfat, besonders im Bereich der Landwirtschaft und ich glaube es gibt in Europa kein vergleichbares Stück Erde.
Gerade deswegen bräuchte es ein differenzierteres und sozialeres Manegament der Landwirtschaft.
Sehr, sehr schade, dass sich hier kaum Bauern an der Diskussion beteiligen, und ich meine damit solche, die versuchen, von der Landwirtschaft zu leben.
Interressant ist der Umstand, dass der Bauernbund bis vor kuzem die Theorie von Silvius Magnago „lei net roglen“ verfolgt hatte und vielleicht auch auf Grund der Beiträge hier auf Salto sich gezwungen sah, Stellung zu beziehen , ebenso wie auf den Beitrag des Chefredakteurs de „FF“ vor drei Wochen.
Auf die Frage des Journalisten der RAI, wieso sich der SBB nicht an den Demostrationen beteilige, folgende Antwort:
„Wir wußten nicht genau, für oder gegen was demostriert werden sollte“ so die Aussage des neugekrönten SBB Obmannes anlässlich der Bauerndemo in Bozen, und er ergänzte, dass man sich als Bauernbund mit dem Großteil der Probleme der Protestierenden identifiziere. (schön, wenn sich der eigene Verband mit den Interessen der Mitglieder identifizieren kann...)
Als Verband, so spürte ich es , hatte man die Befürchtung, daß auch eine massive Unzufriedenheit gegenüber dem SBB zutage kommen könnte.
@ pasqualino und Defrancesco haben beide einen sehr guten Beitrag geliefert.
Wer ist zuständig, bzw. unersetzbar für die Landschaftserhaltung in Südtirol? Die Bergbauern und im Bozner Umland und im Eisacktal die kleinen Weinbaubetriebe.
In der Ebene kann man viele Arbeiten inzwischen gut mechanisieren und auch überbetrieblich einiges bewerkstelligen. Lassen wir mal den Obstbau beiseite!
Pestizideinsatz und mineralische Düngung ist in der Berglandwirtschaft praktisch nicht existent und auch die Hochleistungsbetriebe in der Milchwirtschaft sind Einzelfälle, weswegen die Umweltdiskussion auf eine andere Ebene gestellt werden muss.
Wenn heute 70% der Bauern ihren Hof im Nebenerwerb führen, bedeutet dies, daß das Einkommen aus der Landwirtschaft hinten und vorne nicht reicht.
Die wirkliche Problematik kommt erst auf uns zu.
1. Die derzeitige Doppelbelastung macht die nächste Generation nicht mehr mit
2. Viele Berghöfe haben heute schon keinen Nachfolger
Dies hat zur Folge, dass der Spekulation Tür und Tor geöffnet wird, wenn man nicht sofort einschreitet und das Höfegesetz dahingehend überarbeitet, dass ein Verkauf an Nichtbauern unterbunden wird.
Wenn heute ein anerkannter Inmobilienmakler vor dieser Gefahr warnt, dann ist es höchste Zeit, über neue Konzepte nachzudenken.
Im Bereich Förderungen hat Herr Fulterer absdolut Recht. Aus dem Topf der Landwirtschaft nähren sich die Verbände, die Beratungsfirmen, die Industrie und letztendlich viele Arbeitnehmer auch in Südtirol in den vor- und nachgelagerten Gewerken.
Ich wette, dass auch die Entschädigungen für Wolfsrisse nicht von Umweltschutzverbänden bezahlt werden.
Für die Zukunft:
- Verschlankung der Verbände
- wenige Berater, dafür aber Gute mit Erfahrung
- Bessere Schulung der angehenden Bauern in Sozial- und Steuerrecht und im selbstständigen Denken
- Hinarbeiten auf eine Südtirolmarke für alle im Lande erzeugten Lebensmittel
- Neuausrichtung der Milchhöfe auf absolute Zusammenarbeit,
(der Milchhof Berchtesgadener Land verarbeitet gleich viel Milch, wie alle Südt. Milchhöfe zusammen), inbesonders in der einheitlichen Vermarktung.
- Erarbeitung eines Konzeptes für die Milchbauern und massive Unterstützung der wirklichen Bergbauern , so dass eine Familie vom Hof, in einer bestimmten Größe, leben kann.
Alles andere hat keine Zukunft.
Pflegemaßnahmen in Feld und Wald bleiben auf der Strecke, wenn der Bauer auswärts arbeitet
- Klare Worte mit der Gastronomie in Bezug auf Lebensmitteleinkauf (funktioniert nur in Einzelfällen, obwohl die Werbeschiene auf lokal und regional fährt...lächerlich)
- An die Bauern; mehr selber denken, weniger nachahmen und die Freude am Beruf nicht verlieren.
Die Freude am Beruf nicht…
Die Freude am Beruf nicht verlieren- leichter gesagt als getan. Noch profitieren zu viele von denen, die an solche salbungsvollen Sprüche glauben (Klassiker bei Sonntagsreden und Verbandsfeiern). Südtirol ist eben ein Urlaubsland.
Viel zu viel des…
Viel zu viel des Landwirtschaft zugerechneten Geldes, wird in den langen + breiten Bürozügen zur Vergabe der Beiträge vertrödelt,
versandet in der Laimburg (Durnis Felsenkeller) für allerhand Schabernack,
in der protzigen VOG, die mit den ...Falläpfeln tolle Bilanzen schreibt
+ den Produktions-Genossenschaften für Alles eher als -n a c h h a l t i g e- Investitionen + übertriebene Führungskosten
+ im abgehobenen Raiffeisenverband für die Genossenschafts-Revisionen, die viel zu teuer auch mit Genossenschaften abgerechnet werden
+ in der Alimentierung des Bauerbundes, der im voraus-eilendem Gehorsam die Bauern mitteuren Dienstleistungen plagt!
Antwort auf Viel zu viel des… von Josef Fulterer
Techniker, Gutachten, Banken…
Techniker, Gutachten, Banken -Kreditinstitute, Preisanstiege wegen der Beiträge und Manches mehr wie Schulungs-Projekte und Werbung, wollen auch am Kuchen beteiligt sein. Summa Summarum +- 30% bleiben bereinigt für die Beitragsempfänger.
Antwort auf Techniker, Gutachten, Banken… von rotaderga
3 € müsen dem geschundenen…
3 € müsen dem geschundenen Steuerzahler abgeknöpft werden, um durch die Politiker gütigst 1 € als Förderung für öfters mehr als fragliche Vorhaben zu verteilen.
Antwort auf Viel zu viel des… von Josef Fulterer
Warum denn immer so negativ!…
Warum denn immer so negativ!
Die Laimburg ist der absolute Vorzeigebetrieb schlechthin!
VOG - eine Erfolgsgeschichte ohne Ende!
Raiffeisenverband, ohne diesen ginge alles in Südtirol sofort und gnadenlos zu Ende, Macht brauch keine Kontrolle.
Bauernbund, ohne Bauernbund würden schon tausende von Bären und Wölfe die Menschen annagen.
Warum bezahlen…
Warum bezahlen landwirtschaftliche Betriebe so wenig Steuern? Subventionen ok, aber wenn verdient wird, dann bitte eine Abgabe über das Steuersysten, wie halt im Handel oder der Industrie, Handwerk üblich
Demos mit Traktoren: auch die Protzbauten der Wein- und Obstwirtschaft demonstrieren dem Steuerzahler wie es dem Sektor schlecht geht. Er soll gefälligst Verständnis haben!
Zu Günther Stocker ... # -…
Zu Günther Stocker ...
# - Laimburg, kein Wunder wenn man ohne Rücksicht auf die Kosten wirtschaften darf,
# - VOG, die goldenen Bilanzen werden mit den Falläpfeln + den angeblich nicht vermarktbaren Äpfeln, die elektrinische Sortiermaschinen auswerfen, zu Preisen zum Schämen gestrickt + dazu noch kräftige Landes- + EU-Beiträge,
# - der Bauernbund, der in voraus-eilendem Gehorsam Dienstleistungen mit den Mitgliedern Dienstleistungen abrechnet, zu Stundensätzen für die ein Bauer Tage-lang zu arbeiten hat + dazu noch die reichliche Fütterung der Landesregierung,
# - das mit den Bären + Wölfen, haben Bauern selber schon besser gelöst ...