Wo wollen wir morgen wohnen?

-
Das Wohnen in Südtirol ist teuer. Niemand will seine Zweitwohnung zur Miete anbieten, die Preise der wenigen vermieteten Wohnungen sind hoch – vom Wohnungskauf kann man nicht mal mehr träumen. Das Wohnbauinstitut – verantwortlich für den Bau und die Pflege der Sozialwohnungen – kann mit den vielen Anfragen nicht mithalten. Versuche der Politik, die Lage zu lockern, scheitern bislang kläglich. Die Situation wirkt unlösbar, das muss sie aber nicht sein. Paradebeispiel Wien: Eine Vielzahl der Wohnungen stammt vom Sozialen Wohnbau, trotz der zuletzt hohen Inflation finden sich weiterhin leistbare Mietwohnungen. Wie hat Wien das geschafft, wie können es andere Städte nachmachen? Mit unter anderem diesem Thema beschäftigt sich Michael Obrist. Der gebürtige Südtiroler ist Universitätsprofessor für Wohnbau und Entwerfen an der Technischen Universität Wien und leitet dort den gleichnamigen Forschungsbereich. Mehr noch: Dieses Jahr vertritt er, gemeinsam mit Sabine Pollak und Lorenzo Romito, Österreich bei der Architekturbiennale 2025 in Venedig. Ihr Projekt „Agency for Better Living“ setzt sich mit verschiedenen Modellen eines Sozialen Wohnens und Miteinander auseinander. Was genau in Venedig präsentiert wird und was gegen den Wohnungsmangel getan werden kann, erzählt Obrist im Gespräch.
-
SALTO: Von Südtirol zum Universitätsprofessor in Wien– was war Ihr Werdegang?
Michael Obrist: Ursprünglich komme ich aus Kaltern, bin 1972 geboren. Studiert habe ich in Wien und England, 2002 habe ich zusammen mit 4 Partnern, darunter dem Südtiroler Peter Zoderer, feld72 gegründet.
Was ist feld72?
feld72 ist ein Büro, das sich zwischen Architektur, angewandtem Urbanismus und Kunst bewegt. Wir sind ein 30-köpfiges Team, das aus verschiedenen Nationen stammt und somit auch international auf großer Bandbreite agiert. Die im nationalen als auch internationalen Kontext umgesetzten Arbeiten von feld72 wurden mehrfach ausgezeichnet (u.a. mehrere Österreichische Staatspreise als auch die Goldmedaille der Italienischen Architektur) und in renommierten Ausstellungshäusern und Museen als auch bei diversen Biennalen weltweit (Venedig, Shenzhen-Hongkong, Sao Paulo, Rotterdam) präsentiert. Parallel dazu habe ich schon früh begonnen, zu unterrichten.
Was waren für Sie wichtige Lehretappen?
Ich hatte neben Lehraufträgen an verschieden Unis auch längere Gastprofessuren an der Kunstuniversität Linz und am Politecnico von Mailand und habe auch verschiedene Meisterklassen geleitet, etwa an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg oder an der Architectural Association Visiting School in Slowenien. Seit 2018 bin ich Professor für Wohnbau und Leiter des Forschungsbereiches an der TU in Wien.
Was macht das Forschungsfeld „Wohnbau“ in Wien so besonders?
Wien ist Vorzeigestadt für den Wohnungsbau. Dementsprechend geht viel Verantwortung mit dem Forschungsfeld einher. Geforscht wird an der Schnittstelle zwischen sozialem und bebautem Raum – was macht Architektur mit der Gesellschaft und wie bedingt die Gesellschaft die Architektur. Daraus ergeben sich viele Fragen und ich leite hier an der TU Wien ein großes Forschungsteam, welches sich mit diesen auseinandersetzt.
„ Wien gewinnt seit zehn Jahren den Preis für die Stadt mit der größten Lebensqualität. Das liegt auch an dem hohen Wohnstandard“ – Michael Obrist
Wie ist es zu dieser Wohnbau-Politik in Wien gekommen?
In der sogenannten Gründerzeit von 1840 bis zum Ersten Weltkrieg kam es in Wien zu einem enormen Bevölkerungswachstum mit meist sehr prekären Wohnbedingungen für die ärmere Bevölkerung. Nach dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie entstand in der Zeit des sogenannten „Roten Wiens“ durch eine Wohnbau-Steuer ein enormer Initialschub für den sozialen Wohnungsbau. Die Vision war, dass jeder Zugang zu diesen günstigen Mietwohnungen haben sollte, nicht nur die ärmere Bevölkerung. Wien wurde zu einer Stadt der MieterInnen.
-
Wie sieht es heute in Wien aus?
Heute leben 77 Prozent der Wiener Bevölkerung in Miete, ganz anders als in den meisten Städte Europas. Die im Rahmen der Förderung durch die öffentliche Hand gebauten Wohnkomplexe mit sehr günstigen Mieten sind gut organisiert – man hat Gemeinschaftsräume, Dachterrassen, teilweise sogar Schwimmbäder und oft Kindertagestätten in der Nähe. Der Soziale Wohnbau Wiens ist für alle und sollte eigentlich Gesellschaftlicher Wohnungsbau heißen.
Wie sieht es in anderen Städten Europas aus?
In Städten wie Mailand und München schießen die Preise Richtung Himmel, für junge Menschen ist eine Wohnung fast nicht mehr leistbar. Parallel dazu wurde die staatliche Wohnbauproduktion enorm runtergefahren. Die öffentliche Hand hat in den meisten Städten Europas vor Jahrzehnten große Teile ihres Besitzes an Bodenreserven als auch an Immobilen verkauft bzw. privatisiert, welche nun nicht mehr für öffentlichen Wohnungsbau mit günstigen Mieten zur Verfügung stehen. Die Erfolgsgeschichte von Airbnb produziert Gewinner und Verlierer: in touristischen Orten wie auch in Südtirol werden Wohnungen oft nur kurz vermietet. Das steigert ihren Gewinn enorm, erschwert aber auf der anderen Seite den LangzeitmieterInnen die Wohnungssuche.
„Wieso sollte ich meine Wohnung langfristig vermieten, wenn ich bei AirBnB in ein paar Nächten gleich viel verdiene, wie sonst in einem Monat – ohne die ganzen Umstände“ – Michael Obrist
Wie sieht es diesbezüglich in Südtirol aus?
In Südtirol und Italien gilt der Besitz einer Wohnung oder eines Hauses für sich und seine Familie bei einem Großteil der Bevölkerung als ein wichtiges Lebensziel und gilt auch als Vorsorge für das Alter. Einst hat das gut funktioniert – als es Familien gab, die über Generationen hinweg im gleichen Haus wohnten. Inzwischen hat sich unsere Gesellschaft aber verändert: Menschen binden sich nicht mehr so einfach langfristig wie früher, die Scheidungsraten sind enorm gestiegen, Paare haben weniger Kinder, diese Kinder ziehen später aus Arbeits- oder Studiengründen weit weg, neue digitale Möglichkeiten lösen die Grenzen zwischen Arbeits- und Wohnwelten zunehmend auf. Wir haben neue Anforderungen an die immobilen Wohnbauten, und wir selbst sind alle mobiler geworden. Südtirol hat aufgrund seiner Topographie eine sehr begrenzte Fläche für potentiellen Wohnraum.
„Vergleicht man die Entwicklung der Durchschnittsgehälter mit der Entwicklung der Immobilienpreise, stellt man fest, dass es in Zukunft für einen Großteil der Menschen fast unmöglich sein wird, sich eine Wohnung zu kaufen.“ – Michael Obrist
In Südtirol kann man beobachten, dass viele junge Menschen lange bei ihren Eltern wohnen, weil es einfach zu wenig Alternativen gibt, kein Angebot, das ihrem Budget entspricht. Und den Schritt zu wagen, Kapital zu investieren und sich für 30 Jahre für ein Eigenheim zu verschulden, ist mutig und riskant.
-
Wie kann man diese Situation Ihrer Meinung nach lösen?
Es muss generell mehr leistbarer, aber qualitativer Wohnraum geschaffen werden. In einer Zeit, in der es aufgrund der Klimakrise darum gehen wird, nur neu zu bauen, wo es wirklich notwendig ist, wird es neben dem erforderlichen Neubau sehr viel um Umnutzungen und Verdichtungen von Siedlungsräumen gehen, um unsere Landschaftsräume nicht zu sehr zu versiegeln. Jenseits des Angebotes an Familienwohnungen braucht es auch andere Wohnformen, die für andere Lebensabschnitte wichtig sind, wo wir weniger Raum brauchen. Man könnte an Cluster-Wohnungen denken, wo sich Privaträume mit Bad rund im Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume gruppieren, die man teilt. Solche Angebote würde viel mehr Flexibilität bieten. Sie könnten etwa als Erstwohnung für junge Menschen dienen oder als Übergangs-Wohnung für Geschiedene.
Auf einer höheren Ebene könnte man theoretisch auch das Unternehmen Airbnb stärker besteuern, und mit dieser Steuer neuen Wohnraum für die Gesellschaft schaffen, wie es auch Wien vor 100 Jahren vorgemacht hat. Da diese digitalen Plattformen ihre jeweiligen Firmensitze in den europäischen Steueroasen wie Irland haben, bräuchte es hier viel politischen Willen.
-
In Südtirol finden sich teils schwere Baubedingungen und Platzmangel. Was ist hier überhaupt möglich?
Südtirol hat nicht unendlich viel Platz zur Verfügung, es gibt aber Alternativen. In Bozen gibt es zum Beispiel seit Jahrzehnten Pläne, durch eine Wiedergewinnung das Bahnhofsareals zu einem neuen Wohn- und Arbeitsviertel umzufunktionieren. Das große Areal wäre in einer guten innerstädtischen Lage und der Boden ist bereits versiegelt bzw. aktiviert, man zerstört also keine neue Fläche. Weiters waren und sind die aufgelassen Kasernenareale Südtirols sehr spannende Möglichkeitsräume. Wichtig ist vor allem, Wohnraum nicht isoliert von Bildungsräumen und Arbeitswelten zu sehen, sondern integral zu denken.
Gemeinsam mit zwei Kollegen kuratieren und gestalten Sie den österreichischen Pavillion bei der Architekturbiennale 2025. Was ist Ihr Beitrag?
Unser Beitrag stellt die Frage nach einem besseren Wohnen und präsentiert zwei Modelle eines sozial gerechten Wohnens. Einerseits stellen wir das sehr erfolgreiche und berühmte Top-Down-Modell in Wien vor, das die Wohnfrage seit jeher nicht als rein funktionale Frage, sondern als gesellschaftlich-emanzipatorische Frage verstanden hat. Als Gegenmodell dazu die Geschichte des informellen Wohnens, des Bottom-up-Modells, unter Wiederverwendung von Bauruinen, verlassenen Gebäuden und Ex-Infrastrukturen fürs Wohnen, exemplarisch dargestellt in der Ewigen Stadt Rom im Gastgeberland Italien. Wir wollen von beiden Modellen mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen lernen und versuchen, daraus konkrete Vorschläge für die Zukunft zu entwickeln.ise und den neuen Bedingungen unserer Zeit entspricht.
Wie sieht es in Südtirol im Bereich der Mobilität aus?
Siedlungsformen bedingen sich und Mobilität meist immer gegenseitig. In einer dichten Stadt wie Wien mit seinem sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz mit günstigen Preisen wird ein Leben ohne eigenes Automobil für einen Großteil der Menschen immer mehr zur Realität. In einem Raum wie Südtirol ist das natürlich viel komplizierter, die meisten Agglomerationen und Siedlungen sind immer noch stark auf die Präsenz von Individualverkehr ausgelegt. Da ist in Südtirol sicher noch viel Raum für Weiterentwicklung. In großen Städten gewinnen Car-Sharing-Modelle an immer mehr Bedeutung, diese sparen Platz und Geld. In Südtirol tun sich diese zurzeit noch schwer, werden jedoch erzwungenermaßen immer relevanter werden.
-
Kann Südtirol solche Änderungen stemmen?
In Südtirol gehören das eigene Haus, die eigenen Wohnung, das eigene Auto zur Selbstverständlichkeit und dienen teilweise als Statussymbole. Aber das große Innovationspotential, das in Südtirol vorhanden ist und das neben sehr spannenden Unternehmen auch durch das Erfolgsmodell Klimahaus und in der verstärkten Elektromobilität ihren Ausdruck findet, lässt mich positiv in diese Zukunft schauen.
Ist es anders überhaupt noch möglich?
Irgendwann müssen wir beginnen, uns zu fragen, was wir ändern können. Es geht nicht mehr anders. Viele der Gebäude, die in den letzten Jahrzehnten gebaut wurden, waren oft nur für eine kurze Lebensdauer oder gar nur als Spekulationsobjekte bestimmt. Es ist, wie wenn wir in einen Spiegel schauen: Das, was wir bauen, sind wir. Gleiches gilt auch für Südtirol: Wir verstecken uns gerne hinter der Schönheit unserer Natur, aber der Großteil dessen, was wir generieren, hat nicht unbedingt die Qualität noch die Langlebigkeit, die wir brauchen. Durch die Klimakrise und die Frage nach einer Ressourcenschonung müssen wir nun paradoxerweise genau mit diesem Bestand weitermachen und ihn so transformieren, dass er der Notwendigkeit nach einer nachhaltigen Lebensweise und den neuen Bedingungen unserer Zeit entspricht.
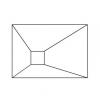




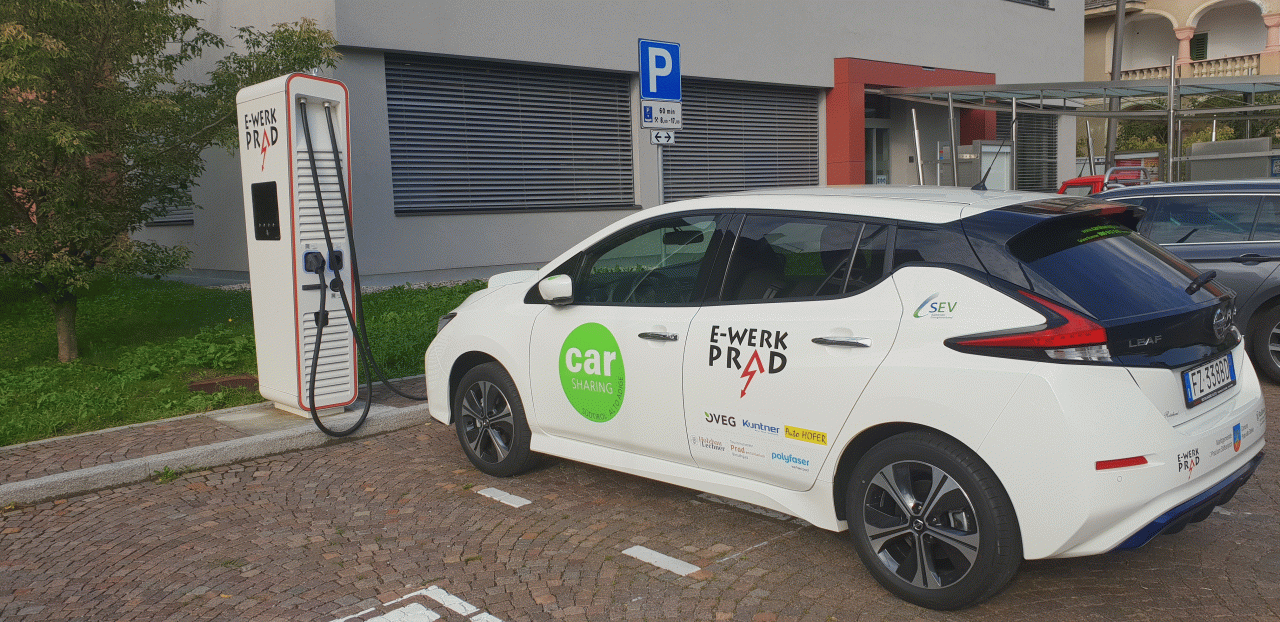
airbnb braucht nicht…
airbnb braucht nicht besteuert zu werden. Es würde schon genügen, den einheimischen Vermieter zu besteuern. Müssen halt regelmäßige Kontrollen gemacht werden.