Das BBT-Versprechen
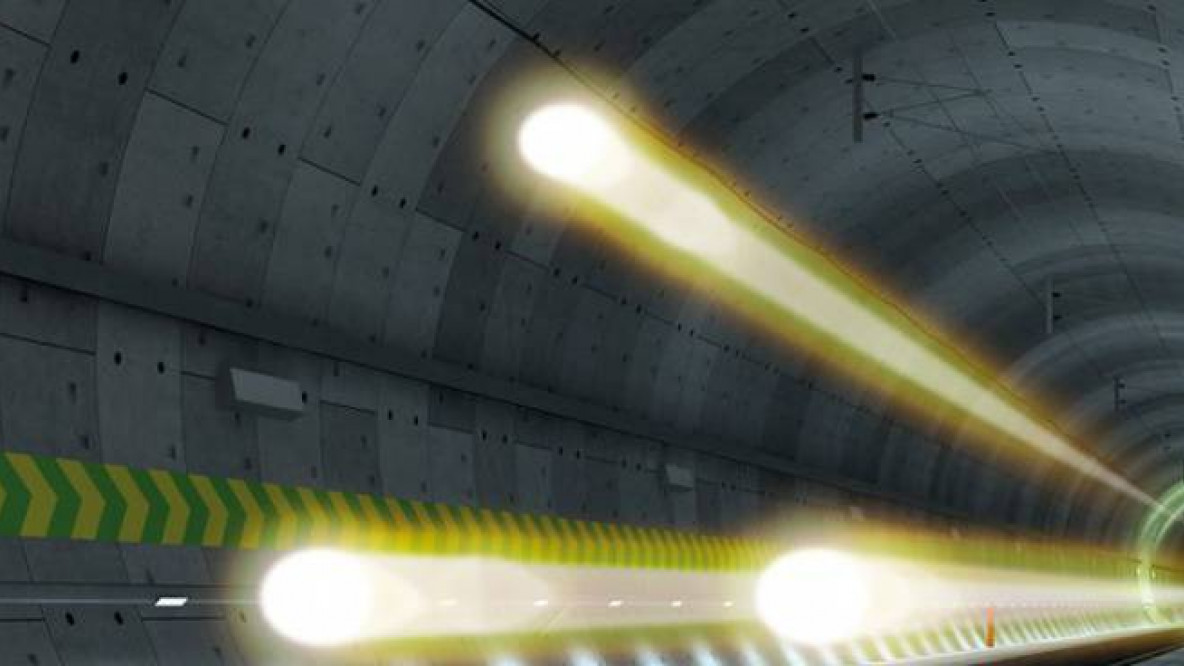
Fritz Gurgiser findet wie immer klare Worte. „Sofortiger Stopp österreichischer Steuermilliarden in die BBT SE, denn unter den gegebenen Umständen wird jeder Cent und jeder Euro verfassungswidrig in das Brennerloch “verlagert„, fordert der Chef des Tiroler Transitforums. In anderen Worten: Das Transitforum werde die österreichische Bundesregierung in dieser Woche auffordern, die Zahlungen an die BBT-Gesellschaft solange zu stoppen, “bis im Süden des Brenners all das umgesetzt wird, was längst überfällig ist". Sprich all jene Maßnahmen, die in Tirol oder der Schweiz seit langem unternommen werden, um die Straße gegenüber der Schiene unattraktiver zu machen – vom LKW-Nachtfahrverbot bis hin zum Mauttarif, der vom Brenner bis Verona 15 Cent pro Kilometer gegenüber den rund 70 Cent auf der Strecke Kufstein-Brenner betrage.
All das mag man vom kämpferischen Transitgegner schon oft gehört haben. Interessanterweise decken sich Gurgisers Forderungen aber weitgehend mit den Kernaussagen eines vieldiskutierten aktuellen Rohberichts des österreichischen Rechnungshofes zum 10-Milliarden schweren BBT-Projekt. Denn die massiven Ausgaben von Steuergeldern sind laut dem Kontrollgremium nur dann gerechtfertigt, wenn es auf der Brennerachse zu einer ebenso massiven Verlagerung des Gütertransits von der Straße auf die Schiene kommt. Konkret spricht der Rechnungshof dabei von einer Umkehrung der aktuellen Verhältnisse von etwas mehr als einem Viertel Bahnverkehr gegenüber knapp drei Viertel Straße. Dementsprechend werden in dem 120 Seiten langen Bericht nicht nur nationale und internationale Bemühungen für eine solch „bedeutende Verlagerung des Güterverkehrsaufkommens“ verlangt. Auch das sektorale Fahrverbot in Tirol, hierzulande bekanntlich nicht nur für Handelskammerpräsident Michl Ebener ein rotes Tuch, wird ausdrücklich lobend hervorgehen. Denn, wie es im Rechnungshofbericht heißt: Gelingt die Verlagerung nicht, wird der 55 Kilometer lange Tunnel zwischen Tirol und Südtirol seinen zehn Milliarden Euro teuren Zweck nicht erfüllen.
Applaus von Umweltschützern - und der BBT SE
Applaus für solche Ansagen kommt vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz. Dort interpretiert man den Rechnungshofbericht als Bestätigung der Forderungen aller BBT-kritischen Akteure im Land. „Wir brauchen endlich verbindliche Maßnahme, um bereits jetzt den Umweg-Verkehr über den Brenner wirksam zu reduzieren sowie eine gesetzlich verankerte Verlagerung von der Straße auf die Schiene für den verbliebenen Schwerverkehr zu erreichen“, schreibt der Dachverband in einer Aussendung. Darin wird Landeshauptmann Arno Kompatscher aufgefordert, die „Rüge des Rechnungshofes“ auch bei seinem Brüssel-Aufenthalt in dieser Woche aufzugreifen, um „endlich verbindliche Zusagen aus Brüssel zur Zwangsverlagerung von der Straße auf die Schiene zu erreichen.“
Beifall für die Kernaussagen des Rechnungshofsberichts kommt aber auch von der BBT SE selbst.„Wir stimmen damit vollkommen überein“, sagt Martin Ausserdorfer, Direktor der Beobachtungsstelle zum Bau des BBT, „die darin genannten Ziele sind auch unsere Ziele.“ Nicht nur das. Ausserdorfer gibt sich auch selbstbewusst, dass die angestrebte Verlagerung mit der Eröffnung des Tunnels gelingen wird. Und zwar allein schon aufgrund einer effizienteren und leistungsfähigeren Bahnstrecke, mit der die Schiene deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Straße gewinnen werde. „Heute brauchen wir zwei bzw. auf Tiroler Seite drei Lokomotiven, um die engen und steilen Kurven auf der Strecke zu bewältigen, morgen wird eine Lokomotive das Doppelte an Gewicht transportieren können“, sagt Ausserdorfer. Heute betrage die Fahrzeit zwischen Franzensfeste und Innsbruck rund 1 Stunde 45 Minuten. Morgen würden es 35 Minuten sein.
Zusätzlich ermögliche das grenzüberschreitende Projekt laut dem Direktor der BBT-Beobachtungsstelle auch sämtliche Überbleibsel einer national ausgerichteten Bahnpolitik zu begraben, die den Verkehr über den Brenner lange gebremst haben: ob gewerkschaftliche Sicherheitsbestimmungen, die Umstellung zwischen Gleichstrom und Wechselstrom oder einer fehlenden grenzüberschreitenden Fahrerlaubnis für Zugführer. „Allein durch die neue Infrastruktur und den Abbau solcher Zugangsbarrieren werden wir es schaffen, eine konkurrenzfähige und funktionstüchtige Verkehrsaufteilung zwischen Straße und Schiene zu erreichen“, gibt sich Ausserdorfer zuversichtlich. Ziel ist laut ihm mit der Eröffnung des Tunnels schrittweise das im EU-Weißbuch angestrebte Verhältnis von einem Drittel des Gütervekehrs auf der Straße und zwei Dritteln auf der Schiene zu erreichen.
Teure Maut, günstiger Treibstoff
Parallel dazu arbeitet man laut Martin Ausserdorfer bereits jetzt intensiv daran, die bisher fehlende Abstimmung verkehrspolitischer Maßnahmen zwischen den am Projekt beteiligten Ländern zu überwinden. „Österreich mag sich immer damit brüsten, dass es die teuerste Maut hat“, sagt er. „Doch gleichzeitig verscherbelt man dort den Treibstoff so günstig, dass sich Transportunternehmer viel Geld sparen, wenn sie nur in Österreich tanken.“ Eine Tatsache, die genauso Bremse für eine Verlagerung auf die Schiene sei wie zu günstige Mauttarife. Um parallel zum Bau des Tunnels verkehrspolitische Maßnahmen aus einer länderübergreifenden Logik heraus zu erarbeiten, wurde bereits 2007 von Ex-EU-Koordinator Karel van Miert die Brenner Corridor Plattform ins Leben gerufen, erinnert Ausserdorfer. Darin vertreten sind Bayern, Tirol, Südtirol, Trient und Verona, die drei Infrastrukturministerien und Bahngesellschaften aus Italien, Österreich und Deutschland sowie die Brenner Basistunnel Gesellschaft.
Doch auch jetzt würden bereits erste Maßnahmen zur besseren Lenkung des Güterverkehrs greifen, sagt Martin Ausserdorfer. Als eines der aktuellen Beispiele nennt er den Beschluss der Provinzen Südtirol und Trentino, die Rollende Landstraße von Wörgl bis Brenner durch einer Querfinanzierung der Region in Höhe von 7 Millionen Euro bis Trient fortzuführen. Mit der Umwandlung der A22 in eine Inhousegesellschaft werden laut dem BBT-Beobachtungsstelle-Direktor wiederum erstmals die juridischen Voraussetzungen geschaffen, um künftig die Maut sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen autonomer regulieren zu können.
Selbst in Sachen Zulaufstrecken hat Martin Ausserdorfer nur Positives zu berichten: Die Finanzierung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für die Strecke Franzensfeste-Waidbruck stehe seit August; in Kürze werde das Projekt, das in einem Planungsdialog mit den betroffenen Gemeinden erarbeitet wurde, dem Ministerium zur Genehmigung übermittelt. „Im kommenden Jahr werden wir die Arbeiten ausschreiben können“, sagt er. Das Fertigstellungsziel 2026 ist deshalb laut Ausserdorfer genauso realistisch wie die damit verbunden Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Ein großes Versprechen – das nun auch eingelöst werden muss.
Herr Gurgiser will den BBT
Herr Gurgiser will den BBT nicht, sonst könnte er soche Forderungen nicht aufstellen, andererseits, kann er gerne die Verhandlungen in Rom übernehmen, wo es nicht seinfach ist, die Erhöhung der Maut oder Nachtfahrverbote durchzusetzen, beim sektoralen Fahverbot müssten wir auch die Nordtiroler auch die Bahn zwingen so sie uns ;-)
Antwort auf Herr Gurgiser will den BBT von Martin Senoner
Ich kenne Sie ja nicht, Herr
Ich kenne Sie ja nicht, Herr Senoner, aber so einen Schwachsinn muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen: Ich „mag“ also den BBT nicht, gerade so, als ginge es darum, ob jemand einen Tunnel mag oder nicht. Im Gegensatz zu Ihnen kenne ich diese „Empfehlungen des Rechnungshofes“ seit Veröffentlichung der Berichte zum Bau der Eisenbahnumfahrung Innsbruck, der Neuen Unterinntalbahn und den Vorberichten zum BBT - sie wurden auf österreichischer Seite unter Druck der Zivilgesellschaft teilweise umgesetzt, auf italienischer Seite eben nicht, weil die Südtiroler Landespolitik eben lieber den Transit statt der eigenen Bevölkerung schützt.
Aber ich kann Ihnen gerne sagen, was ich absolut NICHT mag:
Wenn der Tiroler Bevölkerung und Wirtschaft nördlich und südlich des Brenners seit knapp 30 Jahren die „Verlagerung von Gütertransit auf die Eisenbahn“ versprochen wird, in Wahrheit aber nur unser Steuergeld in dieses „amici-investment“ verlagert wird;
wenn sich die SVP hinter einem ehemaligen SVP-EU-Parlamentarier versteckt, der meint, er müsse sich in Brüssel beschweren und damit so tut, als würde die Südtiroler Transportwirtschaft wegen eines läppischen Lkw-Fahrverbotes für Müll, Schrott, Steine, Abfälle zugrunde gehen;
wenn die gesamte „Euregio-Schwafelei“ nur einen Konsens hat: Möglichst viel Steuergeld in das BBT-Loch, aber keine einzige gemeinsame Schutzmaßnahme für Bevölkerung und Wirtschaft auch auf den 238 km vom Brenner bis Verona;
wenn nationale und internationale Verpflichtungen in Bezug auf Gesundheit ignoriert werden, nur damit mittlerweile 2 Millionen Transit-Lkw über den Brenner rollen (die Kennzeichen aus den ehemaligen Ostblockländern setze ich als bekannt voraus);
wenn hinter dem Lenkrad der 40-Tonner keine eigenen Berufskraftfahrer mehr sitzen, sondern „Sklaven der Landstraße“ mit Brutto-Monatslöhnen in Höhe von 350 - 450 Euro;
wenn die Transit-Lkw ebenso wie die Sklaven hinter dem Lenkrad nicht mehr in den eigenen Ländern gemeldet und deshalb hier weder Fahrzeug- noch Mitarbeitersteuern und -abgaben bezahlen.
Und Zeitgenossen, die das alles nicht wissen und mit ihren seltsamen Kommentaren beweisen, dass ihnen die Gesundheits-, Lebens- und Wirtschaftsqualität der Menschen und Betriebe entlang der Brennerstrecke vollkommen egal sind - Hauptsache, die Lasterlawine rollt und rollt und rollt - politisch gewollt auf der Straße.
Deshalb, und das können Sie sicher sein, werden wir genau das noch diese Woche machen, was wir versprochen haben: Die Bundesregierung und die EU auffordern, ihre BBT-Zahlungen einzustellen - denn ein Bau„partner“, der nur unser Steuergeld verlagern will, auf der Straße aber gegen die eigene Bevölkerung und Wirtschaft agiert, soll sich den Tunnel selber finanzieren.
Bitte um Verständnis für diese klare Position - das nächste Mal werden Sie von uns lesen, wenn wir das Schreiben an Bundesregierung und EU zur Verfügung stellen.
LG
Fritz Gurgiser
Antwort auf Ich kenne Sie ja nicht, Herr von Fritz Gurgiser
Sehr geehrter Herr Gurgiser,
Sehr geehrter Herr Gurgiser,
sie haben sicher in einigen Punkten Recht. Obwohl ich Ihren Schreibstil als sehr polemisch empfinde (mag ich gar nicht), möchte ich Sie trotzdem zu Ihrer Ansicht zu den Österreichischen (und Deutschen) Treibstoffpreisen befragen.
Ich habe folgende Milchmädchenrechnung angestellt:
Verbrauch eines 40-Tonners ca. 35 Liter/100 km
238 km von Brenner bis Verona also 83,30 Liter
Italienischer Diesel ca. 1,35 Euro pro Liter = 112,45 Euro
Österreichischer Diesel ca. 1,05 Euro pro Liter = 87,47 Euro
Das sind also gut 10 €Cent Preisunterschied pro Kilometer.
Wenn ich mir dann vorstelle, dass heutige LKW’s oft einen 1000-Liter-Tank haben, nehme ich stark an, dass auf der Brennerachse (und wahrscheinlich in ganz Norditalien) sehr wenige LKW’s mit Italienischem Treibstoff unterwegs sind. Österreich verdient hier kräftig am Treibstoff und an der höheren Maut. Dazu kommt noch, dass der Schadstoffausstoss bei uns stattfindet und wir die Kosten für die Umweltschäden durch Steuergelder decken müssen.
Wie ist Ihre Position zu dieser Situation ?
Antwort auf Sehr geehrter Herr Gurgiser, von Georg Mair
Mein Gott, Sie werfen mir
Mein Gott, Sie werfen mir Polemik vor - ja, soll so sein. Nur eines dazu: So grob kann niemand mit Mund und Feder oder Taste sein, wie die, die uns täglich das Stickstoffdioxid in die Lungen und den Dauerschallpegel in die Ohren blasen. Darum geht es, guter Herr Mair, wenn Sie noch nicht verstanden haben, was uns an der Brennerstrecke seit Jahrzehnten belastet.
Und zu Ihrer „Milchmädchenrechnung“, die ja tatsächlich eine ist, weil sie keine Ahnung haben, wie pervers dieser Tanktourismus längst real abläuft. Wir im Transitforum sind die einzigen, die den MUT haben, das seit Jahren anzuprangern und auch solange keine Ruhe geben werden, bis wir das korrigiert haben. Da müssen Sie halt ab und zu über die Brennergrenze schauen. Und was das Verdienen angeht: Tirol und darum geht es, verdient daran gar nichts: Maut und Roadpricing landen in den Wiener ASFINAG-Kassen und die Dieselsteuer im Wiener Finanzministerium.
Sie sollten sich aber auch entscheiden, was Ihnen wichtig ist: Die Gesundheit, die Lebens- und Wirtschaftsqualität oder die Sorge, ob die Transitlaster mit Sprit aus Deutschland, Österreich oder Italien unterwegs sind. Oder vor allem darum, warum im Süden des Landes niemand politisch imstande ist, die Anrainer mit verkehrs- und finanzrechtlichen Maßnahmen zu schützen - so, wie es seit Jahrzehnten VERSPROCHEN und nie gehalten wird. So, wie es die beiden Tiroler Landtage in Bozen und Innsbruck beschlossen haben.
Daher klar: Wir bekämpfen diesen Tanktourismus genauso wie die fehlenden Schutzmaßnahmen vom Brenner bis Verona; erst im Sommer war ein umfassender Beitrag im ORF Tirol Heute dazu (Tankstellen in Kufstein und Wörgl), worauf mir mehrmals wieder angedroht wurde, man würde mir schon sehr bald „die Hüttn anzünden“, wenn ich da noch weiter tätig bin.
So schaut’s aus und das Schreiben an Bundeskanzler Kern, Vizekanzler Mitterlehner und Finanzminster Schelling mit der Forderung, die Finanzierung für das „amici-investment“ so lange zu stoppen, bis die verfassungskonformen Vorgaben nach Wirtschaftlichkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit gegeben sind. Eine legitime, korrekte Forderung von uns, da wir nicht nur im Transitforum ehrenamtlich für unsere Bevölkerung und Wirtschaft nördlich und südliche des Brenners arbeiten, sondern zuallererst allesamt Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind. Die ein Recht darauf haben, dass ihre Gelder nicht in „Schwarze Löcher, die in Folge Rote Zahlen schreiben“ verlagert werden, während der Lkw-Transit von der Schiene auf die Straße zurück verlagert wird.
Damit belasse ich meine Beiträge zu diesem Thema, es ist alles auf unserer Website nachzulesen.
Fritz Gurgiser
Obmann