Fachkräftemangel: Really?
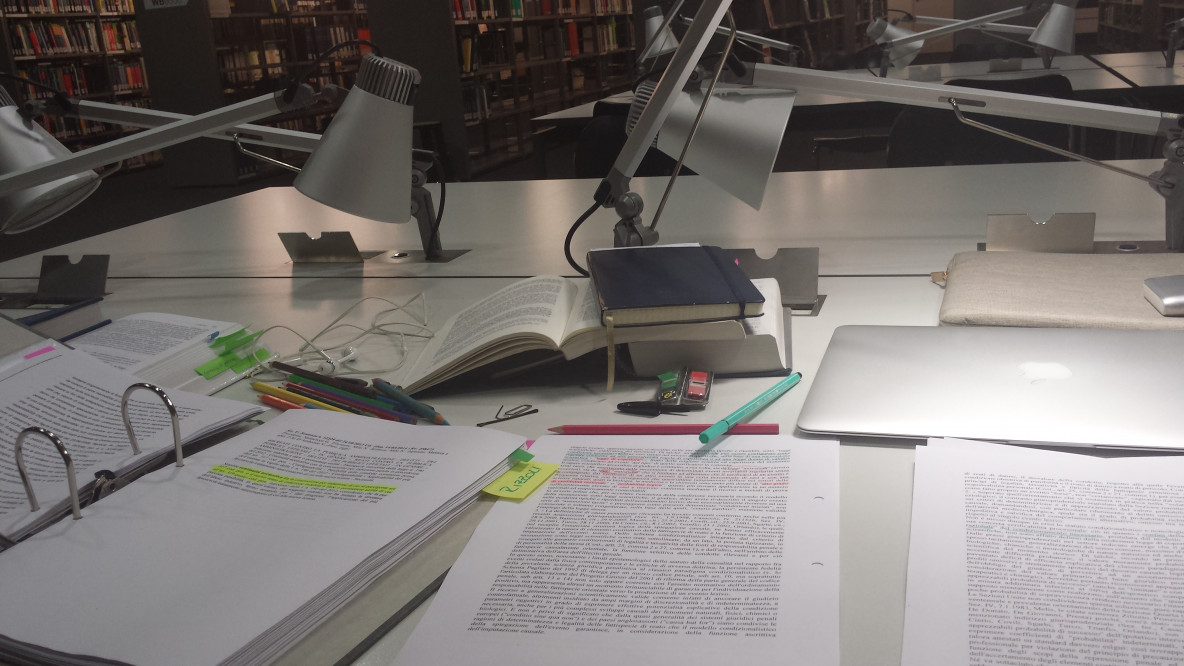
Die große Sorge um die sogenannten Fachkräfte ist weitverbreitet. Politiker, Gewerkschaften und Unternehmen bemängeln, dass Jung und Alt die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften in den kommenden Jahren nicht abdecken können. Schuld daran sei die mangelnde oder falsche Berufsausbildung, die den Anforderungen der digitalen Technologien scheinbar nicht genügt. Insbesondere soll es an Ingenieuren, Programmierern, Entwicklern und Ähnlichem fehlen, die in der Lage sind komplexe Informationen zu verwalten, eigenständig zu denken, kreativ zu sein, Ressourcen intelligent und effizient zu nutzen und darüber hinaus wirksam zu kommunizieren. Verschlimmert soll die ganze Sache dann noch durch den demografischen Wandel werden. Die, versteht sich von selbst, hervorragend ausgebildeten Fachkräfte von früher fallen weg und die Befürchtung liegt nahe, dass diese eben nicht durch nachkommende jüngere ersetzt werden können.
Zerlegen wir das ganze vorgespielte Horrorszenario des Fachkräftemangels in seine Einzelteile, stellen wir allerdings fest, dass die Probleme letztlich woanders liegen.
Argument zu wenig gut ausgebildete Menschen:
Laut einer Pressemitteilung von Eurostat vom 26. April 2017 steigt der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit tertiärem Bildungsabschluss in der Europäischen Union kontinuierlich. Waren es 2002 noch 23,6% stieg der Prozentsatz 2016 auf 39,1%. Eine statistische Momentaufnahme in Österreich zeigt, dass die Anzahl der ordentlichen Studienabschlüsse an öffentlichen Hochschuleinrichtungen von unter 10.000 jährlich in der Mitte der 1980er-Jahre auf über 50.000 im Studienjahr 2013/2014 stieg. 2015 gab es in den EU-28 Ländern 19,5 Mio. Studierende im Tertiärbereich. Das Argument, es gäbe zu wenig gut ausgebildete Menschen, dürfte unter Berücksichtigung dieser Zahlen also wegfallen.
Noch nie in der europäischen Geschichte hatten so viele Menschen wie heute einen höheren Bildungsstand.
Diese Zahlen geben natürlich keinen Aufschluss darüber, welche Studienrichtungen von den Studierenden gewählt worden sind. Aber ist das eigentlich notwendig, um zu belegen, dass wir gar keinen Fachkräftemangel haben? Werden Kompetenzen wirklich nur über die Wahl des Studienganges definiert? Oder erhöht sich durch den Abschluss einer höheren Ausbildung, die Fähigkeit - eigenständig zu denken oder komplexe Zusammenhänge zu verstehen – unabhängig von der gewählten Fachrichtung? Kommt ein Humanwissenschaftler mit einer betriebswirtschaftlichen Matura nicht als Fachkraft für einen technischen Beruf z.B. als Business Analyst in Frage? Früher war es möglich, mit dem Abschluss einer Handelsoberschule Filialleiter einer Bank zu werden. Aber heute sprechen wir von Fachkräftemangel, wenn für den technischen Support, bei dem es prinzipiell darum geht, in eine bestehende Software Daten einzuspeisen, kein Mathematiker mit Ph.D. zur Verfügung steht.
Argument demografischer Wandel:
Wenn man sich rein auf die Tatsache bezieht, dass in der EU-28 der Anteil der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter schrumpft, während gleichzeitig die Zahl der Personen im Rentenalter steigt, dann stimmt die Aussage vielleicht, dass in den nächsten Jahren mehr Arbeitskräfte wegfallen als nachkommen. Berücksichtigt man allerdings die Zuwanderung bzw., dass Arbeitsplätze aufgrund der Digitalisierung wegfallen, dann ist der demografische Wandel vielleicht gar kein so großes Problem. Oder er ist es mehrheitlich nur für diejenigen, die Sorge um ihre Pension und Alterspflege haben und fürchten, dass nicht genügend andere arbeiten, um dafür zu bezahlen. Fachkräfte aus älteren Generationen, und damit meine ich Fachkräfte im Sinne der heutigen Definition von Fachkraft, also mit einem höheren Bildungsstand, können mit Sicherheit auch in der Zukunft hervorragend durch eine Vielzahl von hochqualifizierten jüngeren Menschen ersetzt werden. Außerdem sollte man das Thema Frauen in der Arbeitswelt nicht außer Acht lassen. 2015 waren 54,1 % aller Studierenden im Tertiärbereich in der EU-28 Frauen. Bereits jetzt wollen viele Frauen mehr als weniger arbeiten. Dieses Potenzial sollte man in Zukunft nutzen, anstatt Frauenarbeitslosigkeit wegen unflexibler Arbeitszeiten zu tolerieren und gleichzeitig einen Fachkräftemangel zu bemängeln.
Warum fürchten alle den sogenannten Fachkräftemangel?
Liegt die Angst, nicht genügend Fachkräfte zu haben, vielleicht daran, dass zu hohe Anforderungen an die Arbeitnehmer im Allgemeinen und an ihre Ausbildung im Besonderem gestellt werden? Warum müssen jegliche Kenntnisse und Kompetenzen sowie alles Wissen mit Zertifikaten, Masterdiplomen und LL.M. bestätigt werden? Warum war learning by doing früher akzeptiert, aber warum ist heute nur mehr selten jemand bereit dazu, jemanden im Betrieb auszubilden? Die Last der Ausbildung einer Fachkraft sollte auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen verteilt werden. Aber vielleicht liegt gerade hier das Problem der unqualifizierten Arbeiterschaft: Betriebe sind nicht bereit, in Menschen zu investieren, bei welchen sie sich nicht vorher durch x Bescheinigungen versichert haben, dass das Risiko auf den Falschen gesetzt zu haben, auf ein Minimum reduziert worden ist.
Zur „Fachkraft“ wurde man früher durch Erfahrung. Erfahrung bekommt man durch Tun. Etwas tun kann man aber erst, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Die Möglichkeit muss durch den Arbeitgeber geschaffen werden. In diesem Sinne wird die Diskussion zum Fachkräftemangel einseitig geführt. Fachkräftemangel haben wir nicht, weil die Menschen Geisteswissenschaften anstatt Wirtschaftswissenschaften studieren. Fachkräftemangel haben wir eben auch deshalb, weil Unternehmen nicht bereit dazu sind, auf eigenes Risiko Menschen eine Chance zu geben und in ihr Potenzial zu investieren, das mehr ist als die Qualifikationen auf Papier.
Sehr schön geschrieben und
Sehr schön geschrieben und viele interessante Theorien entwickelt. Leider fehlt hier Frau Schnitzer jeglicher Bezug zur Realität.
Highlight des Artikels;
„Kommt ein Humanwissenschaftler mit einer betriebswirtschaftlichen Matura nicht als Fachkraft für einen technischen Beruf z.B. als Business Analyst in Frage?“
Sorry Frau Schnitzer, aber das ist wirklich der Witz der Woche.
Ein guter Beitrag. Allerdings
Ein guter Beitrag. Allerdings fehlt mir ein wichtiger Begriff bzw. Absatz zum Thema „Motivation“.
Und das ist nicht als Mangel an Willen oder gar Faulheit gemeint, sondern es hat mit Perspektiven zu tun.
Diese waren in Nachkriegszeiten hauptsächlich damit gegeben alles Mögliche und Fehlende neu zu schaffen. Handwerker, Geschäfte, Gastwirte, ... hatten mehr als genug zu tun, und sprichwörtlich aus dem Boden zu stampfen. Sie waren dann Helden und angesehen.
Heute, 3 Generationen später hat man vergessen was Krieg und Nachkriegszeit bedeutet. Das schlimme an Selbstverständlichkeit ist dass man sie kaum bemerkt. Man fragt sich nur: was soll ich da eigentlich noch, und gibt damit zu, die Motivation etwas Neues, Fehlendes zu schaffen ist ungleich dynamischer, als der Aufwand den gewohnten Status quo zu halten. Auch oder ganz besonders, wenn man als Gesellschaft auf den obersten Sprossen der Leiter steht und Beamte, Berater, Rechtsanwälte und selbsternannte Gutmenschen viele wesentliche Hebel in Händen haben, um einen Freude und Motivation gehörig zu verderben.
Wenn man nicht mehr merkt wo man eigentlich steht, und keine Sprossen mehr vor sich sieht, die man vernünftig erklimmen könnte, steigt die Gefahr ordentlich abzustürzen.
Aber vielleicht braucht es das ja auch mal wieder? Vielleicht - so schlimm es klingen mag - hat es schon viel zu lang keinen Krieg mehr gegeben.
Und danach ist der Typ mit dem Oberschulabschluss auch wieder ein gefragter Bankdirektor, motiviert bis in die Zehenspitzen. Und ein fachkundiger Held.
Es kann schneller gehen als
Es kann schneller gehen als manche glauben und wir haben Jobsuchende mehr als genug
"Aber heute sprechen wir von
„Aber heute sprechen wir von Fachkräftemangel, wenn für den technischen Support, bei dem es prinzipiell darum geht, in eine bestehende Software Daten einzuspeisen, kein Mathematiker mit Ph.D. zur Verfügung steht.“
Äh. Nein. Prinzipiell gibt der technische Support keine Daten in einer bestehenden Software ein. Kommen Sie mal vorbei, ich zeige Ihnen gerne, was ein first, second oder third level Support leisten muss. Die analytischen und technischen Fähigkeiten, die Sie dort benötigen, erwerben Sie leider nicht im Vorbeigehen.
„Fachkräftemangel haben wir nicht, weil die Menschen Geisteswissenschaften anstatt Wirtschaftswissenschaften studieren. Fachkräftemangel haben wir eben auch deshalb, weil Unternehmen nicht bereit dazu sind, auf eigenes Risiko Menschen eine Chance zu geben und in ihr Potenzial zu investieren, das mehr ist als die Qualifikationen auf Papier.“
Zwar eine wichtige These, um auch die letzten Betriebe wachzurütteln, die noch nicht versuchen, über Aus- und Weiterbildung ihre Stellen zu besetzen, aber auf einer grundlegend falschen Basis formuliert. Der Fachkräftemangel betrifft leider gar nicht die herbeibemühte Wirtschaftswissenschaft - und natürlich schon gar nicht die Geisteswissenschaftler. Sie wissen bestimmt, dass kaufmännische Berufe, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater schon lange mehr Bewerber als Stellen aufweisen. Der Fachkräftemangel, herrscht leider weitgehend bei Naturwissenschaften, Ingenieurberufen, und, selbstredend, bei den Gesundheits- und Pflegeberufen. Frische Zahlen gibts zum Beispiel hier [https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktbe…].
Wenn viel zu wenig Abgänger natur- und ingenieurwissenschaftlicher - mittlerer oder höherer - Schulen den Arbeitsmarkt beleben, ist es wirklich der falsche Schluss, den Fehler bei den Unternehmen zu suchen, die „nicht bereit dazu sind, auf eigenes Risiko Menschen eine Chance zu geben und in ihr Potenzial zu investieren, das mehr ist als die Qualifikationen auf Papier.“.
"Aber heute sprechen wir von
„Aber heute sprechen wir von Fachkräftemangel, wenn für den technischen Support, bei dem es prinzipiell darum geht, in eine bestehende Software Daten einzuspeisen, kein Mathematiker mit Ph.D. zur Verfügung steht.“
Das ist leider absoluter Quatsch, Frau Schnitzer. Abgesehen davon, dass ich den Zusammenhang zwischen technischem Support und einem Ph.D. in Mathematik nur sehr schwer finden kann, finde ich diesen Satz sehr ignorant und arrogant. Ohne die Mitarbeiter im technischen Support, also laut Ihnen anscheinend kleine Äffchen die lediglich stupide Daten einspeisen, würde jedes halbwegs große Unternehmen in wenigen Tagen bis Wochen im absoluten Chaos versinken.
Um Fachwissen über Server- und Netzwerktechnologien zu erlangen und einzusetzen, hilft Ihnen Ihr Ph.D. in Mathematik auch herzlich wenig. Wie Herr Moar bereits geschrieben hat, erwirbt man diese Fähigkeiten nicht einfach so im Vorbeigehen. Vielleicht denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie sich auf der Arbeit auf jedem x-beliebigem PC einloggen können, Dokumente an den Drucker drei Räume weiter schicken und sich per Mail mit Kollegen austauschen. Bei der (natürlich nie zu 100%) reibungslosen Funktionalität der IT-Struktur ist es mit Daten einspeisen oder einem für das Berufsfeld komplett irrelevanten „Ph.D.“ nämlich nicht getan ... leider.
"Aber so viel Zeit muss sein.
„Aber so viel Zeit muss sein. Oder gibt es eine Branche, die aufgrund von Fachkräftemangel zusammengebrochen ist?“
So entspannt sehen das die Branchen nicht. Ohne Fachkräfte kein Wachstum. Ohne Wachstum keine Finanzierung der Sozialleistungen. Ein gleiches Niveau wie im Vorjahr ist für Branchen nicht ausreichend, um am Markt zu bestehen.
Der von dir als selbstregelnde Kraft des Marktes erfhoffte Schweinezyklus am Arbeitsmarkt (https://de.wikipedia.org/wiki/Schweinezyklus) ist durch die zeitliche Versetzung keine Lösung. Die Ausgebildeten treffen immer zum falschen Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt. Willst du die richtigen Fachkräfte haben, ist es viel effizienter zu steuern. Dazu haben wir ja ein staatliches und überstaatliches Gebilde.
Der Markt hat zum Beispiel keinen Einfluß auf Dinge wie die Lehrinhalte der Schulen oder der Zuführung von Frauen zu Mint-Fächern. Und dass sich Mitbewerber mittlerweile auch gegenseitig Fachkräfte abwerben, ist ein Trend, der einzig den Headhuntern Umsatz zuführt. An der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung ändert sich kein Jota, und an beiden beteiligten Unternehmen entstehen unnötige Kosten, auch im Sinne von ausgebildeten und wieder verlorenen Kompetenzen.
Wenn wir nicht Steuern möchte, wie unsere Gesellschaft sich fitter für die Zukunft machen soll, können wir gleich das ganze Schul- und Sozialsystem einstampfen. Und den Amazons der Welt übergeben wir dann die Verwantwortung für unsere Volkswirtschaften.
"Dann bleibt eben doch nichts
„Dann bleibt eben doch nichts anderes übrig als selbst auszubilden, oder? Denn bis beispielsweise ein staatliches Förderprogramm angelaufen ist und greift, ist der Zeitversatz auch schon eingetreten.“
Hat auch keiner gesagt. Du bist derjenige, der darauf vertraut(e), dass der Markt das schon selbst regelt. Ich weise darauf hin, dass ein Problem nur dann nachhaltig gelöst wird, wenn von allen Akteuren, auf verschiedenen Ebenen, Maßnahmen ergriffen werden. Das schließt den Markt mit ein, aber eben nicht ausschließlich. Suche dir eine beliebige Pathologie aus, und du wirst mir zustimmen, dass man ebendieser am Besten über verschiedene Maßnahmen entgegnet. Ein einzelner Eingriff, ohne zum beispiel medikamentöse Behandlung, wäre nicht zielführend. Oder ohne Vor- und Nachbetreuung. Oder ohen Umstellung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. Ganzheitlich, halt. Und der Markt, so sehr es Liberalökonomien gern hätten, ist halt nur eine Komponente einer komplexen Welt. Die besten Ergebnisse erziehlt man, wenn mehrere an den gleiche Strang ziehen.
„Würde sich da nicht eher die Frage danach lohnen, wieso man ohne ständiges Wachstum nicht am Markt bestehen kann?“
Das ist eigentlich ziemlich einfach. Einige Stichworte wären Inflation, Wettbewerb, fallende Erlöse, Grenzkosten und Mengenerlöse, und nicht zu vergessen der Kapitalbedarf für Zinsen und Investitionen in Staat und Unternehmen. Und wenn du befürchtest, Wachstum sei schlecht, so sei darauf hingewiesen, dass Wachstum auch qualitatives Wachstum bedeuten kann. Eine ziemlich interessante Angelegenheit.