Servierte und erlebte Geschichten
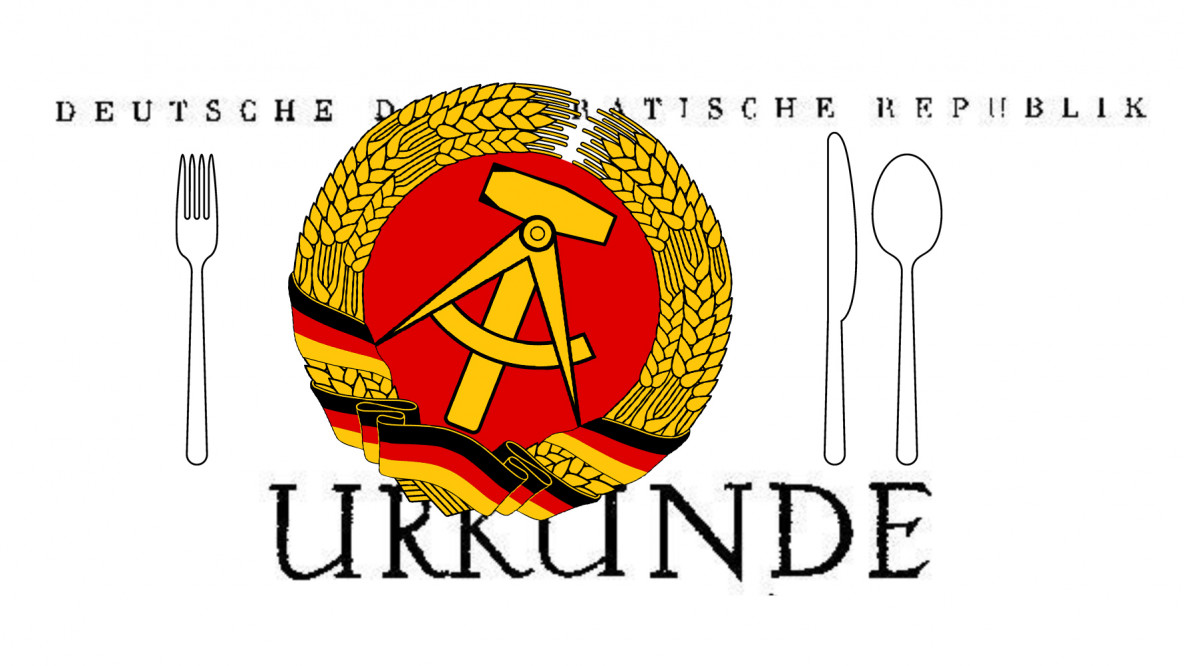
„Nach dem Zerfall des RGW, volkstümlich als Ostblock bezeichnet, wurden Millionen von Arbeitern über Nacht arbeitslos. Die unter sozialistischen Verhältnissen aufgewachsenen Bürger wurden dadurch, von Heut' auf Morgen, unvorbereitet unter neuen Gesetzen zu erpressbaren Tagelöhnern und Sklaven. Sie verrichten seitdem Arbeiten als Erntehelfer, Tagelöhner, Fernfahrer und Saisonarbeiter, fernab ihrer Nachbarn und Familien. Sie werden von einer unbeschreiblichen Bürokratie, von einer sie betrügenden kapitalistischen Gesellschaft rechtlos behandelt und maßlos ausgebeutet. Ihre gesamten beruflichen als auch intellektuellen Bildungsabschlüsse und Urkunden werden nicht anerkannt und sind wertlos geworden.“
Diese Zeilen stellt der Koch und Autor Kh Beyer (Pseudonym) an den Anfang seiner Geschichte. Beyer stammt aus einem vor über drei Jahrzehnten untergegangen Staat, der sich DDR nannte – und mitunter gerne für lustige Vergleiche mit Südtirol (Reinhold Messner, Ulrich Zieger ect.) herangezogen wurde. „Wir haben damals mit 120.-DM und zwei kleinen Taschen das Land verlassen. DDR-Pässe, -Führerschein, -Ausweise usw., sind mir im Westen alle abgenommen worden“ erinnert sich der seit gut zwei Jahrzehnten in Südtirols Küchen tätige Beyer an die Wendezeit. Trotzig fügt er hinzu: „Ausweise von West-Besatzern wollte ich nie annehmen.“
In der DDR gingen Silvesterfeiern bedeutend länger und die Feierlichkeiten waren wesentlich intensiver. Das lag einfach daran, dass in der DDR sämtliche Getränke und Speisen in der Gastronomie, erheblich preiswerter waren und kaum einen Unterschied zu den Ladenpreisen darstellten.
Im vergangenen Jahr hat Beyer sein erstes Buch Der Saisonkoch - Die Abenteuer eines Saisonarbeiters in der Alpenregion im Eigenverlag publiziert. Nun ist der zweite Teil erschienen. Am dritten schreibt er gerade. Das Bücherschreiben im Lockdown „geht mir erstaunlich leicht von der Hand“ gesteht der Koch und zweifache Küchenmeister und gibt in süffisantem Ton, Einblicke in sein Leben. „Ich war sowohl Bergmann als auch Gleisarbeiter, beinahe hätte ich es sogar zum Lokführer geschafft. Das hat aber eine Farbenblindheit verhindert.“ Sogar als Genossenschaftsbauer in einem Betrieb in Hohenstein-Ernstthal – Geburtsort des Abenteuerschriftstellers und Südtirolurlaubers Karl May – arbeitete Beyer, direkt an der Quelle der zu verarbeitenden Produkte: „Wir hatten dort übrigens mehr Erbeeranbaufläche als hier im Martelltal.“ Außerdem wirkte er „am Bau der Druschba-Trasse in Sibirien“ mit, dem 550 Kilometer langen Bauabschnitt der insgesamt 2.750 Kilometer langen Erdgasleitung Sojus.
Ich habe nie gedacht, dass ich mich als Meisterkoch fühlen darf wie ein Lehrling im ersten Lehrjahr. Dank Südtirol darf ich das. Leider werde ich nicht jünger dabei.
Gelernt hat der in den 1950er Jahren geborene Beyer beim bekannten DDR-Fernsehkoch und Chefkoch Kurt Drummer, dessen Buch Von Apfelkartoffeln bis Zwiebelkuchen mit über 700 Rezepten immer noch als Klassiker durchgeht. „Unsere Lehre fand in Anlehnung an die französischen Grundregeln statt“, erinnert sich Beyer, vor allem „an Herings Lexikon der Küche, auch wenn man das Buch in der DDR nicht kaufen konnte.“ Während der Ausbildung mussten in der DDR obendrein verschiedene Praktika absolviert werden, etwa „im Schlachthof, in Gärtnereien, bei Bauern. So bekam man den Durchblick für die mühevolle Herstellung von Nahrungsmitteln.“
Köche hatten zu Wendezeiten kaum Aussichten auf eine gute Zukunft und es war am besten, das Land schleunigst zu verlassen, denn „die Gastronomie gab es nicht mehr und die Besatzer wollten uns Löhne zahlen, die nicht mal für die Miete reichten. Viele Genossen sind nach Italien gegangen. Die Kontakte zu ihnen sind mittlerweile nahezu alle gekappt.“
Speckknödel proklamieren eigentlich die Südtiroler als ihre Erfindung. Ich mach es kurz: Das ist sie nicht.
Wie hält es der Koch-Migrant mit der Südtiroler Regionalküche? Erst in diversen Altersheimen konnte Beyer in Gesprächen „mit wirklich alten Bäuerinnen erfahren, was wirklich einheimische Küche ist“, erzählt er und bemerkt „dass es gerade die italienischen Landsleute sind, die sie sogenannte Arme-Leute-Küche abgöttisch lieben.“ Bei der Verarbeitung von Fleisch „mussten wir DDR-Köche uns hingegen in Südtirol erst mal dreißig Jahre zurückversetzen.“
Beyer war einer der ersten Köche in Südtirol, der „alles was auf den Almen und im Wald wächst, verkochte“, zu „Likören und Saucen ansetzte“, oder damit Brot und Kuchen machte. „Ich bin ein Pionier der einheimischen Südtiroler Küche“ erzählt er schmunzelnd, „lange bevor meine Südtiroler Kollegen anfingen, Alpenheu unter die Steaks zu legen.“
Die beschränkte Reisefreiheit in der DDR empfand Beyer nicht sonderlich problematisch und betont: „Immerhin konnten wir bis in die Sowjetunion, Mongolei, Nordkorea, Vietnam, Kuba und über die Südroute bis nach Bulgarien.“ Spöttisch fügt er hinzu: „Südtirol isoliert sich hingegen selbst. Das ist eigentlich besorgniserregend, wobei eine gewisse westdeutsche Hörigkeit festzustellen ist, die sich mit der Europaeuphorie deckt.“
Man ignoriert jegliche Ausbildung von Ausländern und Migranten.
Beachtlich findet der Saisonkoch den Standpunkt, den ein Großteil der Südtiroler und Südtirolerinnen bezüglich Migranten und Migrantinnen einnimmt: „Egal, was die studiert, gelernt und gearbeitet haben. Man ignoriert jegliche Ausbildung von Ausländern und Migranten.“ Er muss es wissen, hat er es doch am eigenen Leib erfahren.
Sozusagen als Nachspeise zum geschichtlichen Austausch mit salto.bz serviert Beyer noch das Rezept zu seinem Leibgericht, das ihn in seine alte und neue Heimat führt – Brathuhn mit Reis: „Es ist ein sächsisches Gericht“ betont er und beginnt mit den Ausführungen: „Der Reis wird in Sachsen gleich gewürzt gekocht wie in Südtirol. Manche geben etwas Lorbeer dazu, andere Zwiebel und wieder andere, Knoblauch, Piment, auch Pfefferkörner und etwas gekörnte Brühe. Abgeschlossen wird immer mit Butter. Der Unterschied zu Südtirol ist lediglich, dass wir etwas edelsüßen Paprika als Gewürz mit zum Hähnchen geben. Das ergibt einen leicht bräunlichen Saucenton mit dem Säftl des Huhnes. Hierzulande gebe ich Rosmarin, Salz, Pfeffer dazu, verrühre das in Öl – manchmal auch in Knoblauchöl – und reibe damit das Hähnchen ein.“
Mahlzeit!
Ich reibe den Broiler auch
Ich reibe den Broiler auch immer mir Paprikapulver ein. Das ist typisch tirolerisch und war früher als Paprikahendl bei uns weit verbreitet. In der DDR ist es mir nur ein einziges Mal gelungen, in einer Gaststätte mindestens einen winzigen Broilerschenkel (ohne Paprika) zu ergattern, ich war aber auch nie in Sachsen, sondern immer nur in Thüringen. Üblicherweise waren die Viecher ja immer gerade ausgegangen. Und Schweinefleisch gab es schon gar nicht, weil ja Südtirol alles für seinen originalen Speck aufgekauft hat.
Es gib noch jemand in
Es gib noch jemand in Südtirol, der sich intensiv mit der DDR beschäftigt hat und alles besitzt, was es postgeschichtlich dort gegeben hat. Das weiß Martin Hanni, wird es aber wieder vergessen haben. Meine Ausstellung 2019 in Schlanders zu 30 Jahren Mauerfall war eine kleine Kostprobe davon.
Das Essen in den Gaststätten
Das Essen in den Gaststätten war tatsächlich sehr preiswert, aber leider hat es selten außer Kohl und Kartoffeln und mikroskopischen Fleischstückchen etwas anderes gegeben. Ich habe in der DDR meistens mit mitgebrachten Lebensmitteln gekocht. Dank guter Beziehungen zu Kleingärtnern (die ich mit Saatgut versorgt habe) war auch die Versorgung mit Gemüse recht gut, so dass ich nicht auf die HO-Läden angewiesen war.
"Südtirol isoliert sich
„Südtirol isoliert sich hingegen selbst. Das ist eigentlich besorgniserregend, wobei eine gewisse westdeutsche Hörigkeit festzustellen ist, die sich mit der Europaeuphorie deckt.“ kann ich nur bestätigen, bin Südtiroler aber in A/D/Neuseeland und Ägypten gelebt und nach mehr als 20Jahre Ausland wieder in die Heimat angekommen.....finde ich extrem Schade
Sie machen mich neugierig,
Sie machen mich neugierig, auf Ihre Bücher, Herr Kh Beyer!
- „Südtirol isoliert sich hingegen selbst. Das ist eigentlich besorgniserregend, wobei eine gewisse westdeutsche Hörigkeit festzustellen ist, die sich mit der Europaeuphorie deckt.“
- „Egal, was die studiert, gelernt und gearbeitet haben. Man ignoriert jegliche Ausbildung von Ausländern und Migranten.“
Haben Sie eine Idee, wie sich solche Einstellungen (oben) verändern, aufweichen lassen könnten? Was bräuchte es dazu?
Dieser Herr Beyer glaubt uns
Dieser Herr Beyer glaubt uns unwissenden Südtirolern einen Spiegel vorhalten zu können. Er hat nicht bedacht, dass es auch Südtiroler gibt, die über die DDR bestens Bescheid wussten. Ich hatte eine Aufenthaltsgenehmigung für die gesamte DDR in meinem Pass und habe in meinen Aufenthalten die vielen negativen, aber auch positiven Seiten dieses Regimes kennenlernen können. Das, was ich noch nicht wusste, habe ich dann in meinen Stasi-Akten gefunden. Da ergibt sich dann wieder eine Verbindung zu Südtirol, wobei nicht nur die
Stasi, sondern auch die „Freunde“ hier sehr aktiv waren.
Antwort auf Dieser Herr Beyer glaubt uns von Hartmuth Staffler
Herr Staffler, Kritik bietet
Herr Staffler, Kritik bietet mit der Darstellung des Problems, die Möglichkeit auf, etwas verbessern zu wollen.
In Südtirol ist es oft so, dass man Kritik erstmal brüsk abwehrt bzw. sich ungerechtfertigt kritisiert fühlt und jedes Wort als Angriff auf die eigene Person wertet (Beißreflex).
Kommen Änderungsvorschläge werden diese zum Teil als Bevormundung missverstanden. Häufig wird eine Mauer errichtet, die kaum mehr ein Argument passieren lässt. Und damit endet dann gemeinsames weiterdenken - um den bestimmten Sachverhalt oder eine Situation zu verbessern.
Antwort auf Herr Staffler, Kritik bietet von Herta Abram
Ich verstehe nicht, warum sie
Ich verstehe nicht, warum sie sich an mich wenden. Ich habe keine Kritik brüsk abgewehrt, sondern ich bin im Gegenteil für jede Kritik offen. Herr Beyer hat natürlich das Recht, die Südtiroler zu kritisieren und als Hinterwäldler darzustellen. Die gibt es bei uns tatsächlich. Als guter Kenner der DDR ist es meine Art, etwas differenzierter vorzugehen. Ich habe an der DDR auch einiges zu kritisieren gehabt, aber auch manches Positive gefunden. Unterm Strich war aber das System der DDR keineswegs besser als das System Südtirol, so viele Mängel es da auch geben sollte.
Antwort auf Dieser Herr Beyer glaubt uns von Hartmuth Staffler
Staffler Hartmuth (01.03.2021
Staffler Hartmuth (01.03.2021, 14:17) Sie sagen es...
Woran lesen Sie, Herr KH
Woran lesen Sie, Herr KH Beyer, ab, dass sich Südtirol selbst isoliere?
Antwort auf Woran lesen Sie, Herr KH von pérvasion
Wahrscheinlich weil die
Wahrscheinlich weil die Südtiroler nicht regelmäßig in die Sowjetunion, Mongolei, Nordkorea, Vietnam, Kuba und über die Südroute bis nach Bulgarien fahren, wie es die DDR-Bürger laut KH Beyer getan haben. Womit bewiesen wäre, dass Südtirol sich selbst isoliert, während die DDR dank des antifaschistischen Schutzwalles ihre Bürger in voller Freiheit überall hin fahren ließ.
Antwort auf Wahrscheinlich weil die von Hartmuth Staffler
Ich wollte jetzt eigentlich
Ich wollte jetzt eigentlich keine sarkastische Antwort.
Antwort auf Ich wollte jetzt eigentlich von pérvasion
Eine sachliche Antwort müsste
Eine sachliche Antwort müsste der Herr Beyer geben, mein Beitrag war keine Antwort, sondern ein ironischer Kommentar, zu dem ich mich aufgrund meiner langjährigen DDR-Erfahrung berechtigt gefühlt habe.
Um die Diskussion
Um die Diskussion weiterzuführen: Herr Beyer schreibt „Nach dem Zerfall des RGW, volkstümlich als Ostblock bezeichnet, wurden Millionen von Arbeitern über Nacht arbeitslos. Die unter sozialistischen Verhältnissen aufgewachsenen Bürger wurden dadurch, von Heut' auf Morgen, unvorbereitet unter neuen Gesetzen zu erpressbaren Tagelöhnern und Sklaven. Sie verrichten seitdem Arbeiten als Erntehelfer, Tagelöhner, Fernfahrer und Saisonarbeiter, fernab ihrer Nachbarn und Familien. Sie werden von einer unbeschreiblichen Bürokratie, von einer sie betrügenden kapitalistischen Gesellschaft rechtlos behandelt und maßlos ausgebeutet. Ihre gesamten beruflichen als auch intellektuellen Bildungsabschlüsse und Urkunden werden nicht anerkannt und sind wertlos geworden.“ Für meine Bekannten und Verwandten in der ehemaligen DDR gelten diese Aussagen nicht. Ein Cousin von mir hat sich selbständig gemacht und ist als Gleisbauunternehmer erfolgreich, eine Cousine führte eine erfolgreiche Modeboutique, eine andere Cousine hat ihr Diplom als Innenarchitektin behalten, ist aber lieber im Bereich Schauspielwesen tätig. Von erpressbaren Tagelöhnern oder Sklaven ist mir nichts bekannt. Vielleicht könnte der Herr Beyer uns das näher erläutern.
Antwort auf Um die Diskussion von Hartmuth Staffler
Nur weil Ihnen "nichts
Nur weil Ihnen „nichts bekannt“ ist, heißt das doch nicht, dass es das nicht gibt....
Antwort auf Nur weil Ihnen "nichts von Ludwig Thoma
Mir sind keine Sklaven in der
Mir sind keine Sklaven in der ehemaligen DDR bekannt, aber wenn sie davon Kenntnis haben, sollten sie schnellstens die Polizei verständigen.
Die Suizidrate ist in
Die Suizidrate ist in Südtirol wesentlich niedriger als in allen vergleichbaren Gebieten. Sie sollten sich informieren, bevor sie etwas schreiben, und nicht davon ausgehen, dass die Südtiroler so ungebildet sind, dass sie ihnen alles glauben.
Das ist mir jetzt ehrlich
Das ist mir jetzt ehrlich gesagt eine etwas zu diffuse Begründung.
Und „es gibt in Südtirol sehr wohl Gruppen oder Parteien, die sich maßgeblich dafür aussprechen“. Die gibt es fast überall, würde ich behaupten.
Interessant, wie Herr Beyer
Interessant, wie Herr Beyer die Geschichte nach dem 2. Weltkrieg erlebt hat, und wie er seinen Herkunftsstaat DDR und Südtirol betrachtet. Dabei geht es heute nicht mehr darum, die Gegenteile Kommunismus / Kapitalismus, je nach Standpunkt, ins Leben umzusetzen. Beide Ideologien haben reichlich beweisen, ungeeignet für einen weltweiten Weg zu mehr Frieden, Freiheit, Gemeinwohl und Klimaschutz zu sein. Ideologen verteidigen erfahrungsgemäß ihre Standpunkte, koste es was es wolle.... sie sind nicht zukunftsfähig. Lasst uns Geschwister sein, die sich bei allen Verschiedenheiten mit Respekt begegnen und voneinander lernen, die unsere wunderbare Erde vom Raubbau der Gewinnmaximierung Weniger befreien. Bei allem Spott, dem die folgende Aussage ausgeliefert ist, wage ich zu sagen : letztlich zählt nur die Liebe, sie allein ist wirklich zukunftsfähig.
Das ist ja schön, jetzt haben
Das ist ja schön, jetzt haben wir auf Salto einen richtig überzeugten Kommunisten(Stalinisten?) alter Prägung, der immer noch davon überzeugt ist, der böse Westen sei schuld, dass der gute Osten sich im Nichts aufgelöst hat.
Machen Sie bitte weiter, ich lese gerne ihre realitätsfremden Ansichten.
Ich bin fasziniert von so
Ich bin fasziniert von so starker Überzeugung! Das muss doch weh tun, nicht mehr in einem Lande leben zu können, wo, ich zitiere Sie mal, „sozialistische Länder mit ihrer Struktur, wirklich Umweltschutz, Natur, Menschenanliegen, Respekt von Leben, Gesundheit und Respekt vor gesellschaftlichen Gesetzen garantieren.“
Einfach nur krass!!
Sehr geehrter Herr
Sehr geehrter Herr Oberkommunist, Sie kennen weder meine Familie, noch mich. Bitte unterlassen Sie es, von Namen auf Familien zu schliessen.
Und was Stalin betrifft, das war natürlich keine Diktatur, das war eine sozialistischer Musterstaat, der, wie Sie weiter unten schreiben, mit Struktur, wirklich Umweltschutz, Natur, Menschenanliegen, Respekt von Leben, Gesundheit und Respekt vor gesellschaftlichen Gesetzen garantieren.
Und ich zitiere niemanden, schon gar nicht Verbrecher wie Goebbels, Stalin oder Honecker.
Eine Frage hätte ich noch,
Eine Frage hätte ich noch, sehen Sie überhaupt keine Vorteile in einem kapitalistischem Land wie Südtirol zu leben? Ich denke da zum Beispiel an die Möglichkeit Ihre systemkritische Meinung zu äussern, ohne die Angst, dafür im Gulag zu landen?
Antwort auf Eine Frage hätte ich noch, von Manfred Gasser
Ohne jetzt Herrn Beyers
Ohne jetzt Herrn Beyers unkritische Haltung verteidigen zu wollen, Herr Gasser, hat das mit dem Kapitalismus nichts zu tun.
Es geht einerseits um Demokratie vs Diktatur sowie andererseits um Kapitalismus vs Sozialismus.
Sehr geehrter Herr Beyer,
Sehr geehrter Herr Beyer, nein, mein „Trojer“ kommt nicht aus Sterzing, sondern aus Terlan / vorher Schlanders.
Wird Ihre absolute Gewissheit, dass nur „sozialistische Länder“ zukunftsfähig seien, nicht massiv von den konkreten Wirklichkeiten von DDR, Sowjet-Union, China u.ä. widerlegt ?
es bleibt eigentlich nur eine
es bleibt eigentlich nur eine Frage:
warum sind Sie nicht Koch im geliebten Arbeiterstaat Nordkorea, Ihrem Paradies?
(übrigens: China wird von einer Milliardärs-Elite mit turbokapitalistischem Anstrich verwaltet: da ist wenig Soziales, noch weniger Sozialismus. Ähnliches gilt für Venezuela: eine erzkapitalistische und hochkorrupte Amigotruppe um die Präsidentenfamilie saugt schamlos das Land aus: alle wollen und würden fliehen, wenn sie nur könnten...)
Antwort auf es bleibt eigentlich nur eine von Peter Gasser
Bei Peter Gasser bleibt
Bei Peter Gasser bleibt eigentlich auch nur eine Frage: wieso kommentieren sie jeden Satz auf salto und nicht woanders. (Übrigens: ich spar mir die links und Vergleiche wo sie sich über ihr eigenes Phänomen schlau lesen könnten!>
Antwort auf Bei Peter Gasser bleibt von Michael Kerschbaumer
... musste ja irgendwann
... musste ja irgendwann kommen:
https://www.salto.bz/de/comment/88748#comment-88748