Im falschen Körper stecken

-
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb kommt derzeit nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Neben langen Wartezeiten und schwierigen Arbeitsbedingungen bleibt auch die Sensibilisierung für queere Themen auf der Strecke. Das Ergebnis: Trans*Menschen wenden sich mittlerweile an Fachpersonal im Ausland – auf eigene Kosten. Denn lebenslang im falschen Körper zu stecken, ist keine Belanglosigkeit.
-
 Michael Peintner: „Es braucht ein ganzheitliches Konzept und eine fortführende Weiterbildung zu dem Thema, denn 20 Jahre alte Ansätze sind längst veraltet.“ Foto: privat
Michael Peintner: „Es braucht ein ganzheitliches Konzept und eine fortführende Weiterbildung zu dem Thema, denn 20 Jahre alte Ansätze sind längst veraltet.“ Foto: privat„Es gibt im Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Behandlungsrichtlinie für Trans*Menschen, wo die Zuständigkeiten klar geregelt sind. Aber sie hilft wenig, wenn die Verantwortlichen sich mit dem Thema der Geschlechtsidentität bisher noch nie auseinandergesetzt haben und mit dieser zusätzlichen Aufgabe überfordert sind“, erklärt Michael Peintner. Der Südtiroler Psychotherapeut arbeitet in Innsbruck und ist Mitglied in der österreichischen Trans*/Inter*-Expert*innenkommission. Sanitätsdirektor Florian Zerzer lehnte bisher ein klärendes Gespräch mit Peintner ab.
„Wir sind gegen jede Form von Diskriminierung. Denn jeder Mensch hat Rechte, hat das Recht sich frei zu entfalten, hat das Recht gesehen und gehört zu werden. Dies muss für jeden und jede von uns gelten, denn Respekt darf nicht bei der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität enden“, erklärte Gesundheitslandesrat und Landeshauptmann Arno Kompatscher am vergangenen 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie.
Südtirol ist außerdem Teil des italienweiten Antidiskriminierungsnetzwerks Re.a.dy. Abseits offizieller Lippenbekenntnisse sieht die Situation für Betroffene wenig rosig aus. Etwa machte der Verein Centaurus vor rund einem Jahr darauf aufmerksam, dass einer Trans*Person von einem Bozner Hausarzt die vorgeschriebenen Untersuchungen verweigert wurden. Die Person solle sich an einen anderen Arzt wenden.
Der erste Schritt liegt darin, den Betroffenen zuzuhören.
„Ärztliches Personal reagiert mitunter abwertend und nimmt die Personen in ihren Anliegen nicht ernst. Leider agieren sie in einem rechtlichen Graubereich, entsprechende Gesetzesentwürfe wurden in Rom bisher immer abgelehnt“, so Peintner. Der österreichische Nachbar sei hier vorbildlich und habe eine der besten Trans*Gender-Gesundheitsversorgungen innerhalb der EU.
Die GeschlechtsangleichungWenn das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht dem eigenen subjektiv empfundenen Geschlecht entspricht, können diese Personen Geschlechtsangleichungen, auch Transitionsprozess genannt, durchführen. Die erste medizinische Maßnahme ist üblicherweise eine gegengeschechtliche Hormontherapie. Allerdings muss vorher eine psychiatrische und/oder eine psychologische/psychotherapeutische Fachperson die Geschlechtsinkongruenz als eine wahrscheinlich andauernde Situation feststellen. Erst nach mindestens einem Jahr in der Hormontherapie können – sofern das die betroffenen Personen auch wollen, geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt werden.
Dafür ist eine Zuweisung in eine spezialisierte Klinik im Ausland aus der Gynäkologie beziehungsweise Urologie notwendig, da solche Eingriffe nicht in Südtiroler Krankenhäuser durchgeführt werden können. „Betroffene wissen meistens sehr gut Bescheid, welche Kliniken im Ausland gute Ergebnisse vorweisen. Leider kommt es dann vor, dass sie von den Südtiroler Überweiser*innen an irgendeine Klinik zugewiesen werden, ohne die Bedürfnisse der Trans*Menschen zu berücksichtigen“, sagt Peintner.
„Es braucht ein ganzheitliches Konzept und eine fortführende Weiterbildung zu dem Thema, denn 20 Jahre alte Ansätze sind längst veraltet. Es gibt Psychiater*innen, die Betroffene auffordern, sich einfach mit ihrem biologischen Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, abzufinden“, sagt der Psychotherapeut. In Österreich müssen hingegen drei Gutachten die Geschlechtsinkongruenz bestätigen, um medizinische Maßnahmen einzuleiten. In diesem Prozess sind drei verschiedene Berufsgruppen involviert, nämlich die Psychiatrie, die Psychotherapie und die klinische Psychologie. „Das ist wichtig, da Eingriffe im Operationssaal nicht mehr rückgängig gemacht werden können“, so Peintner.
Unser binäres System von Mann und Frau ist sehr heteronormativ.
Damit liegt bei den Gutachter*innen eine große Verantwortung. Die Therapiesitzungen deshalb in die Länge zu ziehen, um eine Entscheidung hinauszuzögern, sei deshalb keine Seltenheit. „Auch bei mir kommt es vor, dass ich nicht weiß, ob eine Person wirklich trans ist. Aber meistens ist schon nach wenigen Sitzungen klar, was eine Person möchte. Heute haben sie durch das Internet die Möglichkeit, sich vorab über das Thema ausführlich zu informieren“, erklärt der Experte.
Entwicklung der GeschlechtsidentitätWährend ein Kleinkind noch spielerisch mit den Geschlechtsmerkmalen umgeht, wird die Geschlechtsidentität spätestens mit Beginn der Pubertät relevant. „Die Belastung beginnt mit der Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale in der Pubertät. Die Mädchen entwickeln sich zu Frauen und die Jungen zu Männer. Trans*Menschen merken, dass diese körperlichen Merkmale nicht zu ihnen passen. Das kann Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Depressionen, Suizidalität oder soziale Phobie zur Folge haben“, sagt Peintner. In einem wertschätzenden Umfeld fallen diese psychischen Symptome weniger stark aus.
Ansonsten wird der Alltag leicht zu einem Hindernislauf, angefangen mit der Wahl der Toilette in der Schule: Ein biologisches Mädchen mit einer männlichen Identität müsste eigentlich auf die Toilette für Jungen gehen. Auch der Vornamen wird häufig zum Problem. „Unser binäres System von Mann und Frau ist sehr heteronormativ“, sagt Peintner, der sich selbst im queeren Spektrum einordnet. Deshalb brauche es auf fachlicher Ebene eine kritische Auseinandersetzung. „Der erste Schritt liegt darin, den Betroffenen zuzuhören.“
Der Psychotherapeut war vor Jahren einer der Wenigen, die in Südtirol auf queere Themen aufmerksam gemacht haben. Heute lebt und arbeitet er in Innsbruck. Im Laufe der Zeit seien auch die Menschen hierzulande offener geworden. Beispielsweise können junge Trans*Menschen in einigen Schulen die Toiletten ihrer Wahl benutzen.
Gleichzeitig sind sie weiterhin von Mobbing und Diskriminierung betroffen. Die Situation des familiären Umfelds unterscheide sich hier von Fall zu Fall. „Etwa gab es auch eine Situation, wo die Oma aufgeschlossener ist als die Mutter und das Kind zur Psychotherapie begleitet. Leider müssen einige Betroffene aber auch erfahren, dass sie zuhause nicht mehr erwünscht sind. Es kommt auf die Persönlichkeit der Eltern an“, sagt Peintner.
„Heute gibt es nicht mehr den einen Trans*Menschen“, so der Experte. Neben dem Wunsch, die Geschlechtsmerkmale zu ändern, gibt es auch nicht binäre Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich identifizieren. „Niemand hat ein Problem damit, wenn Sie sich mit ihrem Geschlecht als Frau oder Mann identifizieren können. Aber es geht darum, dass es darüber hinaus noch viel mehr gibt.“
Seine Vision ist es, dass im gesamten Südtiroler Sanitätsbetrieb von der Reinigungskraft bis zum Primar ein queerfreundliches Verhalten an den Tag gelegt wird. Auch Centaurus setzt sich für die Sensibilisierung der Gesellschaft und die Unterstützung von Betroffenen ein. Bei Fragen können sich Interessierte direkt an den Verein wenden.
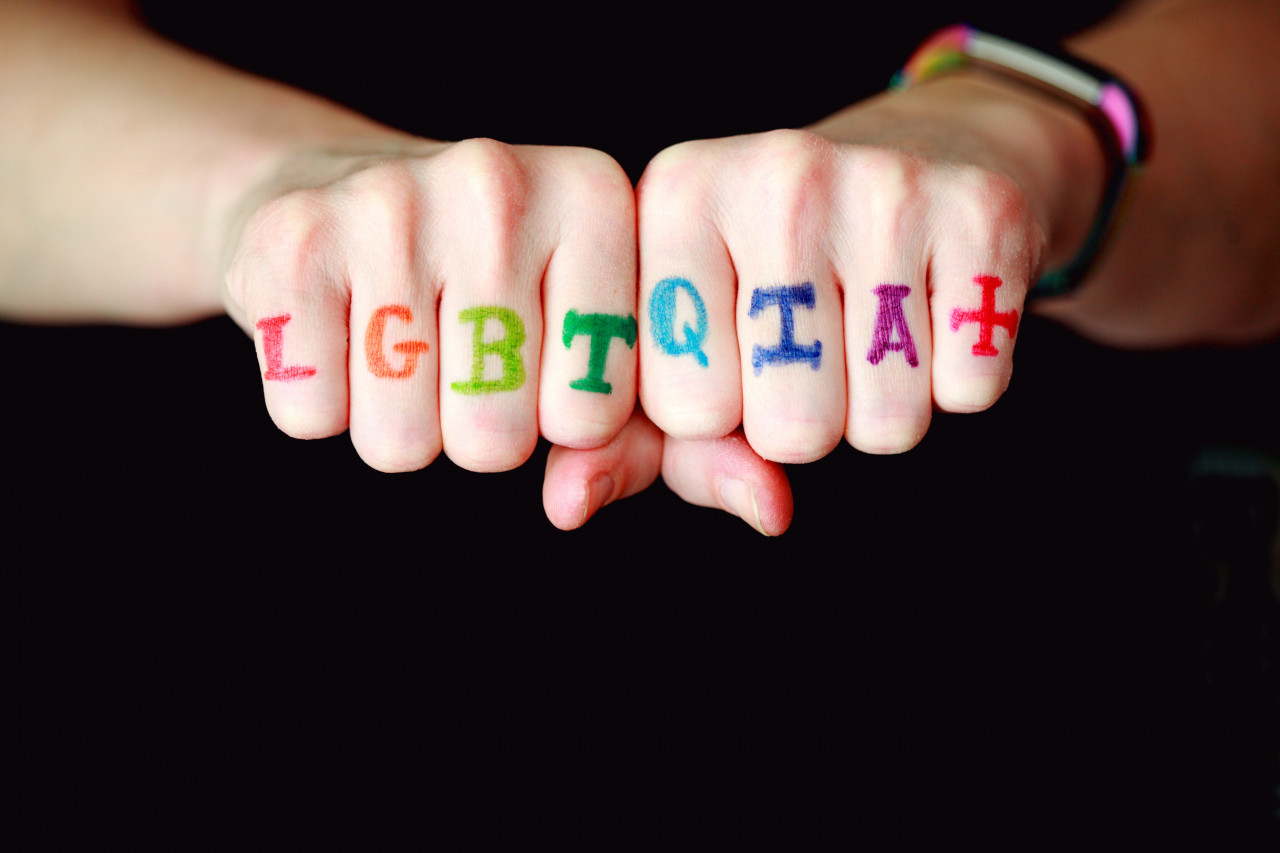

Im Bericht findet sich…
Biologisches Geschlecht - Geschlechtidentität.
Im Bericht findet sich folgendes Zitat: „Auch bei mir kommt es vor, dass ich nicht weiß, ob eine Person wirklich trans ist. Aber meistens ist schon nach wenigen Sitzungen klar, was eine Person MÖCHTE [Hervorhebung durch den Kommentator]“:
Es geht doch bei der Thematik nicht darum, was eine Person „MÖCHTE“, sondern darum, was eine Person IST.
Festzuhalten ist, dass bei wohl mehr als 99,9% der Personen körperliche und geistig erfasste Geschlechtsidentität dieselbe sind, und Abweichungen davon sehr sehr selten vorkommen, und dass das Geschlecht bei 99,9% der Neugeborenen körperlich eindeutig ist.
Die Diskussion betrifft also sehr sehr wenige biologische Ausnahmen, bei denen bei der Ausformung des Geschlechtes durch hormonelle Prozesse „Unregelmäßigkeiten“ in der Steuerung dazu geführt haben, dass z.B. ein Körper zum Manne wird, „das Gehirn aber weiblich bleibt“.
Diesen Menschen gebührt Respekt und jede Hilfe.
Die SO SIND - und nicht denen, die (nur eben) anders sein „möchten“.
.
Denn was tun wir dann mit dem kleinen der groß, dem braunen der weiß, dem molligen der schlank, dem schmächtigen der athletisch, also auch anders als er eben biologisch ist, sein MÖCHTE?
Antwort auf Im Bericht findet sich… von Peter Gasser
Woher nehmen Sie die 99,9%…
Woher nehmen Sie die 99,9%. Hatten Sie schon mal mit Trans*identen Personen gesprochen? Wissen Sie. welchen Leidensadruck diese haben? Wenn Sie diese Erfahrungen haben, dann können Sie mitreden. Ansonsten sollten Sie auf Fachmeinungen hören. Trans*personen haben keine Entscheidungen getroffen so zu sein, sondern das körperliche Geschlecht stimmt nicht mit dem subjektiv empfundenen Geschlecht überein. Diese Geschlechtsinkongruenz ist international -unter wissenschaftlich fundierten evidenzbasierten Forschungen- als Belastung anerkannt. Wenn diese Personen nicht die Möglichkeit einer (*medizinischen und rechtlichen) Geschlechtsanpassung erhalten, dann sind die Folgen: Essstörungen, Depressionen, Angststörungen, Selbstverletzungen bis hin zur Suizidalität. Denken Sie mal zuerst darüber nach und informieren Sie sich bei Fachleuten. Danke!
Antwort auf Woher nehmen Sie die 99,9%… von miky
Ihre Aussage ist dieselbe…
Ihre Aussage ist dieselbe wie meine.
Danke gleichfalls!
.
Ein link (auch zu den 99,9%), den Sie auch in 30s gefunden hätten:
https://www.socialnet.de/lexikon/Transidentitaet#:~:text=Von%20somatisc…
Antwort auf Ihre Aussage ist dieselbe… von Peter Gasser
Ihr Link ist nicht hat ein…
Ihr Link ist nicht hat ein Beleg für Ihre 99,9%. Auch hatten Sie auf meine Fragen nicht geantwortet. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor: Sie als biologischer Mann werden gezwungen von nun als Frau zu leben, obwohl das für Sie komplett nicht stimmig ist. Das ist genau das Gleiche. Sie sind diskriminierend, respektieren nicht Menschenrechte und zeigen weder Akzeptanz noch Wertschätzung. Dan wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg mit diesen Persönlichkeitseigenschaften.
Antwort auf Im Bericht findet sich… von Peter Gasser
Gibt es für die mehrfach…
Gibt es für die mehrfach behaupteten 99,9% auch Belege/Quellangaben?
Oder ist das wieder eine typisch Petersches P mal Daumen „Faktum“?
Ach, das ist eine Schätzung?
Schätzungen wie jene bei Holzeisen im Verhör ausgedrückte- werden bei Ihnen irgendwie zu einer Gewissheit:
Zitat aus Ihrer nachträglich verlinkten Quelle (wobei Sie es irgendwie selbst nie zustande bringen, ein Zitat aus einer Quelle herauszugreifen und anzubringen):
„Nach Schätzungen verschiedener Autor*innen liegt die Inzidenzrate bei trans* Frauen bei 1:1.000 und bei trans* Männern bei 1:2.000.“