Mutterbande

-
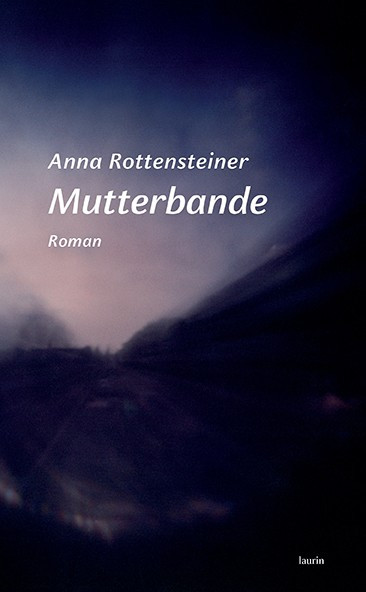 „Mutterbande“ von Anna Rottensteiner: „Gerade in einem Grenzraum wie dem unseren wechseln Zugehörigkeiten und Ausschlussmechanismen und greifen besonders stark in das Leben der Individuen ein.“ Foto: Anna Rottensteiner
„Mutterbande“ von Anna Rottensteiner: „Gerade in einem Grenzraum wie dem unseren wechseln Zugehörigkeiten und Ausschlussmechanismen und greifen besonders stark in das Leben der Individuen ein.“ Foto: Anna RottensteinerSALTO: Was hat Sie dazu inspiriert, einen Roman über die Erfahrungen von Frauen zu schreiben, die von den Entscheidungen anderer geprägt wurden?
Anna Rottensteiner: Die Entscheidungen im familiären Umfeld wurden über Jahrhunderte hinweg vom männlichen Oberhaupt der Familie, vom pater familias, getroffen, und die Leben von Frauen, Töchtern, aber auch Söhnen waren von der Entscheidung dieses einen Menschen geprägt, sei es im Guten wie im Schlechten. Oft waren es auch Gründe wie der Kinderreichtum und die Armut, die dazu führten, dass einzelne Kinder weggegeben wurden. Dass sich dabei verschiedene Formen des Widerstands ausprägten, möchte ich auch in meinem Buch aufzeigen.
Und es geht viel um Mutterbande im zweifachen Wortsinn: Zum einen um die Verbindungen, die Mütter und Töchter zueinander haben; zum anderen ist es eine Bande weiblicher Stimmen, die hier ihre Geschichten erzählen und uns so andere Erfahrungen lesen lassen.
Wie haben Sie die historischen Ereignisse und Figuren recherchiert, die in Ihrem Buch vorkommen, wie zum Beispiel Louise Straus-Ernst und Maja?
Mein Roman entwickelt sich anhand historisch wesentlicher Ereignisse aus dem Euregio-Raum, die im kulturellen Gedächtnis weniger verankert sind. Diese sind wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet, zum Beispiel die Arbeitsmigration von Tarentinerinnen nach Innsbruck, die „fatti di Innsbruck“ von 1906, also die Auseinandersetzungen rund um die Errichtung einer italienischsprachigen Iuridischen Fakultät an der Universität Innsbruck, die zu Ausschreitungen zwischen Deutschnationalen und Irredentisten und letztendlich zu Angriffen auf italienische Einrichtungen in Innsbruck führten.Aber auch die zwei Jahre des Aufenthalts von italienischen Truppen in Nordtirol vom Waffenstillstand der Villa Giusti 1918 bis zur Ratifizierung des Vertrags von Saint Germain 1920.
Dem Verfassen des Romans ging eine lange Zeit des Lesens und Forschens voraus, aber es hat sich gelohnt, da ich viel Neues erfahren habe.
Weiters die Bombardierung Bozens 1944 – 1945 und die Jahre der Spannung, die 1970er Jahre in Italien. Dem Verfassen des Romans ging eine lange Zeit des Lesens und Forschens voraus, aber es hat sich gelohnt, da ich viel Neues erfahren habe. Was Louise Straus-Ernst betrifft, so konnte ich auf die sehr gut recherchierte Biographie von Eva Weissweiler über sie zurückgreifen und auf die Autobiographie ihres Sohnes Jimmy Ernst. Außerdem haben mir kompetente Menschen immer wieder bereitwillig Informationen zur Verfügung gestellt.
Der RomanIn ihrem Roman „Mutterbande“ erforscht Anna Rottensteiner die komplexen Beziehungen zwischen Frauen, die von den Entscheidungen anderer geprägt wurden. Die Geschichte spielt in verschiedenen Orten wie Innsbruck, Bozen, Ala und Tarrenz und umfasst ein ganzes Jahrhundert, von den historischen Ereignissen des Ersten Weltkriegs bis hin zu den sozialen und politischen Veränderungen der 1970er Jahre.
Durch die Verbindung von historischer Recherche und literarischer Imagination schafft Rottensteiner ein vielschichtiges Bild der Vergangenheit und Gegenwart. Sie gibt den Frauen eine Stimme, die weder hier noch dort dazugehören, und zeigt auf, wie sich das Fremd-Sein über Generationen weitervererbt. Die Figuren von Ada, Toni, Betti und Tricy sind nur einige Beispiele für die Frauen, deren Leben von Fremdheit und der Suche nach Zugehörigkeit geprägt sind. Die Beziehungen zwischen den Figuren sind von Anspannung und Schweigsamkeit geprägt, wie in dieser Passage deutlich wird: „Wie sehr kann man Stille hören, fragte sich Ada, während sie sich aus ihrer Vermummung schälte. Sie jedenfalls konnte es sehr gut, hatte früh gelernt, die unterschiedlichen Facetten der Schweigsamkeit zu unterscheiden. Eine Schweigsamkeit, in der die Sprachen stillzustehen schienen, habt acht standen, sull’attenti, und nur auf die Gelegenheit warteten, um übereinander herzufallen.“Das Thema des Fremd-Seins und der Suche nach Zugehörigkeit zieht sich durch Ihr Buch. Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema, und warum?
Ich glaube, es ist eines der wesentlichen „Menschheits-Themen“, die das Zusammenleben in der Gesellschaft wesentlich prägt, also politisch ist, und dabei auch tief in die Psyche jedes einzelnen Menschen hineingreift. Gerade in einem Grenzraum wie dem unseren wechseln Zugehörigkeiten und Ausschlussmechanismen und greifen besonders stark in das Leben der Individuen ein. Letztere nehmen heute ja wieder zu, es werden neue alte Festungen, Barrieren und Grenzen gebaut, sprachliche wie politische. Ich wollte das Fremd-Sein in unterschiedlichen Facetten darstellen und dabei die Frage streifen, wie sich dieses Fremd-Sein über Generationen weitervererbt. Meine Figuren befinden sich dabei immer zwischen allen Stühlen, können sich nirgends eindeutig zuordnen, gehören nirgends klar dazu. Das ist ihr Fluch, aber auch ihre Freiheit. Und ich verorte sie bewusst in unserer Region, in der (sprachliche) Zugehörigkeit dermaßen viel definiert – und damit auch ausgeschlossen – hat.
Wie sehen Sie die Verbindung zwischen den Erfahrungen der Frauen in Ihrem Buch und der heutigen Gesellschaft?
Frauen, und nicht nur sie, sind heute genauso von Migration betroffen und erleben die Erfahrung von Fremd-Sein in der Gesellschaft, in der sie ankommen. Es ginge darum, sich zu öffnen und dieses NomadInnentum nicht nur als Übel zu begreifen.
Wo und wie ist der Plot zur Geschichte entstanden? Am Ritten oder in Innsbruck? Oder ganz woanders?
Ich schreibe zumeist an meinem Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer, die Erfahrungen und Eindrücke nehme ich natürlich von den Orten, die im Buch vorkommen, mit.
Die AutorinAnna Rottensteiner ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Bis 2023 war sie die Leiterin des Literaturhauses am Inn. 2017 wurde sie mit dem Internationalen Preis Merano Europa für die beste Lyrikübersetzung aus dem Italienischen ins Deutsche ausgezeichnet. Das Buch Mutterbande ist in der Edition Laurin erschienen.
Wie geht es Ihnen mit Orten aus der Erinnerung, die verschwinden oder eine andere Identität annehmen?
Wie ich in meinem Buch sage: Orte ändern sich ständig. Jede Erfahrung ist die Erinnerung dieser Erfahrung. Vielleicht gilt das auch für Menschen. Man kann sich aber aus der subjektiven Wahrnehmung eines Ortes herausschälen, indem man sich mit der ganz konkreten Geschichte des Orts, des Viertels, der Straße beschäftigt und dadurch eine Empfindung von Tiefenschärfe für diesen gewinnt. Vor allem wollte ich eine Sprache finden, wie man dieser Erinnerung an Verschwundenes (gerade in den letzten beiden Texten), das ja im Inneren widerhallt, Raum geben kann.
Wie wichtig ist Ihnen die Verbindung zwischen Fakten und Fiktion in Ihrem Buch?
Ich liebe das Spiel mit Fakten und Fiktion. Letztendlich werden in der literarischen Aneignung beide Ebenen gleichwertig. Sie vermischen sich und lassen so neue Realitäten entstehen.
Was hoffen Sie, dass Leser aus Ihrem Buch mitnehmen oder reflektieren?
Der Mutterbande zuzuhören und an ihren Geschichten und Erfahrungen teilnehmen. Jede und jeder wird aus der eigenen Lebenssituation hoffentlich etwas mitnehmen, was für sie und ihn wichtig sein könnte.
Weitere Artikel zum Thema
Kultur | Bibliophile Fragen„Vertrauensvoll und freudig“
Kultur | Bibliophile Fragen„Jedes Buch ist es wert...“
Kultur | ArchitekturDer „Chipperfield“ kommt!




Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.