Zwischen ADHS und Hörbeeinträchtigung

-
10:30 Uhr
Supplenzstunde in der 3. Klasse. Wir haben uns im Team die Deutschstunden der 3. Klasse aufgeteilt und machen sie als Überstunden. Trotz energischer Suche hat man noch immer keinen Mutterschaftsersatz für die Lehrerin gefunden, die Mitte September ihren Mutterschutzurlaub antrat. Die 3b ist deshalb im Moment ohne Deutschlehrerin. Niemand in unserem Team war scharf darauf, die zusätzlichen Stunden zu übernehmen, aber was wäre die Alternative?
Wir machen kreative Schreibübung, ich setze mich an die Seite eines Schülers, der große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat. Während einige Kinder in seinem Alter bereits kohärente Aufsätze schreiben, ist es für ihn nach wie vor schwierig, aus einzelnen Wörtern einen Satz zu bilden. Mehrere Gespräche mit den Eltern, ihn abklären zu lassen, blieben erfolglos. Sie sind der Meinung, ihr Kind solle nach seinem Tempo lernen und wachsen dürfen. Das kann ich verstehen. Was die Eltern allerdings nicht sehen, ist, dass das bedeutet, dass eine Lehrperson sich rund um die Uhr um ihn kümmern muss und das auf Kosten anderer Kinder geht, die auch dringend Hilfe bräuchten, aber eben vielleicht nicht sooo dringend. Hätte er eine Diagnose oder eine Beschreibung, dann hätte die Schule Anrecht auf einige Stunden der Unterstützung durch eine Integrationslehrperson. Zumindest theoretisch! In der Praxis ist es nämlich so, dass man kaum mehr Lehrpersonen – vor allem keine ausgebildeten – dafür findet, weil jede Fachkraft für den Hauptunterricht gebraucht wird. Das bedeutet, dass man Klassen kaum mehr doppelt besetzen kann und das bei zunehmend komplexer werdenden Lerngruppen.
Wo sind sie denn, die ganzen Leute aus den Kommentarspalten? Die, die wüssten, wie man die Probleme in der Schule lösen könnte, die, die meinen, das bisschen Kinsen, das könne doch nicht so schwierig sein.
Während ich besagtem Jungen wieder einmal versuche, die richtige Stifthaltung zu zeigen, drei Kinder in einer Reihe hinter mir stehen, um ihre Aufgaben von mir gegenlesen zu lassen und sich dabei halb aus Langeweile, halb aufgrund früheren Auseinandersetzungen, anfangen, gegenseitig in den Bauch zu zwicken, bis einer schreit und mit der Faust ausholt, ein anderer beim Stuhlwippen samt Stuhl auf den Boden fällt und ich immer noch warte, bis das eine Mädchen, das ich nach der Pause naseblutend mit einer Freundin ins Bad geschickt habe, zurückkommt - selbst nach dem Rechten schauen geht sich nicht aus, wenn ich alleine in der Klasse bin - frage ich mich: Wie soll ich dem allem gleichzeitig gerecht werden? Ich kann hier alleine auch mit besten Vorsätzen und höchster didaktischer Finesse eigentlich nur scheitern.
Und dann frage ich mich wieder einmal trotzig: Wo sind sie denn, die ganzen Leute aus den Kommentarspalten? Die, die wüssten, wie man die Probleme in der Schule lösen könnte, die, die meinen, das bisschen Kinsen, das könne doch nicht so schwierig sein. Warum bewerben sie sich denn nicht einfach auf diese freie Vollzeitstelle in der Grundschule, bei der die einzige Voraussetzung ein Maturadiplom ist, warum?!
-
Aus dem Tagebuch einer Grundschullehrerin
Maria T. schildert den Tagesablauf einer Grundschullehrerin – vom frühen Morgen bis zum Feierabend. Damit möchte sie die Realität des Schulalltags sichtbar machen: die Anforderungen, Belastungen und strukturellen Probleme, die häufig hinter den Kulissen versteckt bleiben. Das Tagebucheiner Grundschullehrerin auf SALTO ist der Versuch aufzuzeigen, wie der Schulalltag tatsächlich aussieht: zwischen Unterricht, Betreuung, Verwaltungsaufgaben, Elterngesprächen und den vielfältigen Anforderungen, die an Lehrpersonen gestellt werden.
Die Autorin möchte anonym bleiben. Wir kommen diesem Wunsch nach, darum haben wir den Namen der Autorin geändert. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt.
-
12:45 Uhr
Geschafft, denke ich und atme durch. Der Unterricht endet, die Kinder werden von ihren Eltern abgeholt oder können das Schulgelände alleine verlassen. Der Schulhof leert sich, einige Eltern verspäten sich, um 12:50 ist nur mehr ein Mädchen da. Ich darf die Schülerin nicht alleine nach Hause schicken, da ihre Eltern ihr keine Genehmigung dafür ausgestellt haben - sie darf nur von Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Also nehme ich das Mädchen an der Hand, wir gehen gemeinsam ins Schulgebäude, ich rufe bei ihr zu Hause an. Versuche auf Deutsch, Italienisch und schließlich auf Englisch zu erklären, dass die Eltern ihr Kind abholen müssen.
Während ich in der Zwischenzeit das digitale Register auf den aktuellen Stand bringe, Absenzen eintrage und die Stundendokumentation mache, sehe ich im Augenwinkel, wie dem wartenden Mädchen die Tränen übers Gesicht kullern. Ich atme tief durch, setze mich zu ihr und tröste sie. Ich höre mich beschwichtigende Dinge sagen, dass ihre Mama sie lieb habe und bestimmt nur im Stau stehe und sicher gleich da sei. Ich weiß, dass ich das eigentlich nicht tun müsste, aber wer lässt schon eine Achtjährige alleine warten, nur weil die eigene Arbeitszeit vorüber ist? Was kann das Mädchen dafür, dass ich mehrmals in der Woche mit einem Kind, das nicht abgeholt wird, Überstunden mache, die ich nicht bezahlt bekomme?
-
13:30 Uhr
Die Mutter kommt, sichtlich außer Atem, die Treppen zur Schule hochgelaufen, das Mädchen läuft ihr entgegen. Sie zeigt auf ihr Telefon und den geöffneten Übersetzer: „Ich habe geglaubt, dass heute Mensa ist“. Ich tippe in das Gerät, dass die Tochter mittwochs nicht für die Mensa angemeldet ist und um 12:35 Uhr abgeholt werden muss.
Die Mutter nickt und lächelt. Ich nicke zurück, weil ich natürlich verstehe, dass es gerade für Familien mit Migrationshintergrund schwierig ist, den Durchblick zu behalten. Die Mutter fragt, ob ich ihr das mit der Mensa und den Anmeldungen noch einmal erklären kann. Ich versuche ihr auf Englisch alle Fragen zu beantworten, verweise auch auf das Sekretariat, das für die Organisation dieser Angelegenheiten verantwortlich ist. Die Mutter ist sehr dankbar, schüttelt meine Hand und entschuldigt sich noch einmal für das Missverständnis.
Ein Mittagessen geht sich nun nicht mehr aus - ich gehe zum nahegelegenen Supermarkt und kaufe mir ein belegtes Brot.
-
14 Uhr
Die Hausaufgabenbetreuung beginnt. Ich erwarte die Kinder in der Klasse. Die Lehrperson, die die Mittagspausenaufsicht gemacht hat, bringt mir die Kinder nach oben: 23 Kinder, zusammengewürfelt aus drei verschiedenen vierten Klassen.
Beim Eintreten versuche ich, zwischen Tür und Angel einen Streit zwischen zwei Buben zu schlichten, der sich auf das Fußballspiel in der Pause bezieht und klebe gleichzeitig Pflaster auf die aufgeschürften Ellenbogen eines Mädchens. Schicke die einen zum Händewaschen ins Bad und lasse die anderen inzwischen ihre Unterlagen und Wochenpläne auspacken. Es dauert, bis sich alle beruhigen.
Etwa die Hälfte der anwesenden Kinder schafft es, die Aufgaben mehr oder weniger alleine zu bewältigen. Die anderen hingegen bräuchten eigentlich eine Individualbetreuung.
Da gibt es den einen Jungen, der eine ADHS-Diagnose hat und nicht stillsitzen kann.
Es gibt die Zwillingsmädchen, deren Familie erst vor einem halben Jahr nach Südtirol gezogen ist und die kaum Deutsch können.
Es gibt den Jungen mit einer Hörbeeinträchtigung, der eine ruhige Lernumgebung bräuchte.
Den einen Jungen, der zwar alleine arbeiten kann, aber immer die Aufmerksamkeit der Lehrerin sucht und sich ständig meldet, um Zuwendung zu erhalten.
Dann gibt es noch die, die ihre Sitznachbarn nicht in Ruhe arbeiten lässt und sich selbst ablenkt.
Und irgendwo gibt es dann noch jene Kinder, die sich sehr unauffällig verhalten, gewissenhaft ihre Arbeiten erledigen und für die kaum Zeit bleibt. Das tut mir leid, weil jedem und jeder sollte ab und zu ein bisschen Aufmerksamkeit zuteil werden.
Ja, wir alle tun es für die gute Sache. Nur, dass die gute Sache zunehmend komplexer wird.
Zum Glück ist außer mir auch Frau H. da. Sie kommt zwei Mal in der Woche am Nachmittag und unterstützt uns Lehrpersonen bei der Hausaufgabenhilfe. Sie ist pensionierte Lehrperson und eine der Freiwilligen, ohne die der Schulbetrieb wohl nicht mehr denkbar wäre. Wie alle anderen Freiwilligen in der Mensa und den von den Eltern organisierten Mittagstischen auch, ist sie eine Frau und ein Leben lang gewohnt zu arbeiten, ohne viele Forderungen dafür zu stellen. Das tue man für die gute Sache, sagt sie immer. Ja, wir alle tun es für die gute Sache. Nur, dass die gute Sache zunehmend komplexer wird angesichts einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft und am Ende oft mehr einem Versuch zur Kinderbetreuung gleicht als einer Lernumgebung, in der man Grundkompetenzen wie lesen, rechnen und schreiben lernen kann.
-
Fortsetzung folgt!
Morgen, am 17. November, könnt ihr den dritten Teil des „Tagebuchs einer Grundschullehrerin“ lesen.
-
Weitere Artikel zum Thema
Gesellschaft | Klassenkämpfe 4Schüler stehen am Ende der Nahrungskette
Gesellschaft | Klassenkämpfe 6Das Anderssein der Anderen
Gesellschaft | Erlebnisbericht/1Das übliche Chaos am Morgen

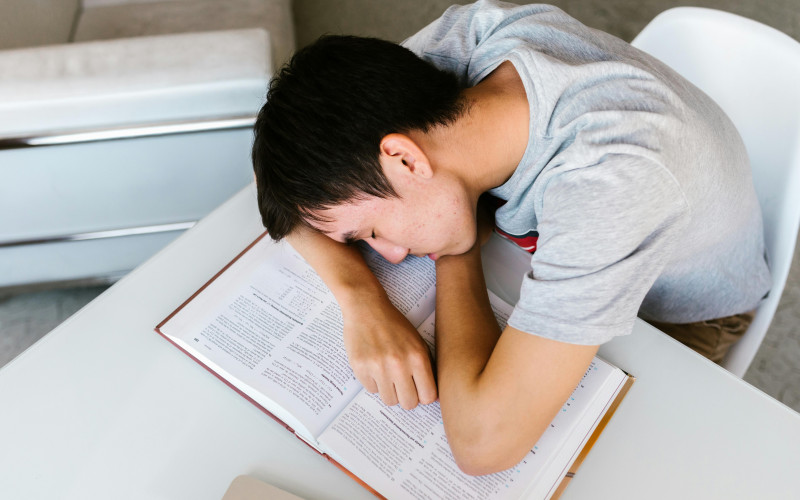


Fantastisch! Gibt einen…
Fantastisch! Gibt einen guten Einblick.
Besonders der Verweis auf Tastaturlöwen in den Kommentaren hat mich zum schmntzeln gebracht, der Rest zum Nachdenken.
Danke!
Die Frage ist, was unsere…
Die Frage ist, was unsere Ansprüche sind.
Die Wahrheit ist, dass unser Schulsystem sehr ineffizient ist.
Diese Lehrerin bringt es auf den Punkt: Einige Schüler sind überfordert, andere sind unterfordert, wieder andere bringen medizinische Probleme mit.
So kann selbst der beste Einzellehrer nicht effizient unterrichten.
Auf der Forschung wissen wir z.B. auch schon lange, dass man den Schulstoff aus 13 Jahren mit individualisiertem Unterricht in der Hälfte der Zeit vermitteln könnte.
Das ist aber mit den Vorstellungen des Landeshauptmanns nicht finanzierbar. Daher sollten wir uns fragen, was unsere Ansprüche an unser Schulsystem sind. Geben wir uns mit dem Status quo zufrieden oder wollen wir mehr?
Antwort auf Die Frage ist, was unsere… von Oliver Hopfgartner
"Geben wir uns mit dem…
„Geben wir uns mit dem Status quo zufrieden oder wollen wir mehr?“
Was für eine deplatzierte Frage. Angesichts der zunehmenden Anforderungen in den Schulen und dem sich verstärkenden Personalmangel wird auch der status quo in Zukunft nicht zu halten sein. Meine Kinder bekommen derzeit noch eine passable Schulbildung, meine Enkelkinder werden höchstwahrscheinlich eine Privatschule besuchen.
Antwort auf "Geben wir uns mit dem… von K V
Rein auf die Gehaltdebatte…
Rein auf die Gehaltdebatte bezogen wird mein Kommentar vielleicht wirklich deplatziert sein.
Das Problem ist allerdings, dass sich die Schule in den letzten 30 Jahren kaum verändert hat, während die Anforderungen an die heutige Generation sich sehr stark verändert hat. Vor diesem Hintergrund ist die Grundsatzfrage über die Ausrichtung des gesamten Schulsystems ganz und gar nicht deplatziert.
Die Autorin hat aber mit folgendem Punkt Recht: wir als „Internetkommentatoren“ werden das Problem nicht lösen können. Ich kann zwar relativ konkret formulieren, welche Wunschvorstellungen ich für die Ausbildung meiner Kinder habe, allerdings bin ich realistisch genug, um einzusehen dass sowas für die breite Masse mit der aktuellen politischen Situation nicht finanzierbar und umsetzbar ist.
Außerdem glaube ich, dass der Einfluss der Eltern ohnehin größer ist als der Einfluss der Schule. Die wirklich wichtigen Dinge lernt man nämlich nicht in der Schule - teilweise wird man darin sogar sabotiert.
Ob man das in der Schule…
Ob man das in der Schule vermittelte Wissen wirklich -a l l e s - w i s s e n- muss ...???, ... ist bei der Verfügbarkeit von jedem Wissen, die große Frage ...?
... + dann ist da noch die…
... + dann ist da noch die Bürokratie, von Welt-fremden Bürokraten erfunden, die Alles noch komplizierter macht.
Zu meiner Schulzeit funktzionierte die Diszimplierung so:
- drohen mit dem Stock (kaum wirksam)
- an den Haaren bei den Ohren aufziehen (schmerzhaft ...)
- vor dem Pult stehen
- vor dem Pult kieen
- reden mit dem Vater
- vor dem Pult sitzen (lustig ...)
- angedrohte Eintragung in das Klassenbuch
- Meldung beim Zonenlehrer (Drohung ...)