Ein Blick auf die Sprachgemeinschaft
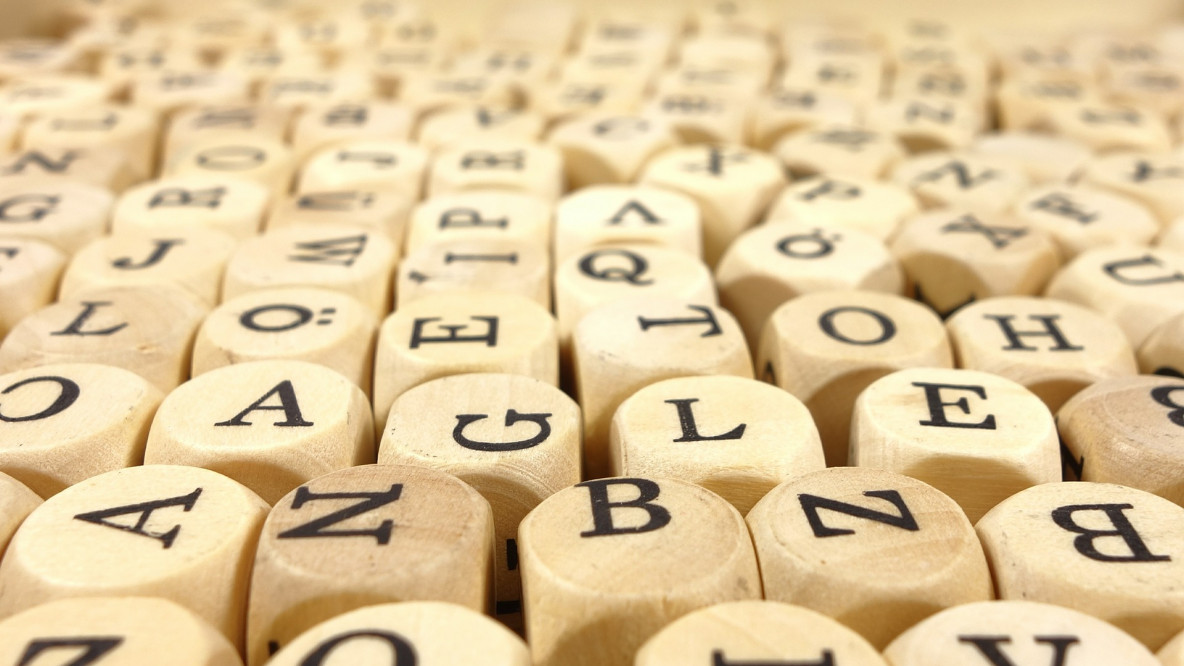
Immer öfter sind in den aktuellen Diskussionen zu kritischen Momenten im sprachlichen Zusammenleben in unserem Land von Ressentiments geprägte Forderungen zu vernehmen. Zuletzt bei der Diskussion um die Sprachproblematik in der Sanität. Wem hier einfache Lösungen vorschweben, hat die Details vergessen. Es wird gefordert, „die Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals um Übersetzungs- und Dolmetschqualifikationen zu erweitern, die fakultativ belegt werden können“. Solche fakultativ erreichten Qualifikationen entsprechen nicht dem Niveau von gerichtlich geprüften und vereidigten Übersetzern und Dolmetschern, denen die juridische Verantwortung für die Übersetzungen übertragen werden könnte. Gerade im Gesundheitsbereich sind Zweifelsfälle mit weitreichenden Konsequenzen vorstellbar, die keine Leerstellen im Bereich der Verantwortung gestatten.
Ein Patentrezept ist also auch die Anstellung von externen Dolmetscherinnen nicht. Zu welchen Mitteln man auch greifen mag, es handelt sich um Hilfskonstruktionen für den Arzt oder die Ärztin, die ihre Verantwortung nicht abgeben können. Übersetzungsfehler, die zu „Kunstfehlern“ führen können, würden den Ärzten angelastet werden, nicht den Dolmetscherinnen.
Die Arbeit im mehrsprachigen Umfeld ist mehr denn je Teamarbeit, die auf Vertrauen gründet und die eine Haltung verlangt, wo jeder jeden unterstützt und wo man respektvoll miteinander umgeht und miteinander spricht.
In welcher Sprache sprechen?
In Südtirol gibt es Beispiele von Exzellenz, die eigentlich Beispiele für die Normalität sein müssten. In den Büros des Bauernbundes hört man nur die deutsche Standardsprache in vielen Nuancen der Südtiroler Varietät. In den Krankenhäusern dominiert hingegen der Dialekt. Wenn in einem mehrsprachigen Umfeld wie dem Sanitätswesen die deutsche Standardsprache kaum Verwendung findet, dann gibt es Probleme. Wird am Arbeitsplatz nicht die deutsche Standardsprache verwendet, dann sind anderssprachige Pflegerinnen und Ärztinnen von Anfang an sprachlich ausgeschlossen und haben keine Möglichkeit, die neue Sprache am Arbeitsplatz zu lernen und zu üben.
Dass Ärzte bei der Erstvisite deutschsprachige Patienten sofort im Dialekt ansprechen, als ob sie sie von einer gemeinsamen Bergtour kennen würden, wäre in Österreich und in Deutschland undenkbar. In den Südtiroler Spitälern ist es gelebte Praxis.
Die Arbeit im mehrsprachigen Umfeld ist mehr denn je Teamarbeit.
Wer will und kann für diese Situation die Verantwortung übernehmen? Wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass Neuankömmlinge im Südtiroler Sanitätsbetrieb die Chance erhalten, die deutsche Sprache spontan am Arbeitsplatz zu lernen und so ihre Kompetenz zu erweitern? Wer tut etwas, damit sie sprachlich bei uns aufgenommen werden?
Wer in eine neue Sprachgemeinschaft Eingang findet, erlebt Lernen als Erfahrung, kann die gelebte Erfahrung als Lernen nutzen. Was kann getan werden? Was immer getan werden kann, muss von einer Gemeinschaft getan werden, einer Gemeinschaft, die sich verantwortlich fühlt für das Gelingen der Integration und für die Bewältigung der sprachlichen Herausforderungen in unserer Gesellschaft.
Diskussion zur Mehrsprachigkeit an der unibz
Die Freie Universität Bozen wurde mit großem Elan gegründet als Symbol für das Erreichte und in Gedanken an das Neue, das für Südtirol nun erreichbar geworden war. Unibz war als Universität für die jungen Südtiroler konzipiert worden und die Gründer rechneten mit einer Generation von Studierenden, die beide Landessprachen auf der Schule gelernt haben und die mit Englisch als dritter Sprache auf die Herausforderungen des neuen Jahrtausends als dreisprachig ausgebildete junge Menschen vorbereitet werden sollten. Das war die Voraussetzung für das dreisprachige Modell unserer Universität. Dass mehr als 20 Jahre nach der Gründung von unibz die sprachliche Bildung der heimischen Studenten noch immer nicht das angestrebte Niveau erreicht hat und auch heute noch nicht erreicht, war nicht vorherzusehen.
Unibz ist ein Indikator des Zustands der Sprachen in Kontakt in Südtirol.
Unibz hat Studenten aus vielen Ländern und es ist kein Geheimnis, dass die Studentinnen und Studenten aus Südtirol sprachlich nicht an vorderster Stelle stehen. Viele haben deutliche Defizite in der deutschen Sprache, der Standardsprache, die auch die Bildungssprache der Südtiroler ist. Wenn solche Defizite in der Kompetenz der Muttersprache als Folge eines unangemessenen Unterrichts in der Mittel- und Oberschule entstehen, dann ist es sehr schwer, in der arbeitsintensiven Phase des Universitätsstudiums diese Defizite zu beheben.
Unibz ist also ein Indikator des Zustands der Sprachen in Kontakt in Südtirol. Man kann den Indikator nicht einfach umformen zur Lösung des Problems, indem man den Nachweis der Sprachkenntnisse abschafft und die Zertifizierung „verschenkt“. Dieser Vorschlag wurde vor einigen Tagen im Landtag diskutiert und mit großer Mehrheit zurückgewiesen. Das eigentliche Thema, die Ursache für diesen Zustand, blieb dabei außer Betracht.
Univ.-Prof. Dr. Hans Drumbl
Univ.-Prof. Dr. Hans Drumbl sei von ganzem Herzen gedankt für diesen vorzüglichen Kommentar. Er ist natürlich zu sehr Gentleman und als Grandseigneur der alten Schule verbietet er sich wahrscheinlich selber, uns die Wahrheit durch seinen Gastkommentar laut ins Gesicht zu schreien.
Und diese Wahrheit lautet eben leider, dass die Gründe für das hiesige, miserable Sprachniveau in allererster Linie in der Verachtung der Aborigines ihrer „Bildungs“-sprache zu finden sind. Wer als einsprachiger Dialektsprecher immer noch glaubt, das sei ja schon Deutsch, was er da gerade texte, der darf sich nicht wundern, wenn sein fremdsprachiges Umfeld die Standardsprache nicht anständig lernen kann und dann gefrustet auf Italienisch umswitcht, das hier in seiner glasklaren, weil dialekt- und akzentfreien Reinstform kultiviert wird.
Vielleicht sollten die Bildungseinrichtungen sogar noch einen Schritt weiter gehen und Sprachzertifikate als Zugangsvoraussetzung für den Eintritt in die verschiedenen Schulstufen zwingend vorschreiben?
Wer die Zweitsprache nicht mindestens auf B1-Niveau beherrscht, der soll bitte weiter in der Mittelstufe büffeln. Wer zur Matura kein B2-Zertifikat vorweisen kann, der wird halt nicht zur Prüfung zugelassen.
Und wer kein C1-Niveau in allen drei Unibz-Sprachen belegen kann, der bekommt auch keinen Studienplatz.
So rum wäre es richtig! Nicht Sprachzertifikate leichtfertig verschenken, sondern als Eintrittskarte einfordern! Das hielte ich für eine sinnvolle Lösung zur Qualitätssteigerung und Hebung des Sprachniveaus.
Antwort auf Univ.-Prof. Dr. Hans Drumbl von Harry Dierstein
Speziell für Sie: http://www
Speziell für Sie: http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=50012
Antwort auf Speziell für Sie: http://www von pérvasion
Diese Aussagen sind für mich
Diese Aussagen sind für mich voll stimmig. Aber im Unterschied zum hier offiziell Schweizer-Deutsch, in der Schweiz - häufig auch Züri-Tiistsch - genannten Umgangssprache, die auch im Radio und TV verwendet wird, gibt es in Südtirol, keine allgemein gültige Südtiroler Umgangssprache.
Eine Parallele, die ich öfters im nördlichen Teil Deutschlands erlebt habe ist, dass ich auch nicht nur einmal gefragt wurde, ob ich aus der Schweiz komme? Weil wir - wie auch die Bayern - ein Hochdeutsch reden, das erkennen lässt, dass wir darin, so wie die Schweizer, nicht sehr geübt sind.
Ich finde den Gastkommentar
Ich finde den Gastkommentar von Herrn Trumbl auch sehr interessant, weil er auch etwas aus der Schule plaudert, was nicht allgemein bekannt ist. Als nicht jemand, der mit perfekten Sprachkenntnissen angeben kann und auch beruflich nie direkt mit der Materie befasst war, überrascht mich doch, wie der Herr Prof. den Schwerpunkt setzt.
Es ist noch nicht solange her als ich gelesen habe, dass die deutschsprachigen südtiroler Schüler bei der Pisastudie gerade im Sprachlichen (deutsch) überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben; Conclusio - Deutschunterricht ist gut. Die Schüler der italienischen Schulen in Südtirol haben vergleichsweise in ihrer Muttersprache schlechter abgeschnitten, obwohl für sie in der Regel die Schul- bzw Standard-Sprache auch die Sprechsprache ist.
Die Sprache an der UNI: Die südtiroler Studenten sind zu einem Teil italienischer Muttersprache. Mich würde wundern, wie dann sie mit dem Drei-Sprachen-Modell zurecht kommen? Beherrschen sie die zweite Sprache so gut wie vergleichsweise die deutschen Südtiroler? Wie geht man damit um? Ich schätze, dass beiden Sprachgruppen, das Englisch leichter fällt!?
Die Sprachvoraussetzungen im Berufsleben: Ich glaube nicht, dass es vor allem von den Eingangs-Zertifikaten abhängt, wie gut jemand im Beruf die zweite Sprachen anwendet. Meine Idee, wie man zu guter Zweisprachigkeit im Beruf kommt, wäre, dass 1) die Vorgesetzten auch dafür sorgen, dass beide Sprachen im Alltag angewendet werden; 2) braucht es im Falle ein berufsspezifisches Coaching und 3) es braucht auch diesbezüglich eine regelmäßige Weiterbildung, z. B. auch mit berufsspezifischen Sprachaufenthalten.
In Südtirol hat man immer nur auf das „Patentino“ geachtet und alles Weitere dem Zufall überlassen. So ist es dazu gekommen, dass Leute mit den jeweiligen Zweisprachigkeits-Bescheinigungen und entsprechender Zulage nie ein Wort in der Zweitsprache gesprochen haben.
Anderseits glaube ich auch nicht, dass ein Erwachsener im mittleren Alter - wenn er nicht sehr sprachbegabt ist - in kurzer Zeit eine Sprache so gut erlernen kann, dass zum Beispiel eine Ärztin schon bald ein gutes Patientengespräch zustande bringt. Der Dialekt ist bei Alten vom Land mit bescheidener Bildung nun mal eine Realität. Und wir Alten sind im Gesundheitswesen wahrscheinlich die Mehrheit.
»Dass Ärzte bei der
„Dass Ärzte bei der Erstvisite deutschsprachige Patienten sofort im Dialekt ansprechen, als ob sie sie von einer gemeinsamen Bergtour kennen würden, wäre in Österreich und in Deutschland undenkbar.“
Ich war vor rund einem Jahr in München (nicht in irgendeinem Dorf auf dem Lande) bei einem Kassenarzt und wurde sowohl von seiner Sprechstundenhilfe, als auch von ihm selbst nur auf Bayrisch angesprochen... und zwar so, dass ich nicht immer alles leicht verstehen konnte.
Ihre Kollegin Prof. Rita Franceschini kann Ihnen sicher anschaulich beschreiben, wie es in der Schweiz ist.
Antwort auf »Dass Ärzte bei der von pérvasion
Die Verständlichkeit von
Die Verständlichkeit von dialektal gefärbter Umgangssprache in Übergängen zum jeweiligen Dialekt hängt von vielen Faktoren ab. Ein isoliertes Erlebnis in einer Münchner Arztpraxis hat keinen Aussagewert. Das Problem, um das es im Südtiroler Sanitätsbetrieb geht, ist die Kommunikation in deutscher Sprache, wenn auch italienische Ärzte einbezogen werden. Hier geht es um sprachliche Zwischenstufen. Dazu ein Beispiel aus Basel, wo die Sprachsituation wissenschaftlich gut erforscht ist.
In Basel wird ein Sammelsurium an Schweizer Dialekten gesprochen. Treffen sich zwei Schweizer aus dem Emmental in Basel, dann sprechen sie ihren Ortsdialekt, den kaum ein anderer versteht. Ebenso geht es, wenn zwei Zürcher sich treffen. Trifft aber ein Zürcher auf einen Basler, dann spricht keiner der beiden die authentische Form seines heimatlichen Dialekts, sondern sie passen ihren Dialekt so an den Gesprächspartner an, dass eine reibungslose Kommunikation möglich ist.
Die Menschen sprechen so, dass jeder den anderen so gut wie möglich versteht. So wird die Polyglossie in der Schweiz gelebt.
Ganz anders in Südtirol. Hier wird der Dialekt zur Ausgrenzung verwendet.
Dieser Tatbestand ist bekannt. Die Aussage würde übrigens nicht entschärft, wenn ich ein „oft“ eingefügt hätte. Ich hatte das „oft“ in meinem Satz und habe es in voller Absicht wieder herausgestrichen. Der Satz ist für diejenigen geschrieben, die den Dialekt tatsächlich zur Ausgrenzung einsetzen.
Antwort auf Die Verständlichkeit von von Hans Drumbl
Das sind schwere
Das sind schwere Anschuldigungen, die übrigens nicht der Wahrheit entsprechen. Ich schließe aus Ihren Ausführungen, wir Südtiroler sind schon ein schlimmes (Berg)-Völkchen ...
Antwort auf Die Verständlichkeit von von Hans Drumbl
Ich glaube kaum, dass
Ich glaube kaum, dass Südtiroler ÄrztInnen ihre italienischen KollegInnen bewusst ausgrenzen wollen. Umso weniger glaube ich, wie Sie es schildern, dass sie ihre PatientInnen ausgrenzen wollen. Warum sollte das der Fall sein? Mir fällt kein plausibler Grund ein.
Antwort auf Die Verständlichkeit von von Hans Drumbl
@Hans Drumbl
@Hans Drumbl
„Ein isoliertes Erlebnis in einer Münchner Arztpraxis hat keinen Aussagewert.“
Ich gebe Ihnen völlig Recht. Einzelerlebnisse haben keine Aussagekraft. Daher kann ich in dieser Diskussion auch nicht ins Treffen führen, dass ich in Südtirol meiner Erinnerung nach noch nie von einem deutschsprachigen Arzt im Dialekt angesprochen wurde.
Sie haben folglich auch bestimmt eine Quelle für Ihre Behauptung, da ich mir nicht vorstellen kann, dass sie auf Ihren persönlichen Einzelerfahrungen beruht.
„Dass Ärzte bei der Erstvisite deutschsprachige Patienten sofort im Dialekt ansprechen, als ob sie sie von einer gemeinsamen Bergtour kennen würden, wäre in Österreich und in Deutschland undenkbar.“
Antwort auf @Hans Drumbl von Harald Knoflach
»Ich gebe Ihnen völlig Recht.
„Ich gebe Ihnen völlig Recht. Einzelerlebnisse haben keine Aussagekraft.“
Wobei ja zur Falsifizierung einer absolut gefassten These ein einzelnes Gegenbeispiel reicht.
Antwort auf Die Verständlichkeit von von Hans Drumbl
Ich gebe Herrn prof. Drumbl
Ich gebe Herrn prof. Drumbl vollkommen recht.
Zwei Anektoden: meine Frau arbeitete eine kurze Zeit im KH Sterzing als Ärztin. Ärztliche Übergabe am Morgen: dr Patient auf Bett 7 hot die gonze nicht gschpiebn! Wie bitte soll das gehn?! Und das gesammt Personal sprach immer Dialekt oder generft italienisch.
Ein Kollege der NCH Bozen beharrt seid Jahren von den deutschsprachigen Südtirolern in deutsch angesprochen zu werden. Und er kennt mittlerweile die grammatikalischen Unterschiede zwischen Dialekt und Hochsprache. Wieso? Weil wir Südtiroler andauernd Fehler machen.
Verinnerlichen Sie doch
Verinnerlichen Sie doch einfach das Beispiel der Menschen in Basel. Beim Sprechen in der Stadt verzichten die Schweizer Dialektsprecher auf einen Teil des „Ihrigen“. Jeder der Gesprächsteilnehmer bewegt sich sprachlich auf einen Raum des Gemeinsamen zu, der intuitiv und spontan aus der Erfahrung mit dem Sprecher des anderen Dialekts, der anderen Sprache, „ausgehandelt“ wird. So entsteht im Moment des Sprechens die geteilte Sprache, die Sprache, die nicht trennt, sondern verbindet. Die Summe solcher Veränderungen in sprachlichen Mikrosituationen kann auf der Makroebene als „koiné“ erfahren werden, als stabile Erscheinung.
Antwort auf Verinnerlichen Sie doch von Hans Drumbl
Das ist doch eher
Das ist doch eher vergleichbar mit einer Südtirolerin, die sich nach Innsbruck oder — besser noch: — nach Salzburg begibt. So groß dürfte geschätzt der Unterschied zwischen Züridütsch und Baselditsch sein.
Unsere Südtirolerin wird dort sicher nicht denselben Dialekt (in derselben „Stärke“) sprechen, wie zuhause mit der Oma. Im Gegenteil: SüdtirolerInnen verzichten in einem solchen Kontext vorschnell ganz auf ihren Dialekt.
(Übrigens wird in der deutschsprachigen Schweiz die Dominanz von Züridütsch, etwa in den Medien, immer wieder kritisiert.)
Antwort auf Das ist doch eher von pérvasion
Ich lebe seit 45 Jahren in
Ich lebe seit 45 Jahren in Bozen und immer in gemischtsprachigen Ambiente, sei es bei der Arbeit als in meinem Umfeld. Meine Erfahrung ist, dass wir Südtiroler uns immer - ja oft zu viel - angepasst haben und somit den italienisch-sprachigen Mitbürgern, die Notwendigkeit des Deutschlernens nicht vermittelt haben. So ist es auch zu erklären, dass so viele Menschen im öffentlichen Dienst, trotz Zweisprachigkeitsbescheinigung, die zweite Sprache nie angewandt haben. In der Regel reden die Südtiroler meiner Generation eine allgemein verständliche Südtiroler Umgangssprache. Am meisten aus der Reihe tanzen die Arntaler und allgemein die Pusterer. Wie es bei den jungen ist, kann ich schwer beurteilen.
Ich habe den Eindruck, dass sich Herr Drumbl ziemlich einseitig solidarisiert und mit diesen Dialekt-Spitzfindigkeiten vom Hauptthema ablenkt, sonst wäre er auch auf meine oben gestellten Fragen eingegangen.
Antwort auf Ich lebe seit 45 Jahren in von Sepp.Bacher
»Meine Erfahrung ist, dass
„Meine Erfahrung ist, dass wir Südtiroler uns immer - ja oft zu viel - angepasst haben und somit den italienisch-sprachigen Mitbürgern, die Notwendigkeit des Deutschlernens nicht vermittelt haben. So ist es auch zu erklären, dass so viele Menschen im öffentlichen Dienst, trotz Zweisprachigkeitsbescheinigung, die zweite Sprache nie angewandt haben.“
Das sehe ich ähnlich.
Antwort auf »Meine Erfahrung ist, dass von pérvasion
das ist auch mein reales
... das ist auch mein reales Erleben. Dieses „Aushandeln“ besteht meist darin, dass man, zuvorkommend und höflich, ins Italienische wechselt.
Antwort auf Verinnerlichen Sie doch von Hans Drumbl
Herr Prof. Drumbl, gibt es
Herr Prof. Drumbl, gibt es Belege für die Unterschiede zwischen der Schweiz und Südtirol, die Sie anführen?
Denn das „aushandeln“, das Sie für die Schweiz beschreiben, erlebe ich hier täglich bei der Arbeit. Insofern bezweifle ich, dass dies eine Südtiroler Eigenheit ist, ich schätze eher es kommt auf das soziale Milieu an, das man untersucht. In Basel und Zürich bewegen wir uns in einem hochurbanen Bereich mit hohen Akademikerquoten. Südtirol ist eher ländlich geprägt.
Herrn Professor Drumbl habe
Herrn Professor Drumbl habe ich in sehr guter Erinnerung - seine Vorlesung zur „Prosodie“ war spannend wie ein Krimi.
Der Mann weiß, von was er spricht, keine Sorge!
Antwort auf Herrn Professor Drumbl habe von Elisabeth Garber
Und zudem hatte Prof. Drumbl
Und zudem hatte Prof. Drumbl eine ordentliche Matura und ein abgeschlossenes Studium vorzuweisen, bevor er ordentlicher Professor an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät in Brixen wurde.
Die bewusste Ausgrenzung
Die bewusste Ausgrenzung durch das Dialektsprechen ist ein sehr wichtiger Aspekt und Prof. Drumbl thematisiert ihn völlig zu Recht.
Daneben gibt es noch ein zweites hochinteressantes Phänomen, das die Fremdsprachigen massiv daran hindert, die deutsche Standardsprache angemessen zu erlernen und das ich in dieser Form bislang nur in Südtirol beobachten musste:
Wir alle kennen die Situation, wenn eine Südtiroler Kleingruppe (deutschsprachige Südtiroler) irgendwo zusammen steht und sich im Dialekt unterhält. Nehmen wir nun an, diese sechs/sieben Leute mittleren Alters wären alle normal mehrsprachig, sie könnten sich (theoretisch) im Dialekt, Deutsch, Italienisch und wahrscheinlich auch noch auf Englisch einigermaßen problemlos untereinander verständigen.
Nun stößt ein einziger „Italiener“ zu der Gruppe, mit den ähnlichen sprachlichen Fähigkeiten, wie die Kleingruppe, außer dass er vielleicht kaum Dialekt spricht. Und was passiert dann?
Die deutsche Kleingruppe switcht nun nicht vom Dialekt in die deutsche Standardsprache, die der „Italiener“ auch passabel beherrschen würde, sondern alle sprechen plötzlich Italienisch. Ich habe dieses Phänomen wirklich unzählige Male beobachten können und es hat mich einige Jahre gekostet, bis ich es endlich entschlüsseln konnte.
Es gibt für dieses Phänomen noch keinen Namen, aber vielleicht könnte man es mit (Claus) „Gatterers-Sprachscham-Syndrom“ am ehesten beschreiben. So wie Gatterers Schwester in der Kommunikation mit ihm sich ihres fehlerhaften Deutsch schämt und deshalb lieber in Italienisch schreibt, genauso schämt sich wahrscheinlich obige Kleingruppe für ihre linguistische Insuffizienz.
Bevor sie sich also die Blöße geben und mit dem „Italiener“ schlecht Deutsch sprechen, sprechen sie lieber gleich mit ihm schlecht Italienisch. Das ist eigentlich eine peinliche kulturelle Bankrotterklärung und wir müssen uns überhaupt nicht wundern, dass „Italiener“ hier nicht besser Deutsch sprechen, denn wie und wann und mit wem sollen sie es denn eigentlich pflegen?
Antwort auf Die bewusste Ausgrenzung von Harry Dierstein
Ich erlaube mir hier eine
Ich erlaube mir hier eine Einschränkung.
Ihre Ansicht mag für einige Täler wohl gelten, und dort besonders, wenn sich die „Einheimischen“ untereinander unterhalten.
In meinem eigenen Umfeld im Bozner und Meraner Raum ist jeder eines für alle verständlichen, klaren Deutsch mächtig - und das gilt wohl doch für einen Großteil der heimischen Bevölkerung.
Antwort auf Die bewusste Ausgrenzung von Harry Dierstein
»wir müssen uns überhaupt
„wir müssen uns überhaupt nicht wundern, dass “Italiener„ hier nicht besser Deutsch sprechen“
Damit gebe ich Ihnen ausnahmsweise Recht, wenigstens teilweise.
Allerdings ist das ein bei Sprachminderheiten allgemein beobachtbarer Reflex, der mit der Sprache an sich recht wenig zu tun hat. Mit Ihrem Herrenmenschengehabe (sorry, Netiquette), wenn Sie Südtirolerinnen als Grattler oder Aborigines beschimpfen, tragen Sie zur Verfestigung dieses Gefühls, dieses Komplexes bei.
Antwort auf Die bewusste Ausgrenzung von Harry Dierstein
Harry Dierstein, dass die
Harry Dierstein, dass die Schwester von Claus Gatterer lieber italienisch schrieb hat wohl damit zu tun, dass sie während des Faschismus nur in eine italienische Schule gehen konnte - und vielleicht keinen Katakomben Deutsch-Unterricht erhielt. Sie gibt also kein gutes Beispiel ab!
Meine Erfahrung ist, dass es in der linken Aufbruchszeit Siebziger-, Achziger-Jahre noch mehr Bereitschaft bei den Italienischsprachigen gab, auch deutsch zu sprechen. Später habe ich im Rahmen der Sprach-Tandem-Projekte einige Erfahrungen gemacht. Alpha & Beta suchte zwei Partner um durch Sprachaustausch Übung der jeweils anderen Sprache zu bekommen. Ich habe mich auch bereit erklärt und auch gerne Schul- bzw. Standard-Deutsch gesprochen. Meine Erfahrung war, dass die Tandem-Partner, sobald sie die Zweisprachigkeitsprüfung geschafft hatten, kein Interessen mehr hatten, deutsch zu sprechen.
Antwort auf Die bewusste Ausgrenzung von Harry Dierstein
@Harry: Der Theorie fehlt ein
@Harry: Der Theorie fehlt ein wichtiges Detail: Die eingeforderte Hochsprache ist tendenziell norddeutschlastig und quitscht vielen Südtirolern derart in den Ohren, dass wenn man schon fremd spricht, lieber gleich in eine Fremdsprache wechselt. Leider wird bei uns, anders als etwa in Österreich und Bayern, medial keine süddeutsche Umgangssprache gepflegt. Süddeutschsprecher gelten hierzulande als Hinterwäldler. Rudi Gamper war der letzte Mediensprecher, der Hochdeutsch beherrschte, ohne die süddeutsche Atonalisierung zu verleugnen. Es reicht, einen Vormittag lang im Orf Radio Tirol zu hören und einen weiteren Vormittag Rai Südtirol, um festzustellen wie unterschiedlich man hier vom Dialekt in eine unnatürliche Aussprache wechselt.
Es handelt sich mE nicht um eine bewusste Ausgrenzung, sondern immer noch um einen Identitätskomplex als Folge jahrzehntelanger Sprachpropaganda.
Antwort auf @Harry: Der Theorie fehlt ein von Benno Kusstatscher
Interessant finde ich
Interessant finde ich diesbezüglich dieses ein paar Jahre zurückliegende Interview: http://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=14251
Antwort auf Interessant finde ich von pérvasion
Ja, die in diesem Interview
Ja, die in diesem Interview geäußerte Meinung, entspricht ganz meiner Haltung.
Antwort auf Ja, die in diesem Interview von Sepp.Bacher
dito
dito
Antwort auf Interessant finde ich von pérvasion
Na, für mich gibt es keinen
Für mich hingegen gibt es keinen Dialekt ohne „sell“, „zem“ oder dem absolut schönsten Wort „ingaling“ bzw. „galing“, welches so wundersam die Zeitdehnung in sich trägt.
Somit ein Halleluja auf den Hardcore-Dialekt meinerseits.
Subtile Akte der
Subtile Akte der Ausgrenzungen sind auch in entgegengesetzter Richtung dokumentiert. Ein Opfer war Franz Lanthaler, der mir die Episode außer sich vor Zorn erzählt hat. Was war geschehen? Der Journalist saß mit dem Interviewten gemütlich beisammen und beide sprachen im Dialekt über das Thema Dialekte in Südtirol. Dann ging der Journalist ins Tonstudio, schnitt seine Fragen heraus und nahm sie in perfektem Hochdeutsch noch einmal auf. Was die Hörer dann im Radio zu hören bekamen, war der Journalist, der die Fragen auf Hochdeutsch stellt und Antworten im Dialekt erhält. Bei vielen Interviews mit Menschen aus Südtirol. Fake News, wo das „Falsche“ die Sprache selbst ist.
Antwort auf Subtile Akte der von Hans Drumbl
krass... wozu der Mensch doch
krass... wozu der Mensch doch fähig ist.
Hier handelt es sich allerdings um charakterliche Eigenschaften wie Fairness und Respekt, die der eine hat, der andere eben nicht.
Grandioser sprachpolitischer
Grandioser sprachpolitischer Kassensturz von Hans Drumbl. Wunderbar kommentiert und ergänzt von Harry Dierstein. Einge der pikierten Reaktionen lassen darauf schließen, dass die Sprachanalyse voll ins Schwarze getroffen hat. Ich denke, der Begriff der „Sprachscham“ trifft es gut. Um ihren sprachlichen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren (denn auch den tumbsten SüdtirolerInnen bleibt es nicht allezeit verborgen, welch schlechtes Standarddeutsch sie sprechen), aber um ihr Selbstwertgefühl nicht zu gefährden, wechseln sie bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit ins Italienische, das sie oft recht mangelhaft beherrschen. Wie denn auch: Ist das Deutsche erstmal schlecht, kann das Italienische nicht viel besser sein. Ist nichts als eine selbstwertdienliche Verzerrung, die soziologisch bestens erklärbar ist.
Zu den wunderlichen Anwürfen von Pérvasion (wenn sie doch nur Klarnamen verwenden würden, dann fiele manches Bizarre wohl weg): Harry Dierstein „Herrenmenschengehabe“ vorzuwerfen, heißt das billige Argumentum ad Hitlerum zu bemühen und der Debatte in feiger Weise auszustellen. Dagegen hat Dierstein mit dem Hinweis auf das grottenschlechte südtirolische Sprachniveau einfach nur recht. Außerdem sind die deutschsprachigen SüdtirolerInnen nicht - wie Pérv. behauptet - „Sprachminderheit“, sondern eindeutig sprachliche Mehrheit in der Provinz. Haben also ihr Sprachniveau selbst in der Hand. Doch wenn man den öffentlichen Sprachgebrauch auch nur in atmosphärischer Absicht verfolgt, dann stößt man rasch auf die sprachlichen Untiefen Südtirols. Im Landtag etwa retten sich nur Kompatscher und Knoll, was hingegen die verschiedenen Lochers, Schulers und Renzlers von sich geben, tritt jegliches Sprachgefühl mit Füßen und ist einfach nur zum Fremdschämen.
Also nicht auf die anderen schieben, jede/r hat es selbst in der Hand und im Mund.
Und: Bravo Drumbl-Dierstein!
Antwort auf Grandioser sprachpolitischer von Hannes Obermair
Haben Sie schon mal eine
Haben Sie schon mal eine Definition von Minderheitensprache gelesen?
Antwort auf Grandioser sprachpolitischer von Hannes Obermair
Herr Obermair, aufgrund von
Herr Obermair, aufgrund von dem, was Sie hier von sich geben, darf man annehmen, dass sie aus einer Bozner Familie stammen, die auch zu Hause gehobenes Deutsch gesprochen hat. Es ist zu vermuten, dass Sie kaum zu Menschen Kontakt hatten, die in einem Tal nur mit Dialekt aufgewachsen sind. Für uns war bereits die Schulsprache eine Fremdsprache. Als die Bundesdeutschen ihre „Fremden-Zimmer“ im Dorf bezogen, hat man sich sehr bemüht, dessen Sprachen zu sprechen, auch jene, welche keine deutsche Schulbildung hatten (Faschistenzeit). Warum hätten wir uns also mit den Italienern nicht gleich bemühen sollen? Die Realität war aber, dass meine erste Kindergärtnerin kein Deutsch sprach, ebenso nicht die Hebamme und der Förster, genauso wie der Postmeister. Von Carabinieri, Celeri und Finanzer nicht zu sprechen. Wir haben aus der Realität gelernt, was unsere Pflicht ist. Uns Dialektsprechern meiner Generation vorzuwerfen, wir hätten die Italiener ausgegrenzt, finde ich schon einen Hammer!
Meine Erfahrungen in meinen ersten Arbeitsplätzen, waren die selben, wo sogar die Arbeitgeber mit den ital. Mitarbeitern italienisch sprachen; und setzt sich in meiner erfahrenen Realität fort. Ich wundere mich über die in dieser Diskussion angeführten Argumenten!
Andersrum: ich habe einen Oberbayrischen Schwager, der wenn ich ihn nicht auf Anhieb verstand, das Gleiche noch einmal aber lauter sagte. Meine bayrischen Neffen halten es ebenso, obwohl sie Dienstleistungsberufe ausüben. Meine Erfahrung in der Schweiz, wo ich öfters auf Weiterbildung war, ist folgende: die Bitte, Standarddeutsch zu sprechen, löste eine lange Diskussion aus, die mit dem Resultat endete, dass man höchsten bereit sei, sich zu bemühen Zürich-Deutsch zu sprechen, was dort dem entspricht, was ich weiter oben Südtiroler Umgangssprache bezeichnet habe.
Andererseits möchte ich immer noch meine Frage zu den Ergebnissen der Pisa-Studie beantwortet bekommen. Möglicherweise sind auch Schulleute unter den Kommentatoren?
Antwort auf Herr Obermair, aufgrund von von Sepp.Bacher
Lieber Herr Bacher, ich bin
Lieber Herr Bacher, ich bin in Bruneck aufgewachsen und in Pusterer Mundart sozialisiert. Aber was spielte denn das für eine Rolle...
Antwort auf Grandioser sprachpolitischer von Hannes Obermair
"Außerdem sind die
„Außerdem sind die deutschsprachigen SüdtirolerInnen nicht “Sprachminderheit„, sondern eindeutig sprachliche Mehrheit in der Profinz.“
Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst? Lt. Ihrer Argumentation gibt es nirgends auf der Welt eine Sprachminderheit.
Antwort auf "Außerdem sind die von G. P.
Es kommt immer auf den Bezug
Es kommt immer auf den Bezug an. Rein zahlenmäßig sind die deutschsprachigen Südtiroler in Südtirol in der Mehrheit, in Italien aber in der Minderheit. Da sie sich auch in Südtirol mit dem italienischen Staat herumzuschlagen haben, der keine Gleichberechtigung der Sprache garantiert (Polizei, Justiz, Staatsverwaltung, Beipackzettel usw.), ist der Minderheitenstatuts eindeutig relevanter als der Mehrheitsstatus. Die Ladiner, die in ihren Tälern in der Mehrheit sind, in Südtirol und um so mehr in Italien eine Minderheit, sind wieder einmal vergessen worden.
Antwort auf Es kommt immer auf den Bezug von Hartmuth Staffler
So ist es. Eine
So ist es. Eine Sprachminderheit wird nicht danach definiert, ob sie auf allen Ebenen zahlenmäßig in der Unterzahl ist.
Im Gegenteil: Es ist eine anerkannte Maßnahme des Minderheitenschutzes, politisch-administrative Grenzen so zu gestalten, dass Sprachminderheiten nicht auch noch auf lokaler Ebene minorisiert werden.
Wer die Tatsache, dass eine Minderheit in ihrem Siedlungsgebiet nicht zahlenmäßig in der Unterzahl ist, wiederum gegen die Minderheit selbst verwendet, betreibt ein unlauteres Spiel.
Antwort auf Grandioser sprachpolitischer von Hannes Obermair
Ich bin der Meinung, dass der
Ich bin der Meinung, dass der durchschnittliche Südtiroler /Südtirolerin mit Maturaniveau sehr gut Deutsch in Standardsprache spricht und diese auch situationsbezogen anwenden kann. Wenn mehrere Südtiroler (auch in einem Arzt Patient Gespräch) untereinander im Dialekt sprechen ist das nur natürlich. Was soll daran ungewöhnlich sein. Dass dazukommende Italiener ausgeschlossen werden bzw. ins Italienische umgeswitcht wird, das ist meist den mangelnden Deutsch Standardsprache- Kenntnissen geschuldet und nicht als bewusstes Ausschließen zu werten. Das beste wird sein, sich zukünftig in Englisch zu unterhalten. Leider können viele mit italienischer Muttersprache da auch nicht mithalten. Das erlebe ich jedenfalls häufig wenn ich in einem Bozner Geschäft, auf meine deutsche Anrede eine italienische Antwort bekomme und auf mein darauffolgendes Englisch auch keine entsprechende Reaktion erfolgt. Hingegen wird jeder italienische Gast in der letzten Almhütte passabel auf italienisch bedient.
Übrigens wären mir die Akademiker und auch die „Normalos“ aus dem deutschsprachigen Ausland auch nicht zu schade, wenn sie länger hier leben, auch in Ansätzen die eine oder andere Form unserer Muttersprache, des Dialektes zu erlernen. Aber über die Grattlersprache ist man ja so was von erhaben. Das wird nichts werden. Bleibt man halt lieber außen vor und pflegt seine Ressentiments, was dann auch nicht weiter schlimm ist.
Ich kann Herrn Prof. Drumbl
Ich kann Herrn Prof. Drumbl nur zustimmen. Allerdings glaube ich, dass es in den meisten Fällen von Südtiroler Seite kein bewusstes, sondern eher ein unbewusstes Ausgrenzen ist. Südtiroler, die Dialekt sprechen, sind oft überzeugt, dass sie „Deutsch“ sprechen. Ich habe erlebt, wie ein Südtiroler in einem selbst mir kaum verständlichen Dialekt in einem Gastbetrieb in Deutschland etwas bestellte. Da er nicht verstanden wurde, wunderte er sich: „Komisch, dass de koa Daitsch verstian“. Umgekehrt mein folgendes Erlebnis in einem Südtiroler Vier-Sterne-Hotel. Da der Kellner offensichlich aus dem Süden stammte, sprach ich mit ihm, um ihm entgegenzukommen, deutsche Standardsprache, die er gut beherrschte und mit den bundesdeutschen Gästen zwanglos plauderte. Als er herausfand, dass ich Südtiroler bin, stellte er mich coram pubblico auf äußerst beleidigende Weise zur Rede. Wenn ich Südtiroler sei, habe ich gefälligst Italienisch mit ihm zu reden. Die Angelegenheit ist also wirklich sehr kompliziert.
Antwort auf Ich kann Herrn Prof. Drumbl von Hartmuth Staffler
Wenn in einer Sitzung an der
Wenn in einer Sitzung (das Plenum ausgenommen) an der Schule plötzlich arg diskutiert wird, schlittert man oft bis immer in den Dialekt. Italienisch-Kollegen, die nur Hochdeutsch sprechen, werden dadurch ungewollt exkludiert.
An italienischen Schulen geht es Deutsch-Lehrpersonen nicht viel ‚besser‘ mit der subtilen (mitunter sogar nachdrücklichen) „Siamo-in-Italia-Haltung“...habe ich mir sagen lassen.
Ja, die Angelegenheit ist in der Tat kompliziert!
Antwort auf Ich kann Herrn Prof. Drumbl von Hartmuth Staffler
Herr Staffler, ein Kellner,
Herr Staffler, ein Kellner, also ein Angestellter, in einem 4 S Hotel hat Sie beleidigt, weil Sie Deutsch gesprochen haben?
Antwort auf Herr Staffler, ein Kellner, von Manfred Klotz
Ganz richtig. Der Mann, der
Ganz richtig. Der Mann, der gut Deutsch sprach und dies auch mit mir tat, so lange er mich wegen meiner Standardsprache für einer Touristen hielt, war der Meinung, dass ich als Südtiroler mit ihm Italienisch sprechen müsse. Diese Haltung ist mir schon öfters begegnet, wobei ich keine Probleme habe, Italienisch zu sprechen, wenn mein Gegenüber Deutsch nicht beherrscht. Es gibt auch aufmerksame Kellner, die sich dafür entschuldigen, dass sie kein Deutsch können; das akzeptiere ich gerne. Noch schöner ist es aber in meinem Stammcafé, in dem die slowakische Kellnerin sechs Sprachen fließend spricht (drunter auch Dialekt und Standarddeutsch).
In den vier PISA-Zyklen, die
In den vier PISA-Zyklen, die eine Ausdifferenzierung der Ergebnisse nach Sprachgruppen erlaubten (2006, 2009, 2012 und 2015), lagen die Ergebnisse der deutschen Fünfzehnjährigen stets vor den Ergebnissen ihrer italienischen Kollegen:
2006: 508(dt.) 480(it.)
2009: 494(dt.) 474(it.)
2012: 503(dt.) 473(it.)
2015: 506(dt.) 494(it.)
Der Unterschied war stets signifikant. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die PISA-Studie das Leseverständnis misst und n i c h t die aktive mündliche bzw. schriftliche Sprachproduktion. In einem Vergleich 2011 mit den Schülern aus Tirol schnitten die deutschsprachigen Schüler Südtirols ebenfalls besser ab. Möglicherweise übt die Zusammensetzung der Schülerpopulation einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse aus: in den deutschen Schulen gab es in den angeführten Zyklen immer viel weniger Kinder mit Migrationshintergrund als in der italienischen Schule. Insgesamt sind die Ergebnisse jedoch keineswegs glänzend, weder in der deutschen und schon gar nicht in der italienischen Sprachgruppe.
Antwort auf In den vier PISA-Zyklen, die von Franz Hilpold
Danke Franz Hilpold!
Danke Franz Hilpold!
Antwort auf In den vier PISA-Zyklen, die von Franz Hilpold
Nachtrag zu PISA: Es gibt
Nachtrag zu PISA: Es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Schulen im Leseverständnis. Wenn die Franziskaner, die Realgymnasien Meran, Bozen , Brixen bei PISA 2012 über 600 Punkte erzielen, so liegen die Ergebnisse der LBS Schlanders und einiger Fachschulen um 400 Punkte. Bei den Italienern sind die Unterschiede zwischen bestimmten Gymnasien (Marcelline, Rainerum usw.) und den meisten Berufs-und Fachschulen noch viel größer. Ob da wohl die Soziologie eine Rolle spielt?
Antwort auf Nachtrag zu PISA: Es gibt von Franz Hilpold
Das glaube ich auch, Herr
Das glaube ich auch, Herr Hilpold. Das hängt schon von den Voraussetzungen der Schüler ab, welche die bestimmten Schulen wählen. Dann aber noch mehr vom Programm und dem Niveau der Schulen. Dem entsprechend könnte sich dieser Unterschied auch auf die Wahl der anschließenden Bildungswege auswirken. Da währe interessant zu wissen, welche schulische Vorgeschichte die Studenten - aber beider Sprachgruppen - hatten, welche sich in die UNI-Bozen (Bildungswissenschaften) eingeschrieben und Herrn Professor Drumbl zu diesem Gastkommentar veranlasst haben!?