Die Schienen-SASA

Text: Thomas Huck
In Zusammenarbeit mit der Architekturstiftung Südtirol / in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige.
Dagen H (TAG H) - Nirgends wurde die Straßenbahn so pragmatisch, zeitlich präzise und so offensichtlich für den Autoverkehr abgeschafft wie in Schweden. Mit der Umstellung auf Rechtsverkehr am 3. September 1967 um 5 Uhr morgens wurden landesweit alle Straßenbahnen - da links fahrend - eingestellt. Nur einige wenige überlebten, diese aber bis heute.
Was mit der Tram in Bozen passieren wird, entscheiden die Bürger. Zwar nicht wirklich, da es sich um ein beratendes Referendum handelt, aber sie dürfen mitreden. Zwar nicht die, die die Tram bräuchten und vermutlich benutzen werden und sollen. Die Pendler, die mit ihren Autos zurzeit täglich den Verkehr von außerhalb nach und durch Bozen treiben und dort öffentliche Flächen zuparken. Dafür aber die, die Nachteile befürchten. Die Anrainer entlang der Strecke, die sich natürlich Fragen wieso sie eine Oberleitung vor dem Fenster haben sollen oder jene die befürchten, dass sie es nicht nur hören, sondern auch fühlen werden, wenn die Tram vorbeifährt. Die, die zum Einkaufen um die Ecke eh zu Fuß gehen bzw. zur Arbeit weiterhin den Bus benötigen. Aber wie bei der U-Bahnsteuer in Großstädten profitieren nicht nur die U-Bahnbenutzer, sondern auch die Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, welche weniger Verkehr auf der Straße haben.
Verkehrsplanung ist Stadtentwicklung
Zwar wird die Tram mit ihren 17,4 km/h, welche sie auch noch auf der selben Strecke zurücklegt wie der Bus, keine wirklichen Neuheiten bringen, aber Sicherheit. Die Sicherheit, dass es 21 Minuten von Sigmundskron zum Bahnhof Bozen sind, sichergestellt durch intelligente Ampelschaltungen und Vorfahrt für Schienenfahrzeuge. An einer eigenen Spur mangelt es leider noch. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Bozen mag zwar höher sein, als die der Tram. Sie beträgt in den Stoßzeiten jedoch schnell nur noch 8-10 km/h. Wer es eiliger hat, schafft die gleiche Strecke mit dem Zug in 14 Minuten, aber nur direkt zum Bahnhof Bozen und muss dann wieder auf den Bus umsteigen. Da bietet die Tram ein viel größeres Angebot an Haltestellen.
Egal ob Tram, Bim oder Straßenbahn, viele Städte schicken die Züge wieder durch die Stadt und die Bevölkerung scheint es zu danken. Das Umsteigen vom Auto auf die Tram fällt nachweislich leichter, als auf den Bus. Auch die Orientierung im Öffinetz scheint mit der Tram einfacher zu sein. Eine Tram fährt wichtige Punkte an, egal ob touristisch bedeutsamer Ort oder Verkehrsknotenpunkt. Selbst für den Fußgänger sind Schienen eine Orientierungshilfe.
So scheint Bozen auf dem richtigen Weg zu sein, fast. Es fehlt noch ein langfristiger „Tramplan“. Denn die Verlängerung ins Überetsch und eine mögliche zweite Strecke durch Don Bosco sind nicht wirklich eine Entwicklungsstrategie. Wie viele Linien würde Bozen überhaupt benötigen? Wo sollten diese verlaufen? Wo wird in Zukunft gebaut oder gewohnt? Ist man bereit, den Autoverkehr zweitrangig zu behandeln? Wo müsste man mögliche Trassen freihalten? Es sollte nicht nur auf den Status Quo reagiert werden. Verkehrsplanung ist Stadtentwicklung und somit auf die Zukunft ausgerichtet. Das beste Beispiel dafür ist Bozen selbst. Verband die alte Tram noch die drei getrennten Gemeinden Bozen, Gries und Zwölfmalgreien, gehören diese inzwischen zusammen. Auch die ehemalige außerstädtische Linie nach Leifers trug ihren Teil dazu bei, das Dorf so attraktiv zu gestalten, dass langfristig eine Stadt daraus werden konnte.
Als Beispiel für eine solche Entwicklungsstrategie gilt der Netzplan M für Wien aus dem Jahr 1974, welcher bis heute als Grundlage für den Schienenausbau gilt. Nach über 40 Jahren hat man nämlich noch immer nicht die endgültige Ausbaustufe erreicht. Dies ist auch nicht das Ziel und ist auch gar nicht mehr möglich. U-Bahnen wurden als Straßenbahnvarianten und Liniengabelungen als Linienkreuze realisiert oder Gebiete ganz anders besiedelt. Ziel dieser Variante war es vielmehr, dem Umstand der langwierigen Bauzeit in Etappen gerecht zu werden und bereits Jahrzehnte vorab ein System zu entwickeln, nach dem gebaut werden sollte. Man definierte Zielpunkte, Stationen, Linienabstände, Kreuzungspunkte…
Damit wollte man verhindern, dass es im Laufe der Zeit aufgrund des Bedarfs bzw. Dringlichkeit zu Fehlentscheidungen bzw. kurzfristigen Entscheidungen kommt.
Ein gutes Beispiel dafür ist Berlin, zwar mag es geschichtlichen Umständen geschuldet sein, doch gibt es dort zehn U-Bahnstrecken für neun Linien. Zumindest bezeichnet man die unzähligen Vorleistungen für nie realisierte Streckenabschnitte und stillgelegte Teillinien als U10. Eine Straßenbahn mag zwar keine U-Bahn sein, ist aber für eine Kleinstadt ein vergleichbarer Kraftakt. Und wenn ein Grundstück erstmal verbaut ist bzw. eine Straße gebaut, ist dort nur mehr schwer eine (autofreie) Schiene verlegbar (Auch hier ist Bozen selbst das beste Beispiel, mit der alten Überetscher Bahntrasse oder der Drususstraße).
Deshalb sollte man am 24. November nicht über das jetzige Projekt abstimmen, mit einer von vielen möglichen Linien im Mischverkehr, sondern darüber, ob Bozen beginnen soll, ein auf der Straßenbahn basierendes öffentliches Nahverkehrssystem aufzubauen.
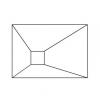
Bei einem vorliegenden Ausbau
Bei einem vorliegenden Ausbau-Netzplan würde auch ich mich beim befragenden Referendum leichter tun. Vorwiegend scheint das Projekt zur Bewältigung des Pendlerverkehrs und nicht als Mehrwert für die Städter selbst präsentiert zu werden. Konkret könnte man missen:
1. Erschließung der drei Seilbahnen
2. Erschließung der „alten“ Viertel Gries, Rentsch, als auch Haslach und Kardaun
3. Erschließung des Oberauer Friedhofes gerade für unsere Senioren
4. Erschließung für Freizeitmöglichkeiten der Städter (alle sprechen von der Tram von Kaltern nach Bozen für Pendler, aber niemand von einer von Bozen zum Kalterersee für unsere Kinder)
5. Planung eines Tramdrehkreuzes am neuen Bozner Bahnhof
6. Angebot für die Berufstätigen, die zwischen Industriezone und Zentrum pendeln (bekanntermaßen ein Hotspot für Staus)
Niemand erwartet eine unmittelbare Umsetzung, aber eben einen Netzplan. Genau.
Antwort auf Bei einem vorliegenden Ausbau von Benno Kusstatscher
zu diesen Fragen würd ich mir
zu diesen Fragen würd ich mir auch eine Stellungnahme der Gemeinde wünschen
kennt jemand die nachteile
kennt jemand die nachteile eines filobusses gegenüber tram?
Aso, wo kann ich das
Aso, wo kann ich das nachlesen?
Sonst nur vorteile?
"Deshalb sollte man am 24.
„Deshalb sollte man am 24. November nicht über das jetzige Projekt abstimmen, mit einer von vielen möglichen Linien im Mischverkehr, sondern darüber, ob Bozen beginnen soll, ein auf der Straßenbahn basierendes öffentliches Nahverkehrssystem aufzubauen.“ Das würde also heißen, ein Ja steht für eine Zukunft von Bozen und Umgebung mit oder auf der Schiene? Ich stimme zu!
Antwort auf "Deshalb sollte man am 24. von Sepp.Bacher
Ich stimme auch zu ...
Ich stimme auch zu ... dreifach = Sepp Bacher, Christoph Moar und am Sonntag.
Argumente für oder gegen Filo-Bus - oder anderer öffentlicher Verkehrsmittel - bietet das Internet zur Genüge. Es gibt unzählige Probephasen (auch in Italien) ... aus denen schlussendlich die Tram als wohl geeignetstes hervorgeht. Sie muss halt ordentlich gebaut und umgesetzt werden ... auch als erweiterungsfähig ausgelegt.
Zu Beachten wäre auch die Unterquerung der Tramtrasse mit betonierten Kanälen an strategischen Punkten ... damit Arbeiten an Telefon, Glasfaser, Wasser, Fernwärme, Strom, Abwasser usw. nicht jedes Mal zu Unterbrechungen des Betriebs führen. Oder vielleicht beim Bau der Trasse gleich einen „Kanal“ darunter bauen ... wenn wir schon die ganze Stadt „queren“. Anstatt alle paar Monate die Straßen aufzureißen.
Störungsanfälliger und haben
Störungsanfälliger und haben auf jeden Fallen eine deutlich geringere Kapazität. Man könnte das für die Nebenstrecken in Betracht ziehen!? Oder noch besser Wasserstoff-Hybrid-Busse!
Straßenbahnen sind Fahrgast-freundlicher (denken Sie an Behinderte und Betagte) und haben die Fahr-Qualität einer Zuges. Den Unterschied zu Bussen kennt man. Man braucht nur Bozen - Meran mit dem Bus und Meran - Bozen mit dem Zug zu fahren!
bellissimo articolo e
bellissimo articolo e bellissime considerazioni. Peccato che c'è chi dipinge la cosa in tragedia come se fosse la fine del mondo (mi ricorda la questione Benko).
Personalmente sogno più linee e pure una fermata dei treni a San Giacomo con annessa ovovia della Leitner che giri per tutta la zona industriale. Ci sono tanti pendolari che scelgono l’auto perché dalla stazione alla zona industriale è davvero troppo scomodo...
" Warum sollen metallräder
„ Warum sollen metallräder auf schienen im schritttempo mehr qualität bieten?“
Weil sie ein angenehmeres, gleichförmigeres, zügigeres, ruckelfreieres und komfortableres Fahrerlebnis bieten als jedes andere Material auf Gummiprofil.
Vom Zu- und Absteigen auf Ebenniveau, und den riesigen Unterschieden bei Lebensdauer und Verschleiß des Rollmaterials gar nicht zu reden.
Aber speziell was die Frage zum Komfort angeht - und jedem, den man vom Pkw auf Öffi bringen will, muss man Komfort anbieten - ist es wirklich nicht schwer, den Unterschied sogar mit geschlossenen Augen zu erkennen.
Einfach mal ein halbes Stündchen Bus und Tram fahren. Es öffnet die entspannt geschlossenen Augen.
Einfach erklärt. Jeder sollte
Einfach erklärt. Jeder sollte das Wort entschleunigen wahr machen und sich die Zeit nehmen sei es um zur Arbeit zu kommen oder auch nur in der Freizeit Sich mit der Tram fortbewegen.
Dieses befragende Referendum
Dieses befragende Referendum „ja oder nein zur Tram“ kommt zum falschen Zeitpunkt. Das Tram-Projekt ist im Rahmen des PUMS (des nachhaltigen Mobilitätsplans für Bozen) zur Zeit erst soweit ausgearbeitet, dass die Gemeinde Bozen beim Staat/EU um die nötigen Fördermittel anfragen kann. Und nur mit innovativen Infrastrukturen, wie die Tram eine ist, hat die Gemeinde eine Chance, die Beiträge zu bekommen. Dazu muss sie innerhalb 31.12.2019 ihren Gesamtplan einreichen, welcher anschließend gemeinsam mit der Bevölkerung definiert werden soll.
Das Referendum, grundsätzlich ein brauchbares demokratisches Instrument, wurde hier von der Gruppe „nein zur Tram“ zu wahlpolitischen Zwecken benützt. Wenngleich es sinnlos erscheint und uns Bürgern 200.000 € kostet, hat es jedoch eine positive Folge: die Bürger setzen sich endlich mit der Zukunft ihrer Stadt auseinander, viele noch ungeklärte Fragen/Probleme werden angesprochen und somit kann rechtzeitig nach einer Lösung gesucht werden.
Einen Mehrwert gebracht haben auch Beiträge von Menschen, welche sich ganzheitlich mit den Problemen der Stadtentwicklung auseinandergesetzt haben: siehe dieser Artikel und jener von Pascal Vullo
https://www.salto.bz/de/article/02112019/il-tram-una-questione-cruciale
Hier in Kürze noch einmal die wichtigsten Punkte, die für eine Tram in Bozen sprechen:
- Nachweislich erzeugt die Tram durch ihre Sicherheit und ruhiges Fahrverhalten eine große Anziehung auf die Menschen und erfüllt zur Gänze das Bemühen der Gemeinde Bozen, die Benutzer der öffentlichen Mittel von 10% auf 20% zu steigern, während die von manchen geforderten neuen E-Busse keine zukunftsträchtige Attraktivität darstellen
- Barrierefreiheit: besonders für ältere Menschen, Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und BürgerInnen mit Kinderwägen ist die Tram das einzige Verkehrsmittel, das einen barrierefreien Zugang niveaugleich vom Gehsteig aus gewährleistet
- die zu Stosszeiten überfüllten Busse können keine Pünktlichkeit garantieren, da es beim Ein- und Aussteigen immer zu Verzögerungen kommt. Dies können die längeren und größeren Tramgarnituren vermeiden und eine gössere Pünktlichkeit garantieren
– die Tram ist ein Teil des Südtiroler Verkehrssystems, welches auf den Schienenverkehr setzt: die längerfristig ausgerichtete Verbindung der verschiedenen Bahnhöfe (Bozen Zentrum, Oberau/St. Jakob, Bozen Süd, Kaiserau, Sigmundskron), soll über richtig getaktete Schnittstellen den gesamten Verkehr bewältigen, indem auch Busse, carsharing und bikesharing an den Haltestellen eingebunden werden
- der öffentliche Raum als sozialer Treffpunkt, um den es in der zukünftigen Stadtplanung gehen muss, kann in die Planung der Tram bereits mit einbezogen und menschengerecht gestaltet werden – der Straßenraum soll ja von möglichst wenigen Autos genutzt werden
- Kosten: wenngleich der Bau dieser Infrastruktur viel kostet, muss hier an ihre Zukunftsträchtigkeit gedacht werden: die Kosten-Nutzenrechnung dieser 7 km stadtquerenden Infrastruktur geht zu Gunsten der Tram auf, da die Lebensdauer dieser viel höher als jene von E-Bussen ist (35 zu 8 Jahren) und die Betriebskosten viel geringer sind, insofern die Tram weniger Personal und Instandhaltungskosten benötigt.
- Geringe Umweltbelastung: die Luft- und Lärmbelastung der Tram ist viel niedriger als jene der Busse, auch muss hier bereits an die umweltbelastende Produktion und Entsorgung der Batterien von großflächig eingesetzten E-Bussen gedacht werden.
Es ist klar, dass auch kurzfristig viele kleine Schritte notwendig und machbar sind, um die Stadt vom Verkehr zu entlasten.
Winfried Theil, Margot Wittig, Alessia Politi, Sigrid Pernthaler, Christoph Mayr Fingerle, Bernhard Oberrauch, Mitglieder von labbz_Unsere Stadt
Antwort auf Dieses befragende Referendum von Margot Wittig
Jetzt hab ichs. Mit den
Jetzt hab ichs. Mit den schienen kann( muss) die spur für die autos gesperrt werden. Ansonsten gibt es keine EU förderungen ( siehe Innsbruck).
Filobusse werden trotzdem von der eu gefördert ( siehe Verona).
Bozen - Meran zug ca45 min, flixbus 20 min
Meine erfahrungen in wien zeigen mir die bim ( tram) benötigt breite strassen. Im ersten bezirk (Altstadt)fahren nur busse. Die ringbahn drumherum fährt auf einer so breiten strasse wie es in bozen keine gibt.
Antwort auf Jetzt hab ichs. Mit den von Luis Durni
Instandhaltungkosten der tram
Instandhaltungkosten der tram?
Die fahrgestelle, Stück ca 10 tonnen, vom vinschgerzug werden mit dem lkw nach salzburg gebracht. Die räder müssen regelmässig nachgedreht werden. Wo befindet sich die nächste tramwerkstatt?
Antwort auf Instandhaltungkosten der tram von Luis Durni
- Barrierefreiheit: gibt es
- Barrierefreiheit: gibt es noch neue busse ohne automatischer rampe?
Und stellplätze für rollstühle bzw kinderwagen?
- die zu Stosszeiten überfüllten Strassen lassen eine tram auf der anderen auffahren ( siehe innsbruck)
Antwort auf Jetzt hab ichs. Mit den von Luis Durni
Eigenartige Gegenüberstellung
Eigenartige Gegenüberstellung: „Bozen - Meran zug ca45 min, flixbus 20 min“! Wie viele Haltestellen hat der Zug? Da er sich wegen der Eingeleisigkeit 2 - 3 mal kreuzen muss, verliert er dabei Zeit. Aber bis einen Tram gebaut ist, ist auch dieses Problem gelöst!
Sasa-Bus Bozen - Meran braucht laut Fahrplan 55 Minuten, weil er auch in jedem Dorf halt macht. Der Flixbus wird direkt über die Mebo nach Meran fahren; aber auch da wird er mehr als 20 Min brauchen!
Antwort auf Eigenartige Gegenüberstellung von Sepp.Bacher
Stimmt. Meine zeiten sin d
Stimmt. Ich schreibe von meinen selbstgefühlten zeiten.
Sasa-zug-flix,
die Haltstellen machens aus. Und nicht die schienen.
Wieviel kosten zweigleisige schienen bz-m , ohne schlangenlinien wie zu kaiserszeiten? Ahh ja, wird sicher eu finanziert.
Wir sollten endlich aufhören,
Wir sollten endlich aufhören, Bozen mit anderen italienischen und europäischen Städten von viel größerer Dimension, fast einem „Kapitalsyndrom“, zu vergleichen. Es ist ein irreführender und sinnloser Vergleich.
Bozen braucht rasch einen effizienten und schnellen öffentlichen Nahverkehr, der nur durch einen Halt von Pendlern und Touristen am Rande der Stadt erreicht werden kann. Nur so kann jeder öffentliche Verkehr die Fahrpläne einhalten, und es besteht keine Notwendigkeit für eine Struktur wie die geplante Straßenbahn, die tatsächlich nur die Linie 8 eliminiert. Ich habe auch meine ernsthaften Zweifel, dass das Transporministerium das Projekt genehmigen wird.
Wir sind weit entfernt von dem, was in Florenz und Bergamo getan wurde, wenn wir wirklich Vergleiche anstellen wollen, nur um die oben genannten Beispiele in den letzten Tagen zu nennen.
Es genügt nur an das verrückte Projekt zur Verlängerung der Jenesier Seilbahn zur Talferbrücke zu erinnern. https://www.salto.bz/it/article/09032016/nuova-funivia-di-san-genesio-u…
Wie soll man den Verkehr, der von anderen Routen in die Stadt kommt, stoppen? Wird es die notwendigen Mittel geben? Oder saugt das Tram-Projekt jegliche Ressourcen auf? Die Haushalte sind und werden in Zukunft immer magerer. Warum in Bozen in den letzten Jahrzehnten fast nichts getan wurde, ist ein Aspekt, der es verdient, ernsthaft und objektiv behandelt zu werden. Ich bezweifle, dass dies jemals geschehen wird.
In den letzten fünf Jahren fand und findet mit der Einführung der E-Busse eine regelrechte Revolution in der Branche, die wahrscheinlich von vielen gar nicht gemerkt wurde. Man hat bereits H2- und E-Busse in Bozen, die ein klares Beispiel sind, wie die Zukunft der E-Mobilität im ÖPNV aussehen könnte (ich sehe auch noch Chancen bei den Erdgasbussen, aber das sind Antriebsaspekte, die eine andere Diskussion auslösen würden...) wenn man nur die 40+40 Millionen der GemBz und des Landes anders einsetzen könnte.
Bozen braucht schnelle und rationale aber auch drastische Lösungen um das Dilemma Verkehr/ÖPNV zu lösen. Dies kann ohne weiteres ohne Tram geschehen.
Oder - ganz provokativ - sind diese Lösungen nicht appetitlich genug weil diese... viel weniger kosten? Gute Frage, oder?
Antwort auf Wir sollten endlich aufhören, von Michele De Luca
Zur Aussage: "Warum in Bozen
Zur Aussage: „Warum in Bozen in den letzten Jahrzehnten fast nichts getan wurde, ist ein Aspekt, der es verdient, ernsthaft und objektiv behandelt zu werden. Ich bezweifle, dass dies jemals geschehen wird.“ Carmaschi hat es auf den Punkt gebracht: weil es immer jemanden gab in Bozen, der es besser wissen wollte! Es wurde geredet, nach einer noch besseren Lösung gesucht und nichts beschlossen. Wenn auch jetzt die Entscheidung zur Tram wieder in Frage gestellt wird, brauchen wir uns nicht zu wundern,
wenn das Land die Landeshauptstadt Bozen wieder auf das Abstellgleis stellt und alle anderen Dörfer und Städte bei wichtigen Vekehrsinfrastrukturen unterstützt. ...und die weiteren „schnellen und drastischen Massnahmen“ wird es im Laufe der Umsetzung des nachhaltigen Mobilitätsplans (PUMS)ohnehin geben, mit und ohne Tram, weil allen klar geworden ist, dass es umfassende Massnahmen braucht, um die Stadt vom Verkehr zu befreien und den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben...
Antwort auf Zur Aussage: "Warum in Bozen von Margot Wittig
Im PUMS sind so viele
Im PUMS sind so viele Maßnahmen faktisch für die Autos vorgesehen, dass man sich sicherlich die Frage stellen muss, ob diese wirklich die Stadt entlasten werden oder ob diese noch mehr Verkehr anziehen werden.
Wenn - wie auch in einem Beitrag klar hervorgehoben wurde: https://www.salto.bz/it/article/19112019/quanto-incide-il-tram-sullaria - die Luftqualitätswerte nur geringfügig verbessert (sogar inklusive des Beitrages der E-Mobilität!) werden, bedeutet, dass die vorgesehenen Maßnahmen ganz einfach nicht ausreichen.
Bereits bei den offiziellen Veranstaltungen habe ich gefragt, ob es vorgesehen ist, die Pendler vor der Stadtgrenze zu stoppen und habe nur vom BM gehört „... con calma...“. Na dann, gute Nacht!
Ich will das Thema nicht klein reden, aber mir scheint, dass man drastische und effektive Maßnahmen zum Zwecke der Verkehrsreduzierung vermeidet hat. Demzufolge ist die Straßenbahn, und insbesondere dieses Projekt, absolut ein No-Go weil - das ist der Punkt - praktikablere (und kostengünstigere) Sofortmaßnahmen möglich wären.
Nur zur „barrierefreien“ Tram: es kann nicht möglich sein, wenn man eine objektive Betrachtung macht, dass man dies als Halleluja bezeichnet, wenn man dann erfährt (sieht man auch auf den Renderings), dass die Straßenbahn 28 cm hohe Bürgersteige braucht und hingegen die Busse 18 cm hohe Bürgersteige benötigen. Das bedeutet, dass man selbst die Bushaltestellen „barrierefrei“ ohne weiteres gestalten kann. Demzufolge ist dieser Vorteil der Tram dahin. Aber man hat es - ziemlich naiv - verherrlicht, auch im offiziellen Video, als ob dies eine absolute Neuigkeit wäre.